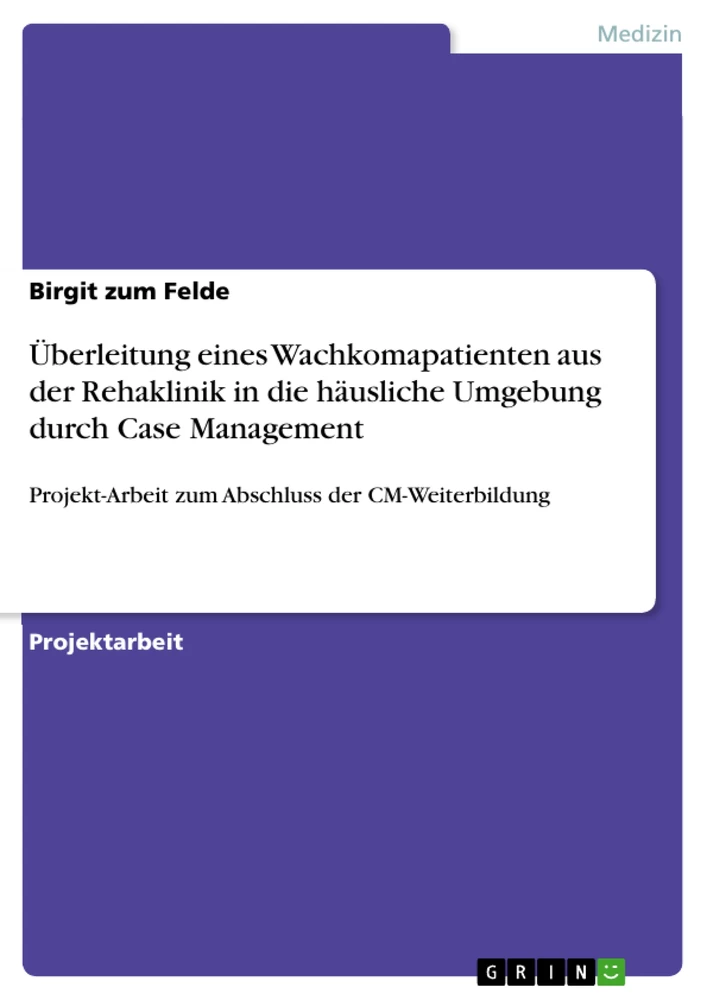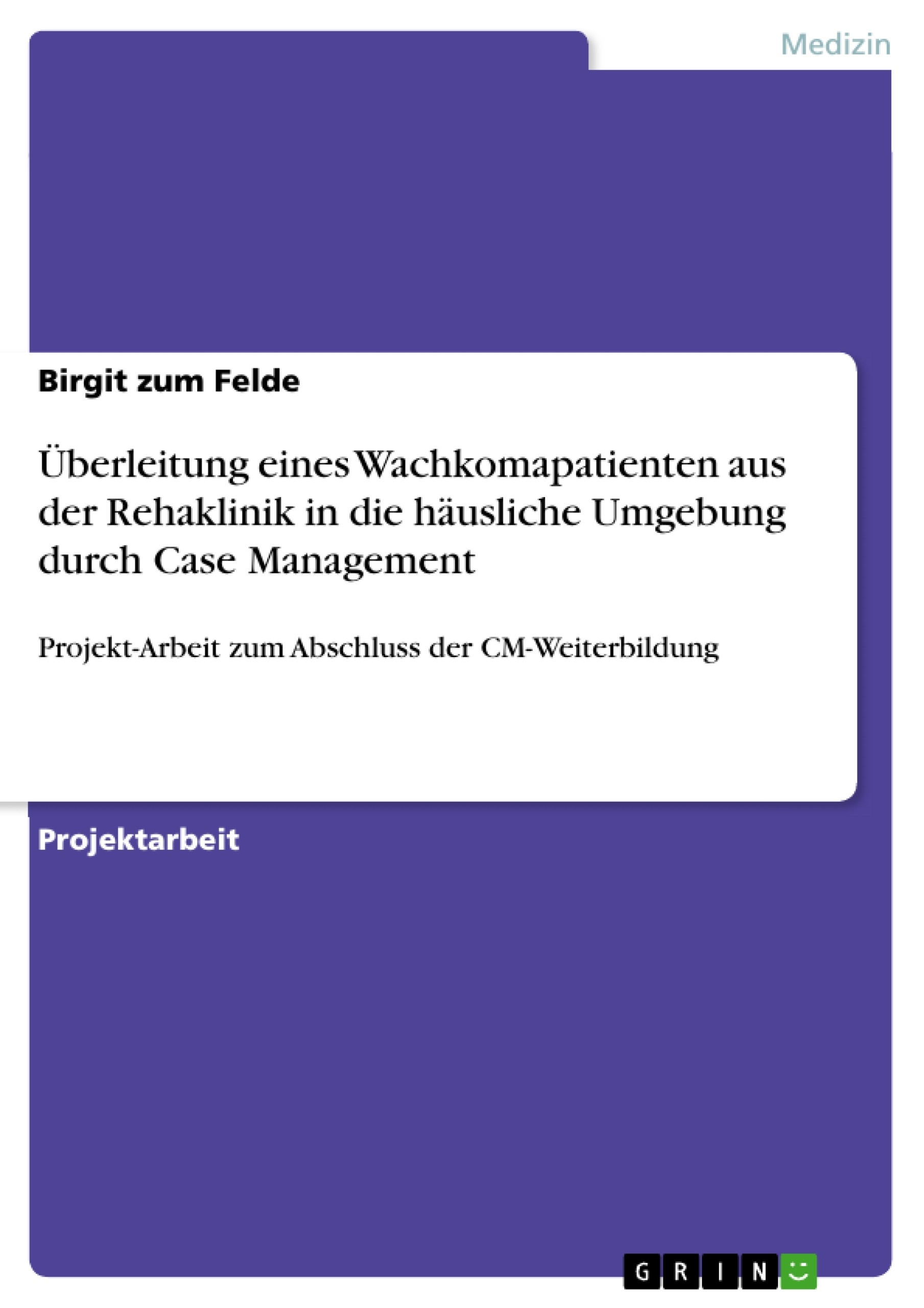Vielen Menschen in unserer Gesellschaft ist nicht bewusst, wie viele Menschen im Wachkoma liegen. Noch weniger bekannt ist den Menschen, wie viele Wachkomapatienten davon zu Hause gepflegt werden.
..."Ungefähr 6.000 Menschen liegen in Deutschland z.B. nach einem Unfall oder einer Wiederbelebung bei einem Herzinfarkt im Wachkoma. 4.500 davon werden zu Hause von Angehörigen über lange Jahre versorgt. Die Zahlen lassen sich nur schätzen, genaue Untersuchungen zu diesem Krankheitsbild und auch zur Pflege
dieser Menschen liegen nicht vor." (Studie der Universität Witten/Herdecke 1999)[1]
Um Menschen im Wachkoma versorgen zu können, entsteht ein erheblicher logistischer, rechtlicher und finanzieller Aufwand, der gut organisiert und strukturiert sein muss, damit keine Versorgungsabbrüche entstehen. Bereits vor Entlassung
aus dem Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung müssen die richtigen Weichen gestellt sein. Nicht selten kommt es bereits an dieser Stelle zu Versorgungsabbrüchen durch mangelnde Absprachen, nicht geklärter Finanzierung, fehlende Informationen und nicht eingehaltene Termine der Netzwerkpartner.
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, zu klären, ob durch Case Management eine ganzheitliche, kontinuierliche Versorgung eines Wachkomapatienten, ab dem Entlassungstag ohne Versorgungseinbrüche gewährleistet werden kann.
Im theoretischen Teil wird zunächst auf die Grundlagen des Case Management Regelkreises eingegangen. Anschließend erfolgt die Beschreibung des Soll-Zustandes anhand eines Praxisbeispieles. Danach erfolgt die Erstellung eines Evaluationsbogens. Abschließend folgt dann das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Praxisbeispiel "Wachkoma"
- 3 Theoretische Grundlagen
- 3.1 Kernfunktionen des Case Managers
- 3.1.1 Intake, Auswahl des Klienten nach Versorgungsbedarf (Identifikation)
- 3.1.2 Assessment, Erhebung des Versorgungsbedarfes
- 3.1.3 Interdisziplinäre Entwicklung des Versorgungsplanes
- 3.1.4 Implementierung des Versorgungsplanes
- 3.1.5 Monitoring des Versorgungsplanes
- 3.1.6 Evaluation des Versorgungsplanes
- 3.1.7 Abschlussevaluation, Versorgungsziel erreicht
- 3.1 Kernfunktionen des Case Managers
- 4 Beschreibung des Soll-Zustandes
- 4.1 Intake, Auswahl des Patienten nach Versorgungsbedarf
- 4.2 Assessment, Erhebung des Versorgungsbedarfes
- 4.3 Interdisziplinäre Erstellung des Versorgungsplanes
- 4.4 Implementierung des Versorgungsplanes
- 4.5 Monitoring des Versorgungsplanes
- 4.6 Evaluation des Versorgungsplanes
- 4.7 Erstellen eines Evaluationsbogens
- 4.8 Abschlussevaluation
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten des Case Managements bei der kontinuierlichen Versorgung eines Wachkomapatienten nach der Entlassung aus der Rehaklinik. Ziel ist es, die Gewährleistung einer ganzheitlichen Versorgung ohne Unterbrechungen zu analysieren.
- Case Management im Kontext der Wachkoma-Pflege
- Die Kernfunktionen des Case Managers im praktischen Einsatz
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination
- Entwicklung und Implementierung eines Versorgungsplanes
- Evaluation der Versorgung und Erfolgsmessung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die wenig bekannte Problematik der Wachkoma-Versorgung, insbesondere die häusliche Pflege. Sie unterstreicht den hohen logistischen, rechtlichen und finanziellen Aufwand und die häufige Problematik von Versorgungsabbrüchen aufgrund mangelnder Koordination. Die Arbeit untersucht daher, ob Case Management eine kontinuierliche und ganzheitliche Versorgung gewährleisten kann.
2 Praxisbeispiel "Wachkoma": Dieses Kapitel präsentiert den Fall von Sven S., einem 30-jährigen Wachkomapatienten nach einem Verkehrsunfall. Es beschreibt seinen Verlauf von der Akutversorgung bis zur Überweisung in die Rehaklinik und den anschließenden Plan, ihn in ein häusliches Umfeld mit betreuter Pflege zu überführen. Der Fall dient als Grundlage für die praktische Anwendung der Case-Management-Prinzipien.
3 Theoretische Grundlagen: Dieser Abschnitt definiert Case Management und beschreibt die Kernfunktionen des Case Managers nach Dörpinghaus (2004) und der Johanniter-Schwesternschaft. Es werden die einzelnen Phasen des Case-Management-Prozesses – Intake, Assessment, Planung, Implementierung, Monitoring und Evaluation – detailliert erläutert und ihre Bedeutung für eine erfolgreiche Versorgung hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung des Patienten und der interdisziplinären Kooperation.
4 Beschreibung des Soll-Zustandes: Dieses Kapitel wendet die im vorherigen Kapitel beschriebenen theoretischen Grundlagen auf den Praxisfall von Sven S. an. Es beschreibt detailliert die einzelnen Schritte des Case-Managements – vom Intake und Assessment bis zur Implementierung und Evaluation des Versorgungsplanes – und zeigt die Herausforderungen und Lösungsansätze in der Praxis. Die Erstellung eines Evaluationsbogens wird ebenfalls beleuchtet, um die Wirksamkeit des Versorgungsplanes zu messen.
Schlüsselwörter
Case Management, Wachkoma, Versorgungsplanung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Patientenbegleitung, Rehabilitation, häusliche Pflege, Evaluation, Versorgungsqualität.
Häufig gestellte Fragen zu: Case Management bei Wachkoma-Patienten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendung von Case Management bei der kontinuierlichen Versorgung eines Wachkoma-Patienten nach der Entlassung aus der Rehaklinik. Der Fokus liegt auf der Gewährleistung einer ganzheitlichen und unterbrechungsfreien Versorgung.
Welche Kernfunktionen des Case Managements werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Kernfunktionen des Case Managers, inklusive Intake (Patientenauswahl), Assessment (Bedarfsanalyse), interdisziplinäre Planung des Versorgungsplanes, Implementierung, Monitoring und Evaluation des Plans. Dabei wird auf die Bedeutung der ganzheitlichen Betrachtung des Patienten und der interdisziplinären Zusammenarbeit eingegangen.
Welches Praxisbeispiel wird verwendet?
Der Fall von Sven S., einem 30-jährigen Wachkoma-Patienten nach einem Verkehrsunfall, dient als Praxisbeispiel. Der Verlauf von der Akutversorgung bis zur geplanten häuslichen Pflege wird beschrieben und als Grundlage für die praktische Anwendung der Case-Management-Prinzipien genutzt.
Welche theoretischen Grundlagen werden herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf die Definitionen des Case Managements nach Dörpinghaus (2004) und der Johanniter-Schwesternschaft. Die einzelnen Phasen des Case-Management-Prozesses werden detailliert erläutert und ihre Bedeutung für eine erfolgreiche Versorgung hervorgehoben.
Wie wird der "Soll-Zustand" beschrieben?
Das Kapitel "Beschreibung des Soll-Zustandes" wendet die theoretischen Grundlagen auf den Fall von Sven S. an. Es beschreibt Schritt für Schritt den Case-Management-Prozess, inklusive der Herausforderungen und Lösungsansätze in der Praxis. Die Erstellung eines Evaluationsbogens zur Erfolgsmessung wird ebenfalls behandelt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten des Case Managements bei der kontinuierlichen Versorgung eines Wachkoma-Patienten zu analysieren und die Gewährleistung einer ganzheitlichen Versorgung ohne Unterbrechungen zu untersuchen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Case Management im Kontext der Wachkoma-Pflege, die Kernfunktionen des Case Managers, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination, Entwicklung und Implementierung eines Versorgungsplanes sowie die Evaluation der Versorgung und Erfolgsmessung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Case Management, Wachkoma, Versorgungsplanung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Patientenbegleitung, Rehabilitation, häusliche Pflege, Evaluation und Versorgungsqualität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Praxisbeispiel, einen Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Beschreibung des Soll-Zustandes und ein Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
- Quote paper
- Birgit zum Felde (Author), 2009, Überleitung eines Wachkomapatienten aus der Rehaklinik in die häusliche Umgebung durch Case Management, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146765