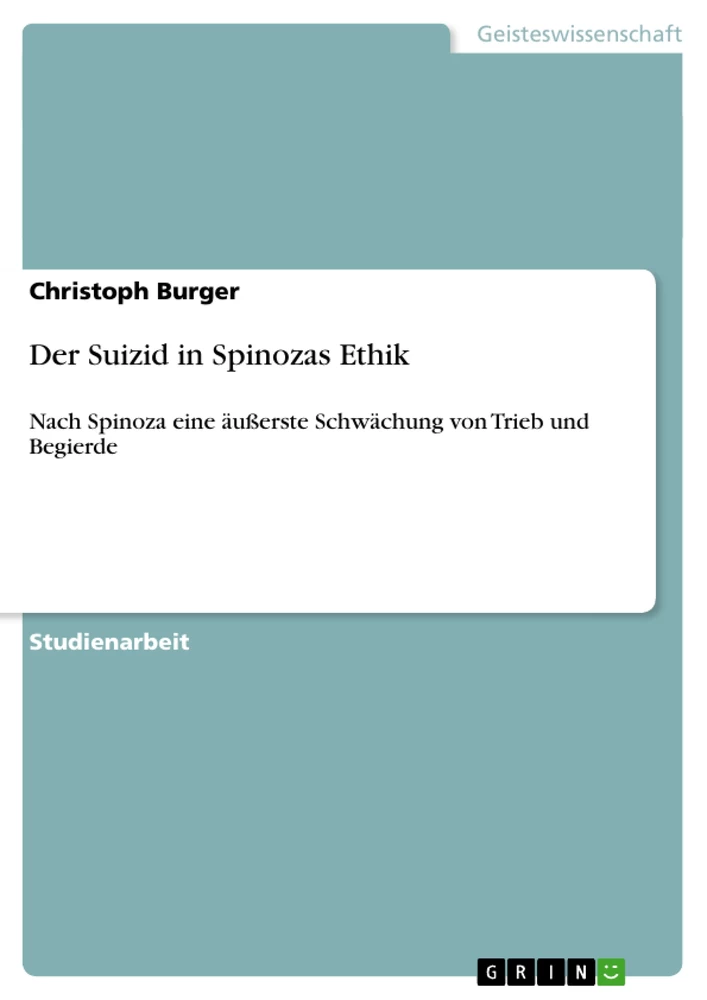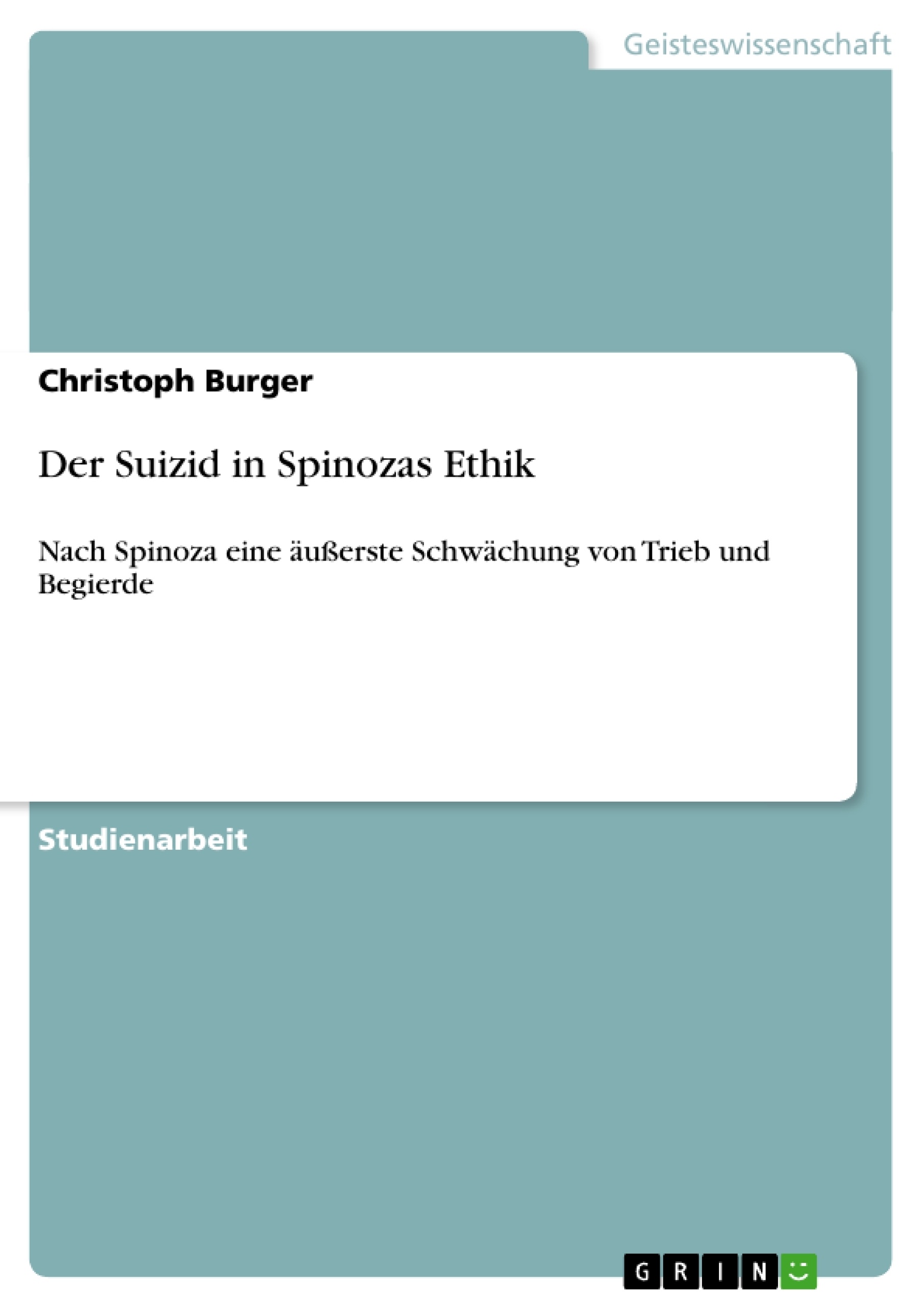Diese Arbeit ist in einem Philosophieseminar an der Universität Wien im Sommersemester 2006 entstanden. Es handelt sich um eine Reflexion darüber, wie Spinoza den Suizidbegriff in seiner "Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt" versteht. Um den Sachverhalt adäquat darstellen zu können, ist es erstmal notwendig die Begriffe „Trieb“ und „Begierde“ im spinozanischen Sinne zu definieren.
Die ursprünglichste aller Bewegursachen im Bereich der natürlichen Dinge ist deren Streben (conatus) nach Selbsterhaltung, der natürliche Selbsterhaltungstrieb (appetitus) lebendiger Wesen, der im Menschen unter den Bedingungen möglichen Bewusstseins die Form der natürlichen Begierde (cupiditas) annimmt. Der Conatus wird von Spinoza als die elementare Bestimmung eines jeden endlichen Dinges verstanden. Diese Bestimmung lautet: „Jedes Ding strebt, soviel in ihm ist, in seinem Sein zu verharren“ (LS 6, III). Conatus strebt das positive an, nämlich „zu sein, zu handeln und zu leben“ (LS 21, IV), in welcher Form dies auch immer gelingen oder auch mißlingen mag. Der Mensch begleitet den Conatus nicht nur mit Bewusstsein, sondern gestaltet ihn auch durch dieses. Begierde ist des Menschen Essenz selbst, insofern diese als von irgendeiner ihrer gegebenen Affektionen zu einem Handeln bestimmt begriffen wird. (D 1, III)
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BEGRIFFERKLÄRUNG
- 3. AFFEKTE
- 4. ESSENZ DER DINGE
- 5. WIE IST SUIZID ÜBERHAUPT MÖGLICH?
- 6. SUIZID ALS ÄUSSERSTE SCHWÄCHUNG VON TRIEB UND BEGIERDE
- 7. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Spinozas Verständnis von Suizid im Kontext seiner Ethik. Sie analysiert, wie Spinoza den Suizidbegriff in Verbindung mit den Konzepten von Trieb und Begierde versteht. Die Arbeit zielt darauf ab, Spinozas Philosophie zu Suizid verständlich und prägnant darzustellen.
- Spinozas Konzept des Conatus (Strebens nach Selbsterhaltung)
- Die Definition von Trieb und Begierde in Spinozas Philosophie
- Die Rolle von Affekten (Emotionen) im Verständnis von Suizid
- Der Zusammenhang zwischen adäquater und inadäquater Erkenntnis und Suizid
- Suizid als extreme Schwächung von Trieb und Begierde
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt den Fokus auf Spinozas Verständnis von Suizid in seiner „Ethik“.
2. Begrifferklärung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Trieb“ und „Begierde“ im spinozistischen Kontext. Es erklärt den Conatus als das grundlegende Streben jedes Dinges nach Selbsterhaltung und dessen Ausprägung als Begierde beim Menschen. Der Conatus wird als das positive Streben nach Sein, Handeln und Leben beschrieben, wobei das Bewusstsein des Menschen eine gestaltende Rolle spielt. Begierde wird als die Essenz des Menschen definiert, bestimmt durch Affektionen und Handlungen.
3. Affekte: Hier werden die menschlichen Uraffekte, Trieb, Begierde, Liebe und Hass, als natürliche Dinge im Sinne Spinozas erläutert, die der allgemeinen Gesetzmäßigkeit der Natur unterliegen. Die Bedeutung dieser Gesetzmäßigkeiten für das Verständnis menschlichen Verhaltens wird hervorgehoben. Die Unterscheidung zwischen passiven Affekten (Leidenschaften), die die Macht des Menschen hemmen, und aktiven Affekten, die sie erhöhen, wird erklärt.
4. Essenz der Dinge: Dieses Kapitel betont Spinozas zentrale These, dass die Essenz jedes Dinges im Verharren in seinem Sein liegt. Es stellt die Frage, wie Suizid angesichts dieser Aussage überhaupt möglich ist, da ein Ding seine eigene Existenz nicht aufheben kann.
5. Wie ist Suizid überhaupt möglich?: Dieses Kapitel beantwortet die Frage aus Kapitel 4. Es argumentiert, dass die Selbsterhaltung (Conatus) nicht unabhängig von der Aktivität des Strebens selbst existiert. Die Entfaltung dieser Aktivität ist jedoch durch äußere Einflüsse gefährdet, und die Kraft des Menschen ist begrenzt im Vergleich zur Macht äußerer Umstände. Die Unterscheidung zwischen gelingender und misslingender Realisierung des eigenen Seins wird eingeführt, wobei gelingendes Leben als Tugend (virtus) bezeichnet wird und von adäquater Erkenntnis abhängt.
6. Suizid als äußerste Schwächung von Trieb und Begierde: In diesem Kapitel wird Suizid als Resultat der Schwächung des Conatus oder der Begierde dargestellt, verursacht durch Leidenschaften (passive Affekte) und inadäquate Erkenntnis, die zu einem verzerrten Bild der eigenen Natur führt.
Schlüsselwörter
Suizid, Spinoza, Ethik, Conatus, Trieb, Begierde, Affekte, Leidenschaften, adäquate Erkenntnis, inadäquate Erkenntnis, Selbsterhaltung, Tugend (virtus).
Spinoza und Suizid: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Baruch Spinozas Verständnis von Suizid im Kontext seiner Ethik. Sie analysiert, wie Spinoza den Suizidbegriff mit den Konzepten von Trieb und Begierde verbindet und zielt darauf ab, Spinozas Philosophie zum Thema Suizid verständlich und prägnant darzustellen.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit erläutert?
Die Arbeit erklärt zentrale Begriffe wie „Trieb“, „Begierde“, und „Conatus“ (Streben nach Selbsterhaltung) im spinozistischen Kontext. Es wird die Bedeutung von Affekten (Emotionen), insbesondere die Unterscheidung zwischen passiven (Leidenschaften) und aktiven Affekten, sowie der Zusammenhang zwischen adäquater und inadäquater Erkenntnis im Hinblick auf Suizid behandelt.
Wie definiert Spinoza Trieb und Begierde?
Der Conatus wird als das grundlegende Streben jedes Dinges nach Selbsterhaltung beschrieben, wobei beim Menschen die Begierde als dessen Ausprägung gesehen wird. Begierde wird als die Essenz des Menschen definiert, bestimmt durch Affektionen und Handlungen. Trieb wird im Kontext der menschlichen Uraffekte im Verhältnis zu Begierde, Liebe und Hass erklärt.
Welche Rolle spielen Affekte im Verständnis von Suizid?
Die menschlichen Uraffekte (Trieb, Begierde, Liebe, Hass) unterliegen Spinozas zufolge allgemeinen Naturgesetzen. Passive Affekte (Leidenschaften) hemmen die Macht des Menschen, während aktive Affekte sie erhöhen. Suizid wird als Resultat der Schwächung des Conatus oder der Begierde durch Leidenschaften und inadäquate Erkenntnis dargestellt.
Wie erklärt Spinoza die Möglichkeit von Suizid?
Spinoza argumentiert, dass die Selbsterhaltung (Conatus) nicht unabhängig von der Aktivität des Strebens selbst existiert. Die Entfaltung dieser Aktivität ist jedoch durch äußere Einflüsse gefährdet, und die Kraft des Menschen ist begrenzt. Suizid entsteht durch eine misslingende Realisierung des eigenen Seins, bedingt durch inadäquate Erkenntnis und die Übermacht passiver Affekte.
Was ist der Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Suizid bei Spinoza?
Adäquate Erkenntnis führt zu einem gelingenden Leben (Tugend – virtus), während inadäquate Erkenntnis zu einem verzerrten Bild der eigenen Natur und damit zur Schwächung von Trieb und Begierde und letztendlich zum Suizid führen kann.
Wie wird Suizid in der Arbeit letztendlich dargestellt?
Suizid wird als das Ergebnis einer extremen Schwächung des Conatus und der Begierde dargestellt, verursacht durch die Übermacht von Leidenschaften (passiven Affekten) und inadäquate Erkenntnis, welche zu einem falschen Verständnis der eigenen Natur führt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begrifferklärung, Affekte, Essenz der Dinge, Wie ist Suizid überhaupt möglich?, Suizid als äußerste Schwächung von Trieb und Begierde, und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt von Spinozas Philosophie im Kontext von Suizid, beginnend mit der Begriffsklärung und endend mit einer zusammenfassenden Darstellung des Suizids als Resultat einer Schwächung des Strebens nach Selbsterhaltung.
- Quote paper
- Christoph Burger (Author), 2006, Der Suizid in Spinozas Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146610