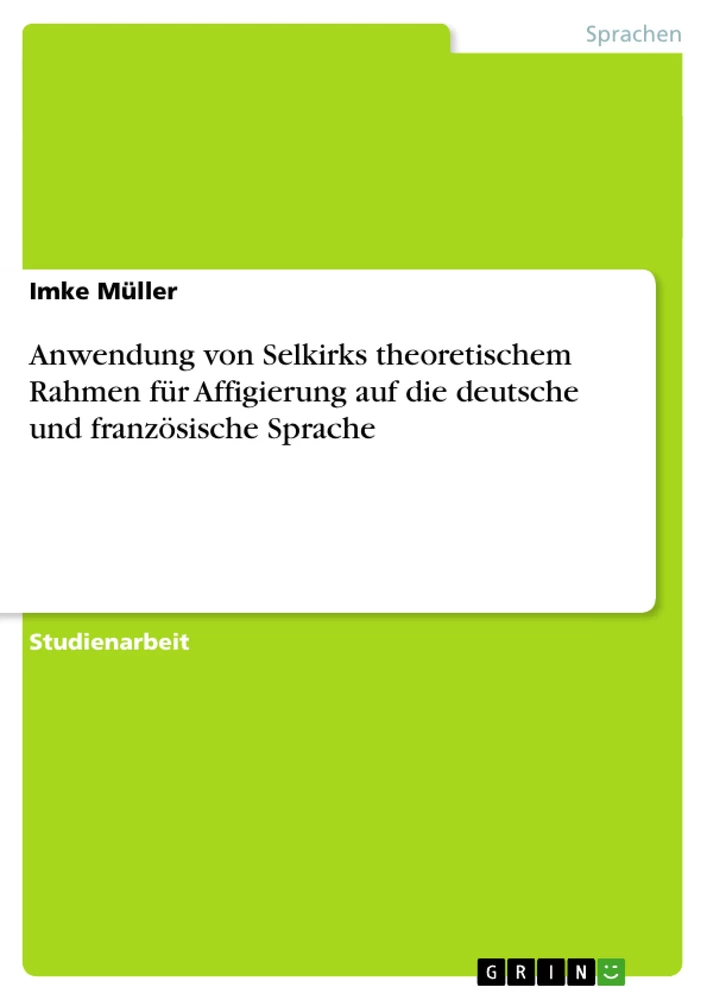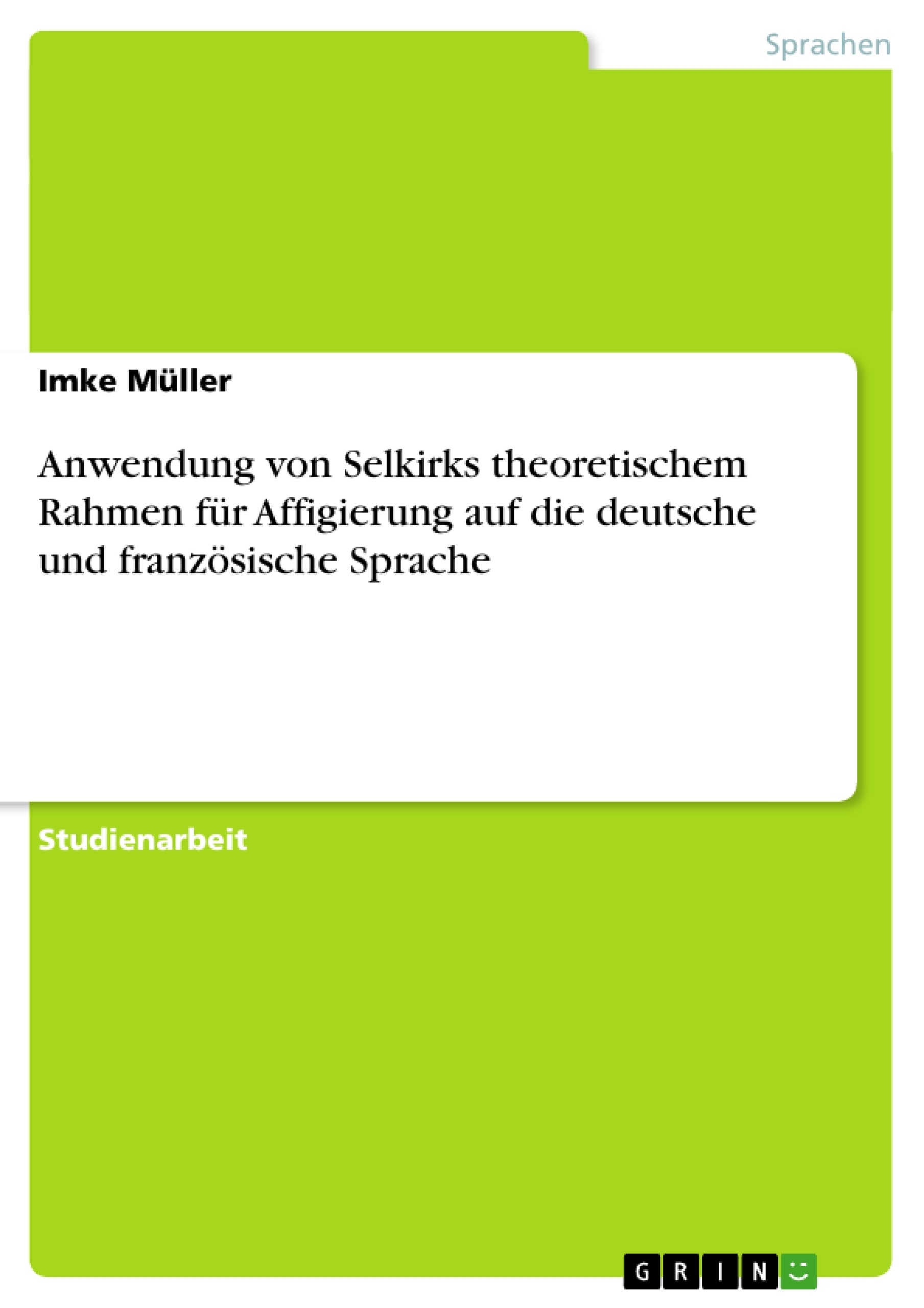In dieser Hausarbeit möchte mich besonders mit den theoretischen Rahmen E. Selkirks
zur Affigierung befassen. Dazu dient eingangs die Erarbeitung S. Olsens Affixtheorie,
bei der sie im Rahmen Selkirks arbeitet und deren Modell auf die deutsche
Sprache anwendet. Nach genauerer Ausführung mit Beispielen zur deutschen
Suffierung möchte ich dann in einem weiteren Schritt die Anwendbarkeit von Selkirks
Rahmen auf die französische Sprache überprüfen. Hierbei werde ich mih speziell
den -eur/-ateur-Suffigierungen widmen. Ziel soll es sein, die Problematik der
Übertragbarkeit eines theoretischen Modells auf eine andere Sprache zu erkennen,
Argumentationslücken aufzudecken und abschließend Vorschläge zur Problemlöoder
eigene Ideen zum Thema zu formulieren.
Mir erscheint es wichtig, nochmals im Vorweg zu sagen, daß es sich in dieser Arbeit
nicht im besonderen um Selkirks Affixmodell handelt, welches sie zunächst an ihrer
Muttersprache, Englisch, erarbeitet hat. Sondern es wird hauptsächlich Selkirks
Theorie durch Olsens Anwendung auf die deutsche Sprache erarbeitet werden. Das
Verstehen des Selkirkschen Modells soll dann befähigen, es auch auf eine andere
Sprache in der Anwendung zu überprüfen, in diesem Fall auf die französische Sprache.
An einigen Stellen meiner Arbeit werden noch andere Autoren Erwähnung finden,
sei es, um geeignete Hilfestellungen zur Beschreibung eines Problems zu liefern oder
ihrer abweichenden Meinung Rechnung zu tragen.
Inhaltsverzeichnis
- Darstellung des theoretischen Rahmens Olsens/Selkirks
- Einleitung und Lexikoneintrag für das Affix -er
- Genauere Betrachtung der Kategorialen Charakterisierung
- Genauere Betrachtung des Subkategorisierungsrahmens
- Genauere Betrachtung der Semantischen Charakterisierung
- Regelhafte Operationen auf der Argumentstruktur der Basiskategorie
- Die Argumentvererbung vom Verb über die -er-Suffigierung zum Derivat
- Objektstellenbesetzung durch Bildung von Rektionskomposita
- Transparenzthese vs. Fakultativitätsthese
- Akzeptabilitätsempfinden des Native Speaker
- Weltwissen, Stereotypenbildung und Usualisierung
- Applizierbarkeit des Theta-Kriteriums
- Deutung
- Deutung als Agens und/oder Instrument
- Deutung als professionelle oder habituelle Tätigkeit
- Anwendung der Theorie Olsens/Selkirks auf das Französische
- Lexikoneintrag für die Affixe -eur/-ateur
- Genauere Betrachtung der KC
- Genauere Betrachtung des SK
- Genauere Betrachtung der SC
- Regelhafte Operationen auf der Argumentstruktur der Basiskategorie
- Argumentvererbung vom Verb über die -eur/-ateur-Anbindung zum Derivat
- Besetzung der Objektargumentstelle durch Bildung von präpositionalen Komposita
- Weltwissen, Stereotypen, kontextuelles Schließen der Objektstelle und Usualisierung
- Akzeptabilitätsempfinden des Native Speaker
- Applizierbarkeit des Theta-Kriteriums
- Deutung
- Deutung als Agens und/oder Instrument
- Deutung als professionelle oder habituelle Tätigkeit
- Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des theoretischen Rahmens von E. Selkirk zur Affigierung, insbesondere durch die Anwendung von S. Olsens Modell auf die deutsche Sprache. Das Ziel ist die Überprüfung der Übertragbarkeit dieses Modells auf die französische Sprache, die Identifizierung von Argumentationslücken und die Formulierung von Lösungsvorschlägen. Der Fokus liegt auf der Analyse der -er-Suffigierung im Deutschen und der -eur/-ateur-Suffigierung im Französischen.
- Anwendung des theoretischen Rahmens von Selkirk auf die deutsche Sprache
- Analyse der -er-Suffigierung im Deutschen
- Überprüfung der Übertragbarkeit des Modells auf das Französische
- Analyse der -eur/-ateur-Suffigierung im Französischen
- Identifizierung von Argumentationslücken und Lösungsvorschläge
Zusammenfassung der Kapitel
Darstellung des theoretischen Rahmens Olsens/Selkirks: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den theoretischen Rahmen von Olsen und Selkirk zur Affigierung einführt. Es dient als Basis für die spätere Anwendung auf die deutsche und französische Sprache. Die Einleitung erläutert den Fokus der Arbeit auf Olsens Anwendung von Selkirks Theorie auf das Deutsche, anstatt auf Selkirks ursprüngliches, auf Englisch basierendes Modell. Der Lexikoneintrag für das deutsche Suffix -er wird präsentiert und analysiert.
Genauere Betrachtung der Kategorialen Charakterisierung: Diese Kapitelteil befasst sich eingehend mit der kategorialen Charakterisierung der Affigierung im Rahmen von Olsen/Selkirk. Es werden die relevanten grammatikalischen Kategorien und deren Zusammenhänge im Detail erläutert, um ein umfassendes Verständnis für die Struktur des Modells zu schaffen. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung der grammatischen Regeln und ihrer Anwendung auf die Analyse von Wörtern.
Genauere Betrachtung des Subkategorisierungsrahmens: In diesem Kapitel wird der Subkategorisierungsrahmen des Olsens/Selkirkschen Modells detailliert dargestellt. Die verschiedenen Subkategorien und deren Bedeutung für die Affigierung werden erläutert, und es wird gezeigt, wie sie zur Analyse der Wortbildung beitragen. Die Darstellung beleuchtet die hierarchische Organisation der Subkategorien und ihre Interaktion innerhalb des Gesamtmodells.
Genauere Betrachtung der Semantischen Charakterisierung: Dieses Kapitel analysiert die semantische Komponente der Affigierung im Rahmen des Olsens/Selkirkschen Modells. Es werden die regelhaften Operationen auf der Argumentstruktur der Basiskategorie untersucht, einschließlich der Argumentvererbung, der Objektstellenbesetzung und der Bedeutung von Transparenz und Fakultativität. Die Rolle von Weltwissen, Stereotypen und dem Akzeptabilitätsempfinden des Native Speakers werden ebenso diskutiert, wie die Anwendbarkeit des Theta-Kriteriums. Die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, sowohl als Agens und/oder Instrument als auch als professionelle oder habituelle Tätigkeit, werden ebenfalls untersucht.
Anwendung der Theorie Olsens/Selkirks auf das Französische: Dieses Kapitel wendet den in den vorherigen Kapiteln erarbeiteten theoretischen Rahmen auf die französische Sprache an. Der Fokus liegt auf der Analyse der -eur/-ateur-Suffixe. Die Übertragbarkeit des Modells wird kritisch geprüft, und mögliche Unterschiede zwischen dem Deutschen und Französischen werden herausgestellt.
Genauere Betrachtung der KC, Genauere Betrachtung des SK, Genauere Betrachtung der SC: Diese Kapitel untersuchen jeweils die kategoriale, subkategorielle und semantische Charakterisierung der Affigierung im Französischen, analog zu den Kapiteln für die deutsche Sprache. Sie analysieren die spezifischen Eigenschaften der französischen -eur/-ateur-Suffixe im Kontext des Olsens/Selkirkschen Rahmens, und vergleichen diese mit den Ergebnissen der deutschen Analyse. Die Diskussion umfasst die Argumentvererbung, die Objektstellenbesetzung, das Weltwissen, Stereotypen und die Anwendbarkeit des Theta-Kriteriums für die französischen Beispiele.
Schlüsselwörter
Affigierung, Selkirk, Olsen, deutsche Sprache, französische Sprache, -er-Suffix, -eur/-ateur-Suffix, Argumentstruktur, Theta-Kriterium, Wortbildung, Semantik, Kategoriale Charakterisierung, Subkategorisierung, Übertragbarkeit, Modell, Akzeptabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Anwendung des theoretischen Rahmens von Olsen/Selkirk auf die deutsche und französische -er/-eur/-ateur-Suffigierung
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des theoretischen Rahmens von E. Selkirk zur Affigierung, insbesondere durch die Anwendung von S. Olsens Modell auf die deutsche Sprache. Ziel ist die Überprüfung der Übertragbarkeit dieses Modells auf die französische Sprache, die Identifizierung von Argumentationslücken und die Formulierung von Lösungsvorschlägen. Der Fokus liegt auf der Analyse der -er-Suffigierung im Deutschen und der -eur/-ateur-Suffigierung im Französischen.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem theoretischen Rahmen von E. Selkirk zur Affigierung und dessen Anwendung durch S. Olsen auf die deutsche Sprache. Das Modell wird auf die französische Sprache übertragen und kritisch evaluiert.
Welche Suffixe werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf das deutsche Suffix "-er" und die französischen Suffixe "-eur" und "-ateur".
Welche Aspekte der Affigierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die kategoriale, subkategorielle und semantische Charakterisierung der Affigierung. Dies beinhaltet die Argumentstruktur, die Argumentvererbung, die Objektstellenbesetzung, die Rolle von Weltwissen und Stereotypen, das Akzeptabilitätsempfinden des Native Speakers und die Anwendbarkeit des Theta-Kriteriums.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Darstellung des theoretischen Rahmens von Olsen/Selkirk, einer detaillierten Betrachtung der kategorialen, subkategorialen und semantischen Charakterisierung für das Deutsche und das Französische, sowie eine abschließende Bemerkung. Jedes Kapitel analysiert die jeweiligen Aspekte für die deutsche -er-Suffigierung und die französische -eur/-ateur-Suffigierung.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die deutsche und die französische Sprache hinsichtlich der Anwendung des gewählten theoretischen Modells auf die jeweiligen Suffixe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Affigierung, Selkirk, Olsen, deutsche Sprache, französische Sprache, -er-Suffix, -eur/-ateur-Suffix, Argumentstruktur, Theta-Kriterium, Wortbildung, Semantik, Kategoriale Charakterisierung, Subkategorisierung, Übertragbarkeit, Modell, Akzeptabilität.
Was sind die Ergebnisse der Hausarbeit?
Die Ergebnisse der Hausarbeit zeigen die Übertragbarkeit und Grenzen des Olsens/Selkirkschen Modells auf die französische Sprache auf. Es werden Argumentationslücken identifiziert und Lösungsvorschläge formuliert. Die Ergebnisse liefern ein detailliertes Verständnis der semantischen und syntaktischen Eigenschaften der untersuchten Suffixe in beiden Sprachen.
- Quote paper
- Imke Müller (Author), 1995, Anwendung von Selkirks theoretischem Rahmen für Affigierung auf die deutsche und französische Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14655