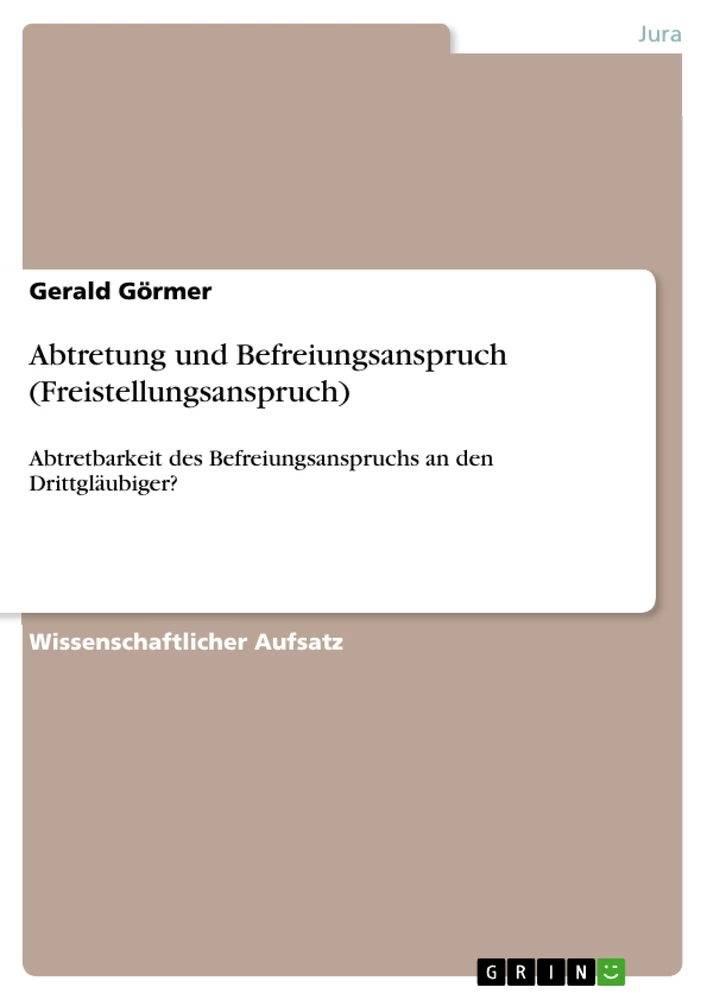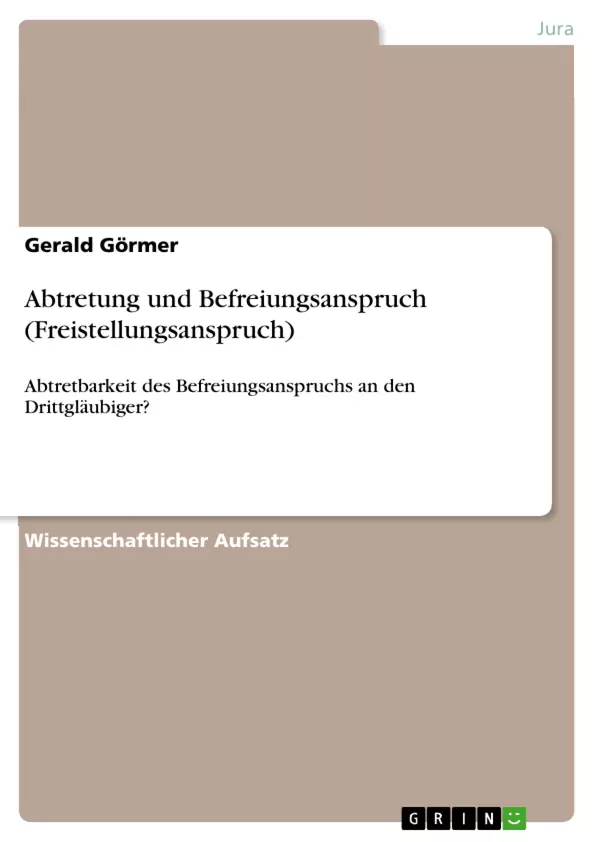Der Befreiungsanspruch (Freistellungsanspruch) ist zwar grundsätzlich wegen § 399 Alt.1 BGB (Inhaltsänderung) unabtretbar. Nach ganz herrschender Meinung kann er aber ausnahmsweise wirksam an den Drittgläubiger abgetreten werden, obgleich er sich auch dabei zwangsläufig in einen Zahlungsanspruch verändert. Das Reichsgericht begründete diese Ausnahme damit, daß sie praktisch sinnvoll sei, da sie dem Drittgläubiger - der ein eigenes Interesse daran habe - einen "Umweg" über den Befreiungsgläubiger und diesem eine Inanspruchnahme des Befreiungsschuldners erspare; zudem bliebe die Zahlstelle gleich. Dieser Meinung folgte der Bundesgerichtshof - unkritisch und ohne eigene Begründung. In jüngsten Urteilen von Oberlandesgerichten verzichtet man auf inhaltliche Argumente und verweist darauf, daß in der Rechtsprechung seit langem eine Abtretung des Befreiungsanspruchs an den Drittgläubiger anerkannt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritik an der herrschenden Meinung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs an einen Drittgläubiger. Sie kritisiert die herrschende Meinung, die eine solche Abtretbarkeit zulässt, und argumentiert für eine restriktivere Auslegung.
- Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs
- Rechtsnatur des Befreiungsanspruchs
- Kritik an der herrschenden Rechtsprechung
- Systematik des BGB
- Interessenabwägung zwischen Gläubigern und Schuldner
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs ein und stellt die herrschende Meinung dar, die eine ausnahmsweise Abtretbarkeit an den Drittgläubiger zulässt, basierend auf praktischer Sinnhaftigkeit und der Vermeidung eines „Umwegs“. Die Einleitung verweist auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs, die diese Ansicht unterstützen, und erwähnt jüngere Urteile von Oberlandesgerichten, die auf die etablierte Rechtsprechung verweisen, jedoch ohne eigene inhaltliche Argumentation.
Kritik an der herrschenden Meinung: Dieses Kapitel kritisiert die herrschende Meinung zur Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs. Es argumentiert, dass der vermeintliche „Umweg“ durch den Befreiungsanspruch der Eigenart des Rechtsinstituts entspricht und vom Gesetzgeber in Kauf genommen wurde. Die Autorin/der Autor weist darauf hin, dass die Zulassung der Abtretung den Befreiungsanspruch faktisch zu einem Zahlungsanspruch an einen Dritten macht, was seiner eigentlichen Natur widerspricht. Es wird argumentiert, dass die Veränderung von einem Befreiungs- in einen Zahlungsanspruch ungerechtfertigt ist und gegen § 399 Alt. 1 BGB verstößt. Die Autorin/der Autor betont die Bedeutung des Befreiungsanspruchs als Instrument zum Ausgleich von Vermögensbeeinträchtigungen im Frühstadium und die Notwendigkeit, zwischen Passiv- und Aktivvermögen zu unterscheiden. Die Gleichsetzung des Befreiungsanspruchs mit einem Zahlungsanspruch bei der Abtretbarkeit wird als systemwidrig bezeichnet, da dies im Gegensatz zu dessen Behandlung bei Aufrechenbarkeit und Vollstreckung steht. Die Autorin/der Autor schließt mit dem Argument, dass der Drittgläubiger kein rechtlich geschütztes Interesse an einer direkten Inanspruchnahme des Befreiungsschuldners hat.
Fazit: Das Fazit fasst die Argumentation zusammen und kommt zu dem Schluss, dass der Befreiungsanspruch aufgrund seiner besonderen Rechtsnatur und Funktion nicht an den Drittgläubiger abgetreten werden kann. Es existiere kein praktisches Bedürfnis oder rechtlich geschütztes Interesse, welches eine Ausnahme von § 399 Alt. 1 BGB rechtfertigen würde. Daher ist jede Abtretung des Befreiungsanspruchs wegen Inhaltsänderung unwirksam.
Schlüsselwörter
Befreiungsanspruch, Abtretbarkeit, Drittgläubiger, § 399 Alt. 1 BGB, Rechtsnatur, Zahlungsanspruch, Rechtsprechung, Interessenabwägung, Vermögensbeeinträchtigung, Passivvermögen, Aktivvermögen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs an einen Drittgläubiger. Sie kritisiert die herrschende Meinung, die eine solche Abtretbarkeit zulässt, und plädiert für eine restriktivere Auslegung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abtretbarkeit des Befreiungsanspruchs, die Rechtsnatur des Befreiungsanspruchs, die Kritik an der herrschenden Rechtsprechung, die Systematik des BGB und die Interessenabwägung zwischen Gläubigern und Schuldner.
Welche Meinung vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die Meinung, dass der Befreiungsanspruch aufgrund seiner besonderen Rechtsnatur und Funktion nicht an einen Drittgläubiger abgetreten werden kann. Eine Abtretung ist aufgrund von Inhaltsänderung unwirksam.
Wie argumentiert die Arbeit gegen die herrschende Meinung?
Die Arbeit argumentiert, dass der vermeintliche „Umweg“ durch den Befreiungsanspruch der Eigenart des Rechtsinstituts entspricht und vom Gesetzgeber in Kauf genommen wurde. Die Gleichsetzung des Befreiungsanspruchs mit einem Zahlungsanspruch bei der Abtretbarkeit wird als systemwidrig bezeichnet, da dies im Gegensatz zu dessen Behandlung bei Aufrechenbarkeit und Vollstreckung steht. Es wird betont, dass der Drittgläubiger kein rechtlich geschütztes Interesse an einer direkten Inanspruchnahme des Befreiungsschuldners hat.
Welche Rechtsquellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs sowie auf jüngere Urteile von Oberlandesgerichten. Sie beruft sich insbesondere auf § 399 Alt. 1 BGB.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst zusammen, dass der Befreiungsanspruch aufgrund seiner besonderen Rechtsnatur und Funktion nicht abgetreten werden kann. Es existiert kein praktisches Bedürfnis oder rechtlich geschütztes Interesse, welches eine Ausnahme von § 399 Alt. 1 BGB rechtfertigen würde.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Befreiungsanspruch, Abtretbarkeit, Drittgläubiger, § 399 Alt. 1 BGB, Rechtsnatur, Zahlungsanspruch, Rechtsprechung, Interessenabwägung, Vermögensbeeinträchtigung, Passivvermögen, Aktivvermögen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Kritik an der herrschenden Meinung und ein Fazit.
- Quote paper
- Rechtsanwalt Dr. Gerald Görmer (Author), 2010, Abtretung und Befreiungsanspruch (Freistellungsanspruch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146501