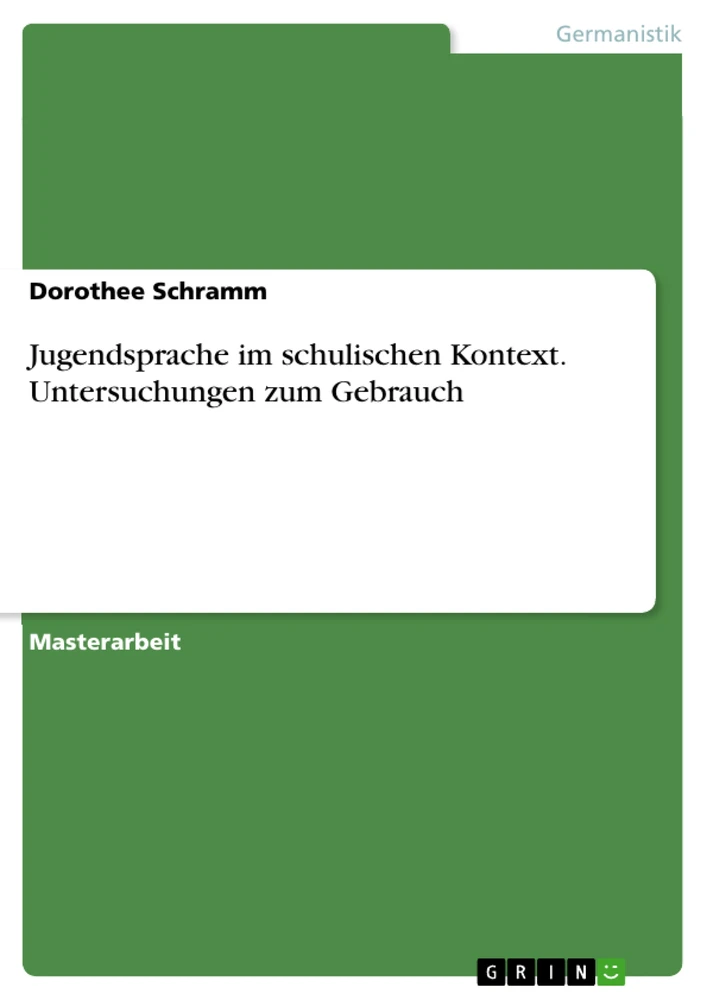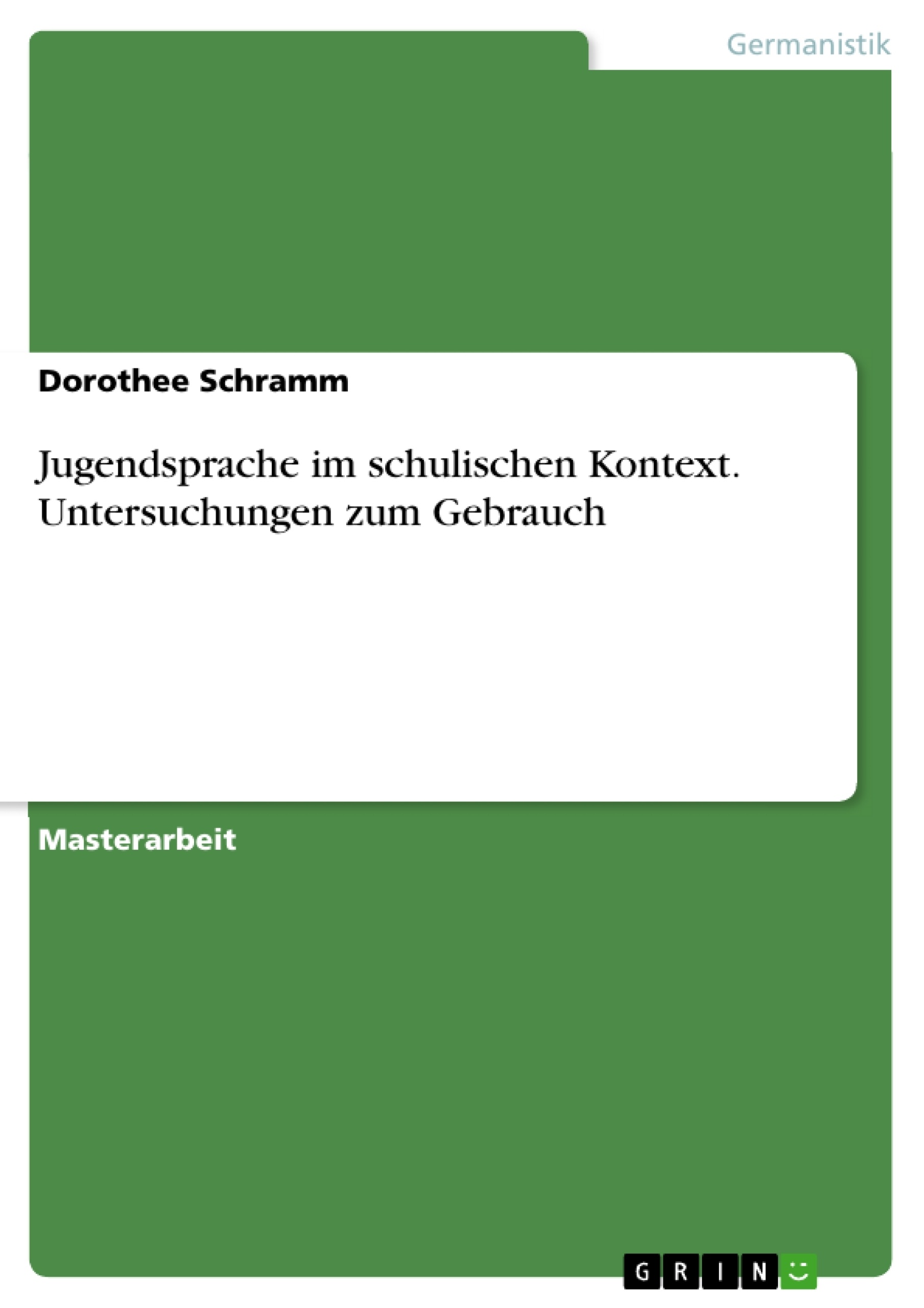Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und inwiefern sich der Gebrauch von Jugendsprache in der Schriftsprache Jugendlicher nachweisen lässt und inwiefern sich dieser Gebrauch hinsichtlich der besuchten Schulform unterscheidet. Die empirische Untersuchung von Schriftproben Jugendlicher liefert darüber hinaus relevante Erkenntnis für die Schulpraxis. Jugendsprache wird sprachwissenschaftlich ausführlich erörtert und in den wissenschaftlichen Kontext eingebettet. Sowohl Schriftsprache- als auch der mündliche Sprachgebrauch werden berücksichtigt.
Der Langenscheidt-Verlag sucht seit 2008 im jährlichen Rhythmus das Jugendwort des Jahres. Die zu diesem Zweck ins Leben gerufene Website des Verlages strotzt vor vermeintlich jugendsprachlichen Wörtern – allerdings wirkt dieser Sprachgebrauch angesichts der erwachsenen Autoren unbeholfen. Sätze wie: "Für das Jugendwort des Jahres 2016 haben wir wie immer naise (sic!) Wort-Einreichungen von euch bekommen" oder "Wir drücken die Daumen für deinen Fav (sic!)!" sollen vermutlich über sprachliche Annäherung an die Zielgruppe ebendiese für das Vorhaben motivieren, ihre Jugendwörter online einzureichen. Für die Jugendwörter kann wiederum "gevotet" werden. Wörter, welche in die engere Wahl gevotet wurden, werden abschließend von einer Jury nach den Kriterien sprachliche Kreativität, Originalität, Verbreitungsgrad und gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse bewertet. Die Jury besteht aus "Jugendliche[n] und Menschen, die sich mit Sprachen beschäftigen". Zu finden sind hier unter anderem eine Lehrerin, die Chefredakteurin der BRAVO, zwei Blogger, ein Polizeikommissar, Redaktionsmitglieder von Schülerzeitungen sowie Journalisten und Sprachwissenschaftler.
Der Verlag hat ebenso ein Buch mit dem Titel "100% Jugendsprache 2016: Das Buch zum Jugendwort des Jahres" veröffentlicht. Das Jugendwort des Jahres "fly sein" wird dort und auf der dazugehörigen Internetseite beschrieben als "etw. oder jmd. geht besonders ab". Gefolgt von den Jugendwörtern "bae", "isso", "Bambusleitung" und "Hopfensmoothie" erhält der erwachsene Leser einen kleinen Einblick in die vermeintlich kreativen und ironischen Ausdrucksweisen heutiger Jugendlicher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgegenstand: die Sprache der Jugend
- Geschichtliche Aspekte deutscher Jugendsprache
- Die Studenten- und Pennälersprache
- Das Halbstarken-Deutsch der 50er Jahre
- Das Twen-Deutsch der 60er Jahre
- Die Studentenbewegung
- Die Sponti-Bewegung der 80er-Jahre
- Jugend und ihre Sprache in der Gegenwart
- Merkmale jugendlichen Sprachstils
- Funktionen von Jugendsprache
- Die Ausdrucksfunktion
- Die Darstellungsfunktion
- Die Appellfunktion
- Die Metasprachliche Funktion
- Die Erforschung der Sprache von Jugendlichen
- Aktuelle Forschungsperspektiven auf Jugendsprache
- Jugendsprache im Kontext der Sozialisation
- Jugendsprache und Gruppenkommunikation
- Jugendsprache in den Medien
- Internationales Vorkommen von Jugendsprache
- Jugendsprache als Sprachkontaktphänomen
- Sprachbewusstsein Jugendlicher
- Spracheinstellungen Jugendlicher
- Soziale Ungleichheit und Jugendsprache
- Jugendsprache und Schriftlichkeit
- Theoretische Konzeptionen von Jugendsprache
- Jugendsprache als Varietät
- Jugendsprache als Soziolekt
- Jugendsprache als Sprechstil
- Jugendsprache als Sondersprache
- Theoretische Modelle von Jugendsprache
- Eindimensionale Modelle
- Mehrdimensionale Modelle von Jugendsprache
- Jugendsprache im Spannungsverhältnis zwischen Nähe- und Distanzkommunikation
- Konzeptionelle Unterschiede zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit
- Jugendsprache im schulische Kontext
- Jugendsprache im Deutschunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und inwiefern sich der Gebrauch von Jugendsprache in der Schriftsprache Jugendlicher nachweisen lässt und sich hinsichtlich der besuchten Bildungsinstitution der Schülerinnen und Schüler unterscheidet. Die Untersuchung analysiert die Schriftproben von SchülerInnen und zielt darauf ab, die Verwendung von Jugendsprache in der Schriftlichkeit zu untersuchen und mögliche Unterschiede in der Häufigkeit des Gebrauchs in verschiedenen Schulformen aufzudecken.
- Der Gebrauch von Jugendsprache in der Schriftsprache Jugendlicher
- Unterschiede in der Verwendung von Jugendsprache in verschiedenen Schulformen
- Die Rolle der Digitalisierung in der Entwicklung von Jugendsprache und deren Auswirkungen auf die Schriftlichkeit
- Das Verhältnis zwischen Jugendsprache, Standardsprache und Bildungssprache
- Didaktische Implikationen der Verwendung von Jugendsprache im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik Jugendsprache einführt und die Forschungsfrage formuliert. Das erste Kapitel widmet sich der Begriffsdefinition von Jugend und Jugendsprache, beleuchtet die Heterogenität des Begriffs und analysiert historische Aspekte des Phänomens. Im zweiten Kapitel werden Merkmale und Kontextbedingungen gegenwärtiger Jugendsprache im Kontext der Freizeitkultur und der Digitalisierung beleuchtet. Das dritte Kapitel beschreibt die Funktionen von Jugendsprache und untersucht deren Ausdrucks-, Darstellungs-, Appell- und metasprachliche Funktion. Kapitel vier behandelt die Erforschung der Sprache von Jugendlichen und diskutiert aktuelle Forschungsperspektiven, theoretische Konzeptionen und Modelle von Jugendsprache. Das fünfte Kapitel betrachtet die konzeptionellen Unterschiede zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, wobei das Modell der Nähe- und Distanzkommunikation nach Koch/Oesterreicher im Kontext von Jugendsprache diskutiert wird. Im sechsten Kapitel wird die besondere Stellung von Jugendsprache im schulischen Kontext beleuchtet. Der empirische Teil der Arbeit untersucht die Verwendung von Jugendsprache in schriftlichen Arbeiten von SchülerInnen verschiedener Schulformen und interpretiert die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage und die im Theorieteil dargestellten Erkenntnisse. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und didaktische Implikationen für den Deutschunterricht diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Thema Jugendsprache und untersucht dessen Bedeutung in der heutigen Zeit. Es werden insbesondere die folgenden Schlüsselwörter und Themen behandelt: Jugendsprache, Standardsprache, Bildungssprache, Sprachwandel, Digitalisierung, Medien, Sprachbewusstsein, Spracheinstellungen, soziale Ungleichheit, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Nähe-Distanz-Modell, Schulsprache, Deutschunterricht, Didaktik.
- Quote paper
- Dorothee Schramm (Author), 2017, Jugendsprache im schulischen Kontext. Untersuchungen zum Gebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1463840