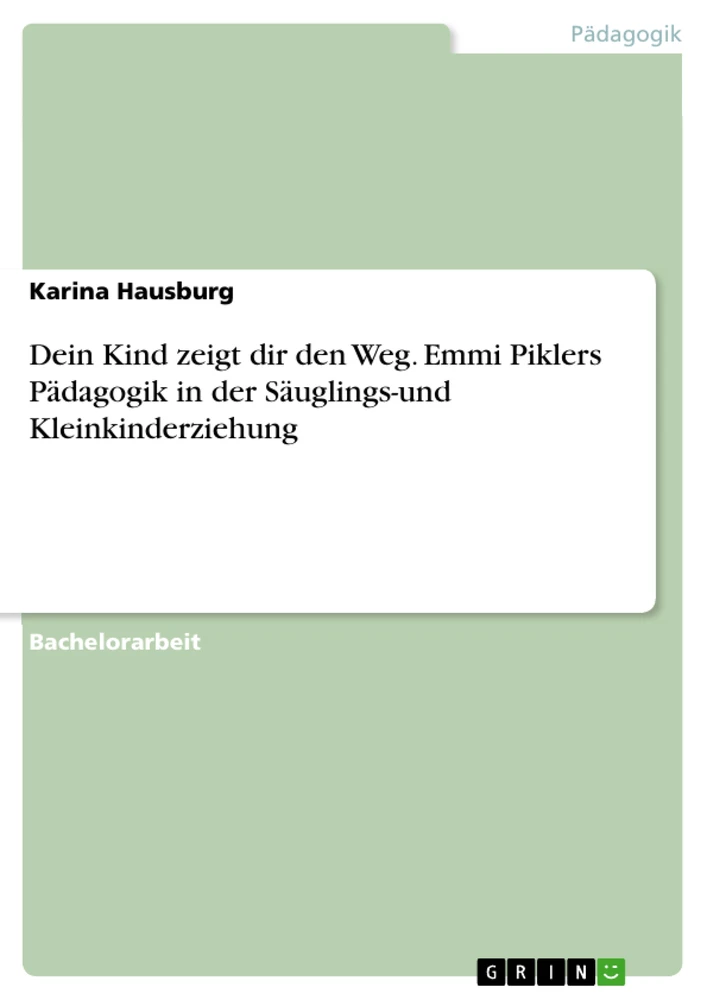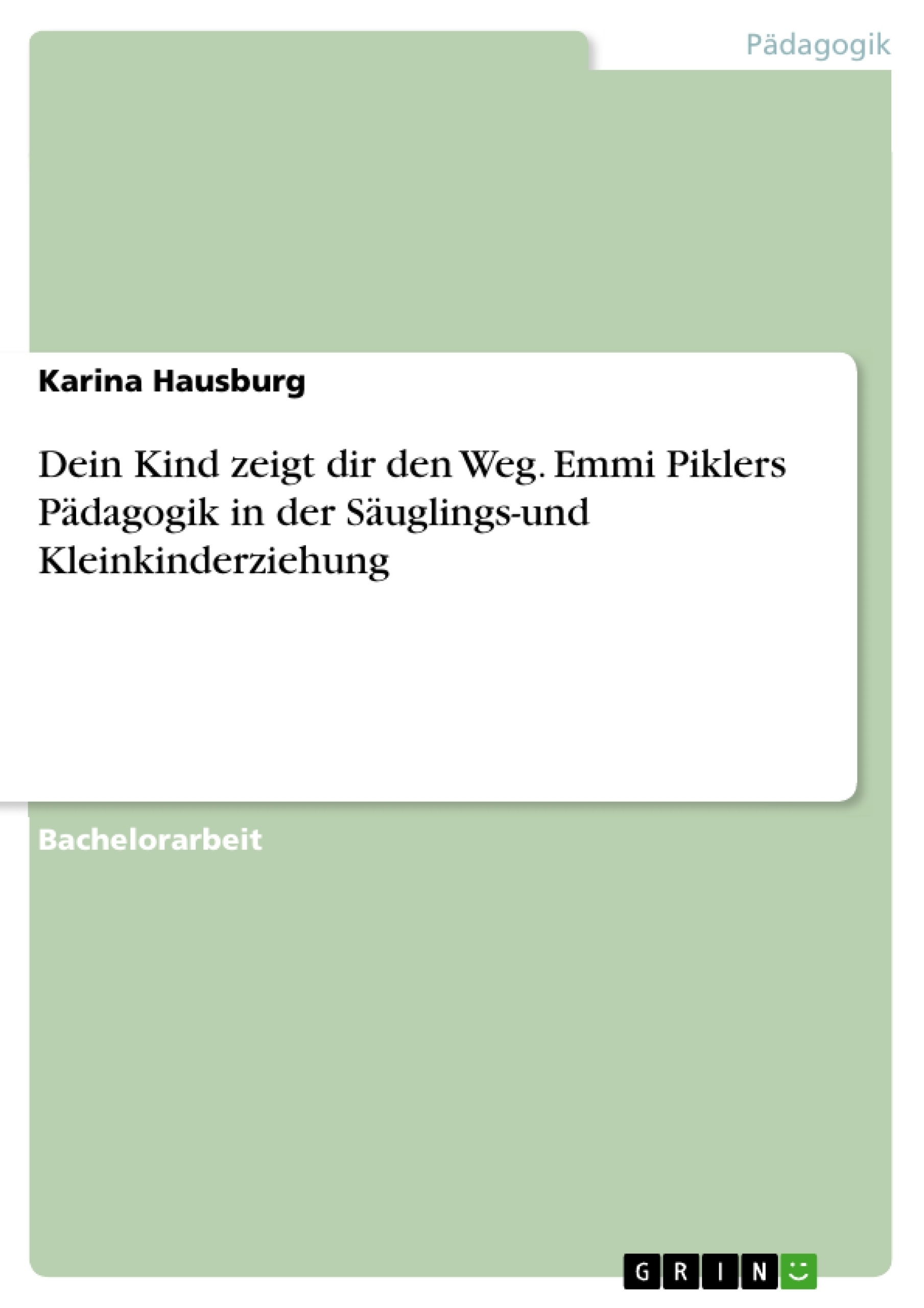Welchen Beitrag kann die pädagogische Vorstellung von Emmi Pikler als bedeutsamer Baustein zur Unterstützung der kindlichen Entwicklung, in der heutigen Säuglings- und Kleinkinderziehung leisten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die vorliegende Bachelorarbeit. Alle Kinder sind soziale Wesen. Auf Grund ihres Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit wollen sie akzeptiert und toleriert werden. Geboren als biologisches Mängelwesen, brauchen Kinder erwachsene Bezugspersonen, um zu überleben und um Menschen zu sein. Grundlage für jegliche Bildungsprozesse von Kindern bildet die Bindung zu den Erwachsenen in ihrer Umgebung. Kindern mit Respekt und Achtung zu begegnen, Zuhören, Interesse an ihrem Tun und Wertschätzung ihrem Spiel und ihrem Lernen gegenüber zu haben, sind Haltungen, die Kinder prägen.
Wie das erste Lebensjahr eines Kindes verläuft, wird von seiner Bezugsperson bestimmt. Dieses erste Jahr wird in der Pädagogik oft vernachlässigt. Emmi Pikler hat sich intensiv damit beschäftigt. Was ein Kind braucht, damit es sich von innen, nach seinem eigenen Bauplan entwickeln kann, fand sie durch ihre Forschung und Beobachtungen heraus. Daraus leitete sie eine bemerkenswerte Theorie ab, die sich auch heute noch, durch ihre besondere Einstellung zur Säuglingserziehung hervorhebt und bemerkenswert ist. Diese hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie von Emmi Pikler, untersucht anhand von Literaturrecherche, Videobeobachtungen und Hospitationen in einer Krippe, die nach der Pädagogik von Emmi Pikler arbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hinführung
- 1.2. Forschungsfrage
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Biographie
- 2.1. Reformpädagogik
- 2.2. Leben und Wirken von Emmi Pikler
- 2.3. Gründung des „Lóczys“
- 2.4. Letzter Lebensabschnitt
- 2.5. Die unmittelbare Prägung Emmi Piklers
- 3. Betreuung der Kinder in den Familien
- 3.1. Kooperation und Dialog
- 3.2. Das Erkennen der Entwicklung des Säuglings
- 3.3. Das soziale Netz
- 4. Die Arbeitsweise im „Lóczy“
- 4.1. Das Personal
- 4.2. Die Kinder
- 4.3. Organisation und Betreuung der Kinder
- 4.4. Die Struktur und die Pflege
- 4.5. Die selbstständigen Aktivitäten der Kinder
- 4.6. Professioneller Beziehungsaufbau
- 4.7. Die besondere Herausforderung- die Vermeidung des Hospitalismus
- 4.8. Das „Lóczy“ heute - Erhalt und Weiterentwicklung des Lebenswerks von Emmi Pikler
- 5. Die Pädagogische Grundhaltung der Pikler Pädagogik und die Möglichkeit der Umsetzung dieser in Pikler orientierten Einrichtungen, Spielräumen und Familien
- 5.1. Das zugrundeliegende Menschenbild
- 5.2. Freie Bewegungsentwicklung
- 5.3. Raumgestaltung nach Emmi Piklers Vorstellung
- 5.3.1. Vorbereitung des Raums
- 5.3.2. Die vorbereitete Umgebung
- 5.3.3. Das Spielgitter
- 5.3.4. Die Beschaffenheit des Bodens
- 5.3.5. Der Pikler-Wickelaufsatz
- 5.4. Das Selbstbestimmte Essen
- 5.5. Selbstständige Aktivität und Selbstregulation
- 5.6. Spiel zum Kennenlernen der Welt
- 5.7. Die Beziehung- intensive Aufmerksamkeit und Empathie
- 5.7.1. Vertrauen in das Kind und seine Kompetenzen
- 5.7.2. Respektvolle und ruhige Kommunikation
- 5.7.3. Pflege und Erziehung als Einheit
- 5.7.4. Die Beobachtung
- 5.8. Die Bedeutung der Gruppengröße und Altersstruktur
- 5.9. Die Betreuung nach Pikler in Krippen oder Kindertagesstätten braucht Mut
- 6. Betrachtung der frühen Kindheit in kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Emmi Pikler
- 6.1. Ergebnisse der Studie
- 6.2. Die Bedeutung des ersten Lebensjahrs für die Entwicklung der Persönlichkeit- der kompetente Säugling
- 6.2.1. Pikler Pädagogik als Gegenstand der Erziehungswissenschaft
- 6.2.2. Betreuung
- 6.2.3. Bildung
- 6.2.4. Entwicklung/ Erziehung
- 6.2.5. Die Ansätze Emmi Piklers als Einflüsse im „sächsischen Bildungsplan“
- 6.3. Die Schwierigkeiten der Erziehung eines kompetenten Kindes in der heutigen modernen Welt
- 7. Schlussfolgerung/Resümee
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der pädagogischen Ansätze Emmi Piklers zur heutigen Säuglings- und Kleinkinderziehung. Ziel ist es, die Aktualität und Relevanz ihrer Theorie zu belegen und ihren Stellenwert in der modernen Pädagogik zu evaluieren. Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche, Videobeobachtungen und Hospitationen in einer Pikler-orientierten Einrichtung.
- Die Biographie und das Lebenswerk von Emmi Pikler
- Die Kernprinzipien der Pikler-Pädagogik (z.B. freie Bewegungsentwicklung, Selbstregulation)
- Die Umsetzung der Pikler-Pädagogik in verschiedenen Kontexten (Familie, Krippe)
- Kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen im Vergleich zu modernen Herausforderungen
- Potenzial und Grenzen der Pikler-Pädagogik in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage vor: Welchen Beitrag kann die pädagogische Vorstellung von Emmi Pikler, als bedeutsamer Baustein zur Unterstützung der kindlichen Entwicklung, in der heutigen Säuglings- und Kleinkinderziehung leisten? Die Autorin beschreibt ihren persönlichen Werdegang und die Motivation, sich mit der Pikler-Pädagogik auseinanderzusetzen, unterstreicht die Relevanz des ersten Lebensjahres für die kindliche Entwicklung und begründet die Wahl des Themas. Die Forschungsfrage wird präzise formuliert und die Hypothesen werden vorgestellt, welche die Aktualität und Relevanz der Pikler-Pädagogik für die heutige Zeit behaupten.
2. Biographie: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben und Wirken von Emmi Pikler, ihre Erfahrungen in der Reformpädagogik und die Gründung des „Lóczy“-Säuglingsheims in Budapest. Es beschreibt ihre Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern, ihre Beobachtungen und die daraus resultierenden pädagogischen Ansätze. Die unmittelbare Prägung Emmi Piklers durch ihre eigene Kindheit und ihr beruflicher Werdegang werden erörtert, um ihre pädagogische Haltung besser zu verstehen. Das Kapitel skizziert die Entwicklung ihres Denkens und die Entstehung ihrer pädagogischen Konzeption.
3. Betreuung der Kinder in den Familien: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Eltern und die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den professionellen Betreuern nach Emmi Piklers Ansatz. Es wird die Wichtigkeit der frühkindlichen Bindung, der Kooperation und des Dialogs zwischen Eltern und Kindern betont. Die Bedeutung des Erkennens der individuellen Entwicklung des Säuglings und das Verständnis des sozialen Netzwerks der Familie als unterstützende Komponente werden ausführlich erklärt. Die zentrale Rolle der Eltern wird hervorgehoben, da sie die wichtigsten Bezugspersonen im Leben des Kindes sind.
4. Die Arbeitsweise im „Lóczy“: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Arbeitsweise im „Lóczy“-Säuglingsheim, das von Emmi Pikler gegründet und geleitet wurde. Es analysiert die Organisation der Betreuung, den Umgang mit den Kindern, die Rolle des Personals und die Bedeutung der vorbereiteten Umgebung. Die selbstständigen Aktivitäten der Kinder, der professionelle Beziehungsaufbau sowie die Vermeidung von Hospitalismus werden als zentrale Aspekte der Pädagogik Piklers dargestellt. Die Weiterentwicklung und der Erhalt des Lebenswerks von Emmi Pikler werden im Kontext des heutigen „Lóczy“ beleuchtet.
5. Die Pädagogische Grundhaltung der Pikler Pädagogik: Dieses Kapitel beschreibt die pädagogische Grundhaltung der Pikler-Pädagogik. Es erklärt das zugrundeliegende Menschenbild, die Bedeutung der freien Bewegungsentwicklung und die Raumgestaltung nach Piklers Vorstellungen. Die Kapitel beschreibt die Bedeutung des selbstbestimmten Essens, der selbstständigen Aktivität und Selbstregulation, des Spiels zum Kennenlernen der Welt und die intensive, respektvolle Beziehung zwischen Erzieher und Kind. Die Rolle der Beobachtung und die Bedeutung der Gruppengröße und Altersstruktur werden ebenfalls thematisiert. Das Kapitel schließt mit der Herausstellung des Mutes, den die Umsetzung der Pikler-Pädagogik in Krippen und Kindertagesstätten erfordert.
6. Betrachtung der frühen Kindheit: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit den Ansätzen von Emmi Pikler auseinander und beleuchtet die Bedeutung des ersten Lebensjahres für die Entwicklung der Persönlichkeit. Es bewertet die Pikler-Pädagogik im Kontext der Erziehungswissenschaft und analysiert die Umsetzung der Pikler-Ansätze im sächsischen Bildungsplan. Schwierigkeiten bei der Erziehung eines kompetenten Kindes in der heutigen modernen Welt werden erörtert. Die Ergebnisse einer Studie werden diskutiert, welche die Relevanz der Pikler-Pädagogik belegen.
Schlüsselwörter
Emmi Pikler, Pikler-Pädagogik, Säuglingserziehung, Kleinkinderziehung, freie Bewegungsentwicklung, Selbstregulation, Selbstständigkeit, Bindung, Beziehungsgestaltung, kompetenter Säugling, vorbereitete Umgebung, Hospitalismus, Respekt, Autonomie, Partizipation, Resilienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Emmi Pikler und ihre Pädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der pädagogischen Ansätze Emmi Piklers zur heutigen Säuglings- und Kleinkinderziehung. Das Ziel ist es, die Aktualität und Relevanz ihrer Theorie zu belegen und ihren Stellenwert in der modernen Pädagogik zu evaluieren.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche, Videobeobachtungen und Hospitationen in einer Pikler-orientierten Einrichtung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Biographie und das Lebenswerk von Emmi Pikler, die Kernprinzipien ihrer Pädagogik (freie Bewegungsentwicklung, Selbstregulation etc.), die Umsetzung in verschiedenen Kontexten (Familie, Krippe), eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen im Vergleich zu modernen Herausforderungen sowie das Potenzial und die Grenzen der Pikler-Pädagogik in der heutigen Zeit.
Wer war Emmi Pikler?
Emmi Pikler war eine bedeutende Pädagogin, die das „Lóczy“-Säuglingsheim in Budapest gründete und leitete. Ihre Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern, ihre Beobachtungen und die daraus resultierenden pädagogischen Ansätze sind Gegenstand dieser Arbeit. Ihre Biographie und ihre Erfahrungen in der Reformpädagogik werden ausführlich behandelt.
Was sind die Kernprinzipien der Pikler-Pädagogik?
Die Kernprinzipien der Pikler-Pädagogik beinhalten die freie Bewegungsentwicklung, die Selbstregulation des Kindes, die Bedeutung der Selbstständigkeit, die intensive und respektvolle Beziehungsgestaltung zwischen Erzieher und Kind, die vorbereitete Umgebung und die Vermeidung von Hospitalismus.
Wie wird die Pikler-Pädagogik in der Praxis umgesetzt?
Die Arbeit beschreibt die Umsetzung der Pikler-Pädagogik in verschiedenen Kontexten, darunter die Betreuung in Familien, in Pikler-orientierten Krippen und Kindertagesstätten. Es wird die Rolle der Eltern, der Erzieher und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen diesen hervorgehoben.
Welche kritischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Emmi Pikler im Vergleich zu den Herausforderungen der modernen Welt. Schwierigkeiten bei der Erziehung eines kompetenten Kindes in der heutigen Zeit werden erörtert und die Ergebnisse einer Studie diskutiert.
Welche Rolle spielt die Beobachtung in der Pikler-Pädagogik?
Die Beobachtung des Kindes spielt eine zentrale Rolle in der Pikler-Pädagogik, um seine individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsschritte zu erkennen und die Betreuung entsprechend anzupassen. Die respektvolle und intensive Aufmerksamkeit gegenüber dem Kind ist essentiell.
Welche Bedeutung hat die vorbereitete Umgebung?
Die vorbereitete Umgebung nach Piklers Vorstellung ist ein wichtiger Aspekt ihrer Pädagogik. Sie soll dem Kind die Möglichkeit geben, seine Selbstständigkeit und seine Bewegungsfreiheit zu entwickeln. Die Gestaltung des Raums, die Auswahl des Spielmaterials und die Beschaffenheit der Umgebung werden detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über den aktuellen Beitrag der Pikler-Pädagogik zur Säuglings- und Kleinkinderziehung und evaluiert ihren Stellenwert in der modernen Pädagogik. Die Ergebnisse der Untersuchung und deren Relevanz werden zusammengefasst.
- Arbeit zitieren
- Karina Hausburg (Autor:in), 2023, Dein Kind zeigt dir den Weg. Emmi Piklers Pädagogik in der Säuglings-und Kleinkinderziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1463763