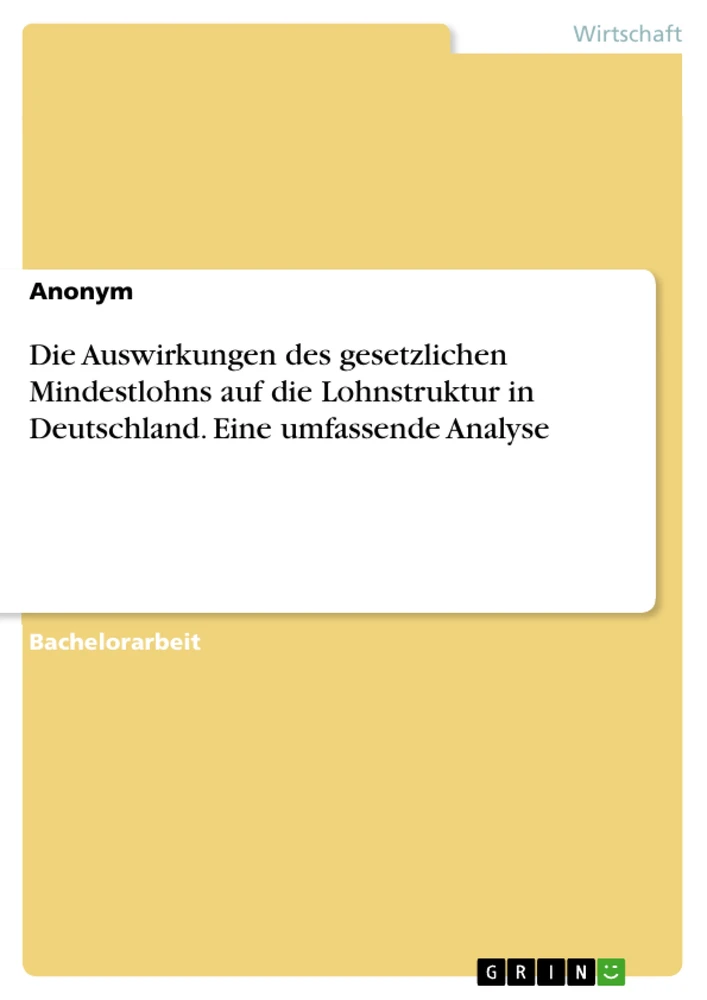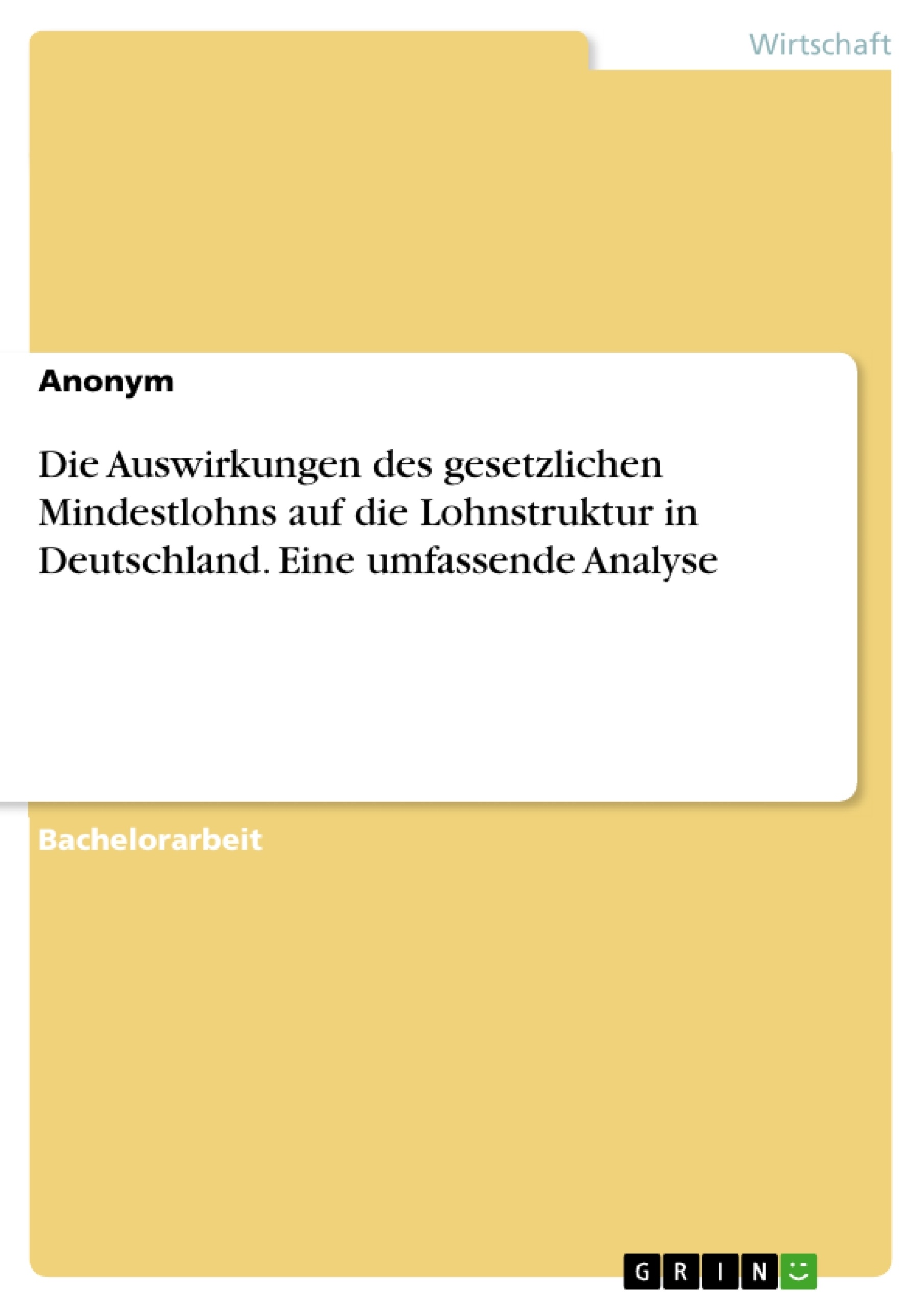Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Lohnstruktur in Deutschland zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die jüngste Anpassung auf 12 Euro pro Stunde. Es wird dabei ein historischer Kontext mit den Ansichten klassischer und moderner Ökonomen verknüpft, um ein umfassendes Verständnis der Relevanz und der Folgen des Mindestlohns zu erlangen.
In dieser Arbeit wird das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) betrachtet, das seit dem 1. Januar 2015 in Deutschland gilt und darauf abzielt, Arbeitnehmer vor unangemessen niedrigen Löhnen zu schützen. Unter Bezugnahme auf Adam Smith und die Vorschläge der Europäischen Kommission wird ein angemessener Mindestlohn diskutiert. Bundeskanzler Olaf Scholz’ Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde und dessen Auswirkungen auf die Lohnstruktur sowie die gesellschaftliche Bedeutung werden ebenfalls analysiert. Der Artikel schließt mit einer Betrachtung der historischen Lohnanpassungen und deren Einfluss auf die Beschäftigten in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland
- 2.1 Entstehung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
- 2.2 Wechselwirkungen zwischen gesetzlichem Mindestlohn und Tariflohn
- 2.3 Kaitz-Index
- 3. Lohnbildung in theoretischen Modellen
- 3.1 Neoklassische Theorie
- 3.2 Der Fall des Monopsons
- 3.3 Keynesianische Theorie
- 4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Lohnstruktur
- 4.1 Auswirkungen auf die Stundenlöhne
- 4.2 Auswirkungen auf die Arbeitszeit und Monatslöhne
- 4.3 Auswirkungen auf die Lohnungleichheit
- 4.3.1 Gender-Pay-Gap
- 4.3.2 Ost-West-Ungleichheit
- 4.3.3 Spillover-Effekte
- 5. Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Lohnstruktur in Deutschland seit seiner Einführung im Jahr 2015. Die Arbeit untersucht dabei die Entstehung des Mindestlohns, die Wechselwirkungen mit Tariflöhnen und die theoretischen Modelle der Lohnbildung. Weiterhin werden die Auswirkungen des Mindestlohns auf die Stundenlöhne, die Arbeitszeit, die Monatslöhne und die Lohnungleichheit analysiert.
- Entstehung und Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
- Wechselwirkungen zwischen gesetzlichem Mindestlohn und Tariflohn
- Theoretische Modelle der Lohnbildung
- Auswirkungen des Mindestlohns auf verschiedene Lohnaspekte
- Auswirkungen des Mindestlohns auf die Lohnungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland und die verschiedenen Debatten, die mit seiner Einführung verbunden waren. Es wird auch auf die Wechselwirkungen zwischen gesetzlichem Mindestlohn und Tariflohn sowie auf den Kaitz-Index eingegangen, der zur Bewertung der Auswirkungen des Mindestlohns verwendet wird.
Kapitel 3 stellt verschiedene theoretische Modelle der Lohnbildung vor, wie die neoklassische Theorie, die Monopson-Theorie und die Keynesianische Theorie. Diese Modelle werden genutzt, um die potenziellen Auswirkungen des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt zu analysieren.
Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Lohnstruktur in Deutschland. Es werden dabei die Auswirkungen auf die Stundenlöhne, die Arbeitszeit und die Monatslöhne sowie die Auswirkungen auf die Lohnungleichheit, insbesondere den Gender-Pay-Gap, die Ost-West-Ungleichheit und Spillover-Effekte, betrachtet.
Schlüsselwörter
Gesetzlicher Mindestlohn, Lohnstruktur, Deutschland, Tariflohn, Lohnbildung, Neoklassische Theorie, Monopson, Keynesianische Theorie, Stundenlöhne, Arbeitszeit, Monatslöhne, Lohnungleichheit, Gender-Pay-Gap, Ost-West-Ungleichheit, Spillover-Effekte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Lohnstruktur in Deutschland. Eine umfassende Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1462340