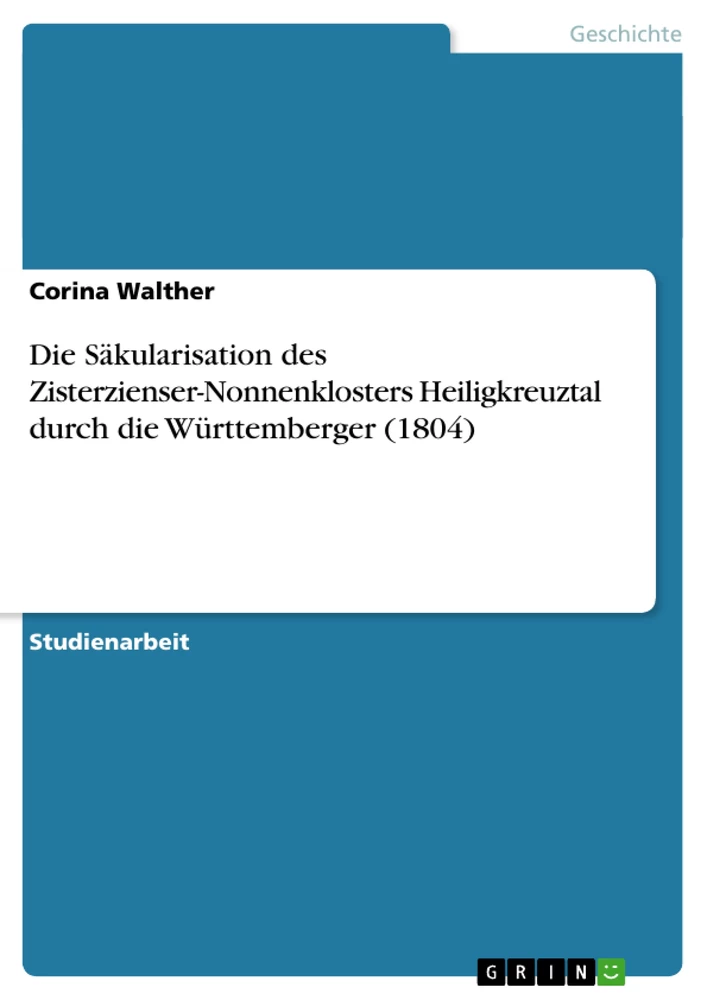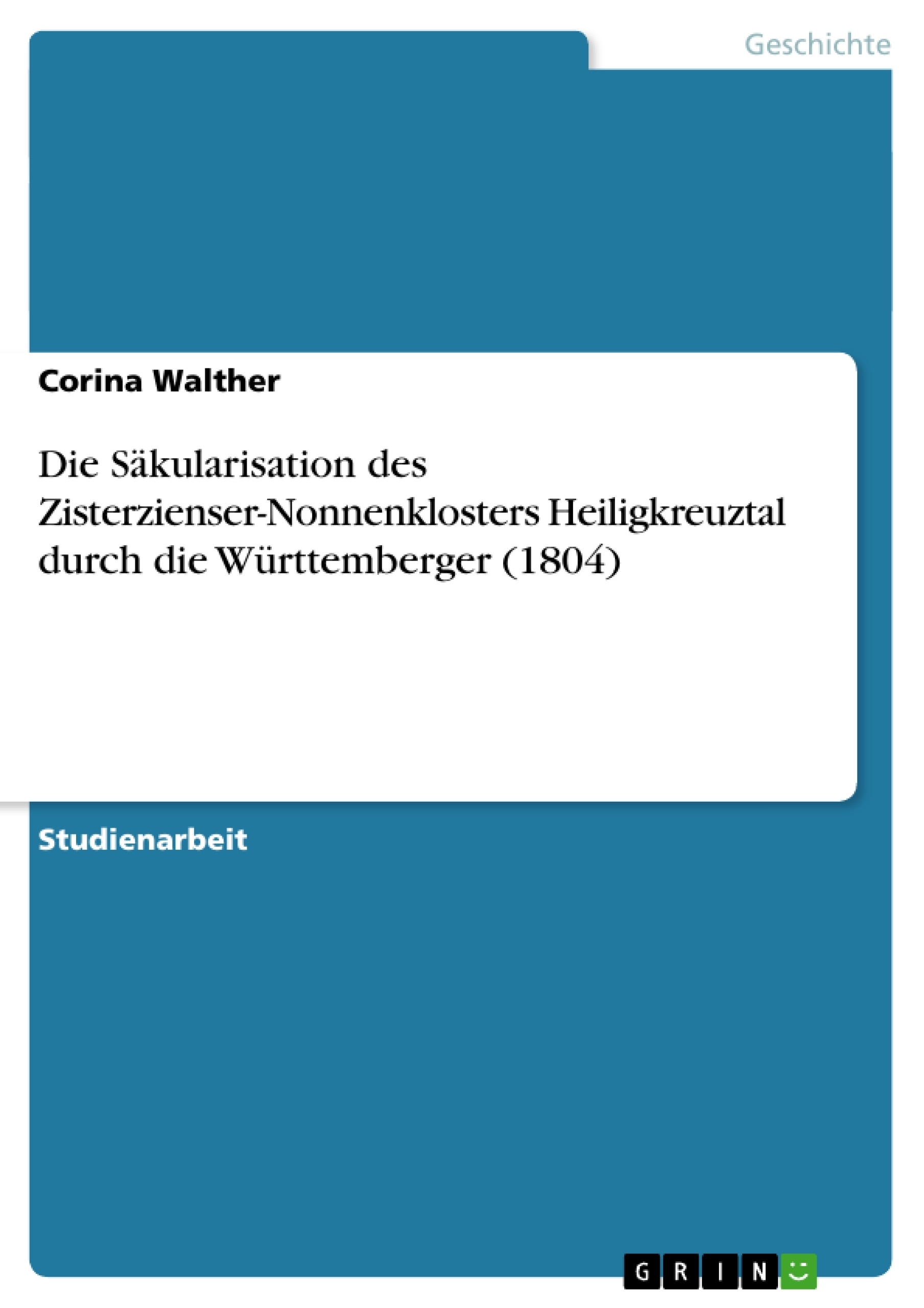Im Gefolge der großen Koalitionskriege mit Frankreich fiel das bis dahin unter österreichischer Landeshoheit stehende Frauenkloster Heiligkreuztal wie viele weitere geistliche Staaten an das Haus Württemberg. Letzteres wollte im Friede von Lunéville für seine linksrheinischen Verluste – insbesondere Mömpelgard – durch Enteignung kirchlicher Güter entschädigt werden. In einer 1931/33 erschienenen Abhandlung über die Säkularisation und die damit verbundene Neuordnung Württembergs läßt sich von einem eher nüchternen Autor folgendes vernichtende Urteil vernehmen: „In keinem anderen deutschen Land zeigte die Säkularisation so gehässige Züge wie in Württemberg. Vieles, was die ultramontanen Autoren anderen Regierungen zu Unrecht vorwerfen, trifft hier zu. Die Pensionen der Klosterinsassen wurden oft auf die Hälfte der RDH-Sätze heruntergedrückt und die in der Regel alt-württembergischen, spricht protestantischen Beamten behandelten Ordensgeistliche wie katholische Bevölkerung häufig arrogant und schikanös.“ Trifft dieses unrühmliche Bild von Württemberg tatsächlich zu?
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Aufhebung Heiligkreuztals als ein Beispiel für die Maßnahmen Württembergs infolge des Reichsdeputationshauptschlusses. Dabei steht der Zeitraum von 1803 bis 1843 im Vordergrund, wobei jedoch auch ein Rückblick über die Vorgeschichte notwendig ist. Zur Säkularisation durch das Haus Württemberg gibt es – abgesehen von einigen Einzeluntersuchungen der bedeutenderen Abteien – nur die verdienstvolle, aber nun bald hundert Jahre zurückliegende Arbeit von Matthias Erzberger. Trotz des noch heute unerlässlichen Wertes dieses Werkes ist zu bemängeln, daß Erzberger seine Quellenstellen nicht immer explizit benennt, und, was noch viel mehr ins Gewicht fällt, daß besonders seine Angaben zu den betreffenden Akten im ehemaligen Staatsarchiv Stuttgart nicht mehr mit der heutigen Ordnung des nunmehrigen Hauptstaatsarchivs übereinstimmen. Einige aktuelle Werke über das Kloster Heiligkreuztal haben sich zwar in separaten Kapiteln dem Thema gewidmet, doch sind auch hier mitunter Mängel in der Dokumentation der Quellenstellen zu beklagen. Deshalb ist es ein weiteres Anliegen der vorliegenden Arbeit, den Beständen des Hauptstaatsarchivs in Hinblick auf die Säkularisation von Heiligkreuztal nachzugehen. Dies kann jedoch aufgrund des gebotenen Umfangs nur in eingeschränktem Maße geschehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heiligkreuztal bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts
- Die Verhandlungen und Beschlüsse der Reichsdeputation
- Die Besitznahme des Klosters und die Schwierigkeiten mit Österreich
- Das Schicksal der Nonnen, der Klostergebäude und des Inventars
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Säkularisation des Zisterzienser-Nonnenklosters Heiligkreuztal durch das Haus Württemberg im Jahr 1804. Sie untersucht den historischen Kontext der Säkularisation im Gefolge der Koalitionskriege und die daraus resultierenden Veränderungen für das Kloster und seine Bewohner.
- Die Auswirkungen der Säkularisation auf Heiligkreuztal und die Lebensbedingungen der Nonnen
- Die Rolle des Hauses Württemberg im Prozess der Säkularisation
- Die rechtlichen und politischen Prozesse, die zur Übertragung des Klosters an Württemberg führten
- Die Auswirkungen der Säkularisation auf die Verwaltung des Klosters und seines Besitzes
- Die Bedeutung der Säkularisation für die Geschichte der Region und des Klosters Heiligkreuztal
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet den historischen Hintergrund der Säkularisation von Heiligkreuztal, die im Zuge der Koalitionskriege erfolgte. Sie stellt den historischen Kontext dar und führt in die Fragestellung der Arbeit ein.
- Das erste Kapitel beschreibt die Geschichte des Klosters Heiligkreuztal bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, inklusive seiner Gründung und Entwicklung als Zisterzienserinnenabtei.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit den Verhandlungen und Beschlüssen der Reichsdeputation im Zusammenhang mit der Säkularisation, welche zur Übertragung des Klosters an Württemberg führten.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Besitznahme des Klosters durch Württemberg und die dabei auftretenden Schwierigkeiten mit Österreich, dem bisherigen Landesherren.
- Das vierte Kapitel behandelt das Schicksal der Nonnen nach der Säkularisation, den Umgang mit dem Klostergebäude und seinen Inventar.
Schlüsselwörter
Säkularisation, Zisterzienser, Heiligkreuztal, Württemberg, Reichsdeputation, Kloster, Nonnen, Geschichte, Besitz, Verwaltung, Rechtsgeschichte, Politik, Historische Kontext.
- Quote paper
- Corina Walther (Author), 2002, Die Säkularisation des Zisterzienser-Nonnenklosters Heiligkreuztal durch die Württemberger (1804), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14618