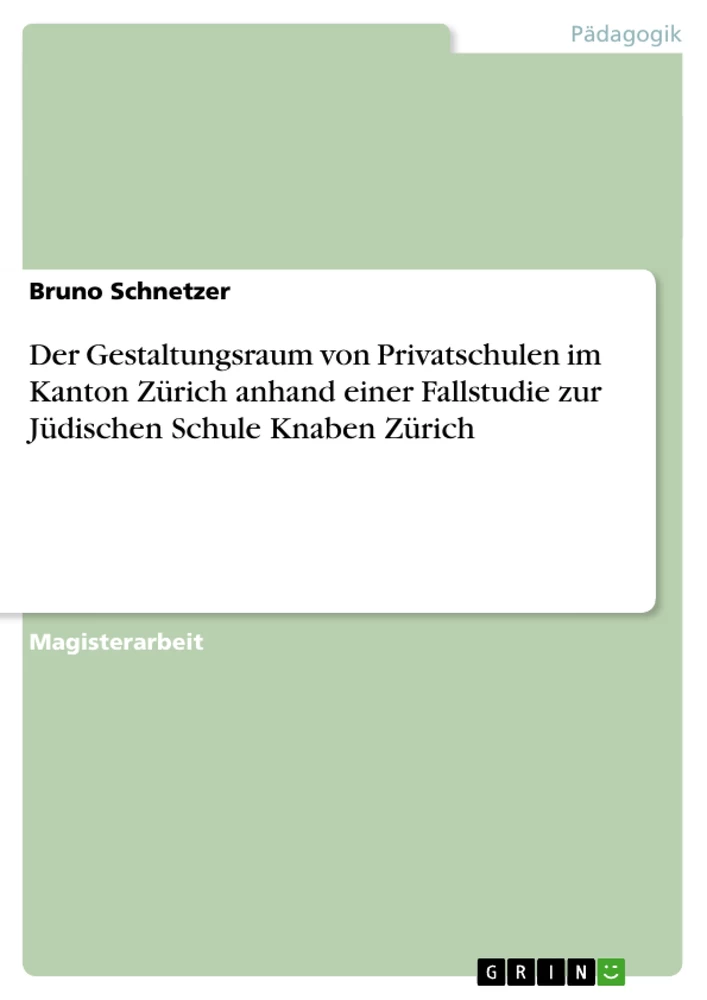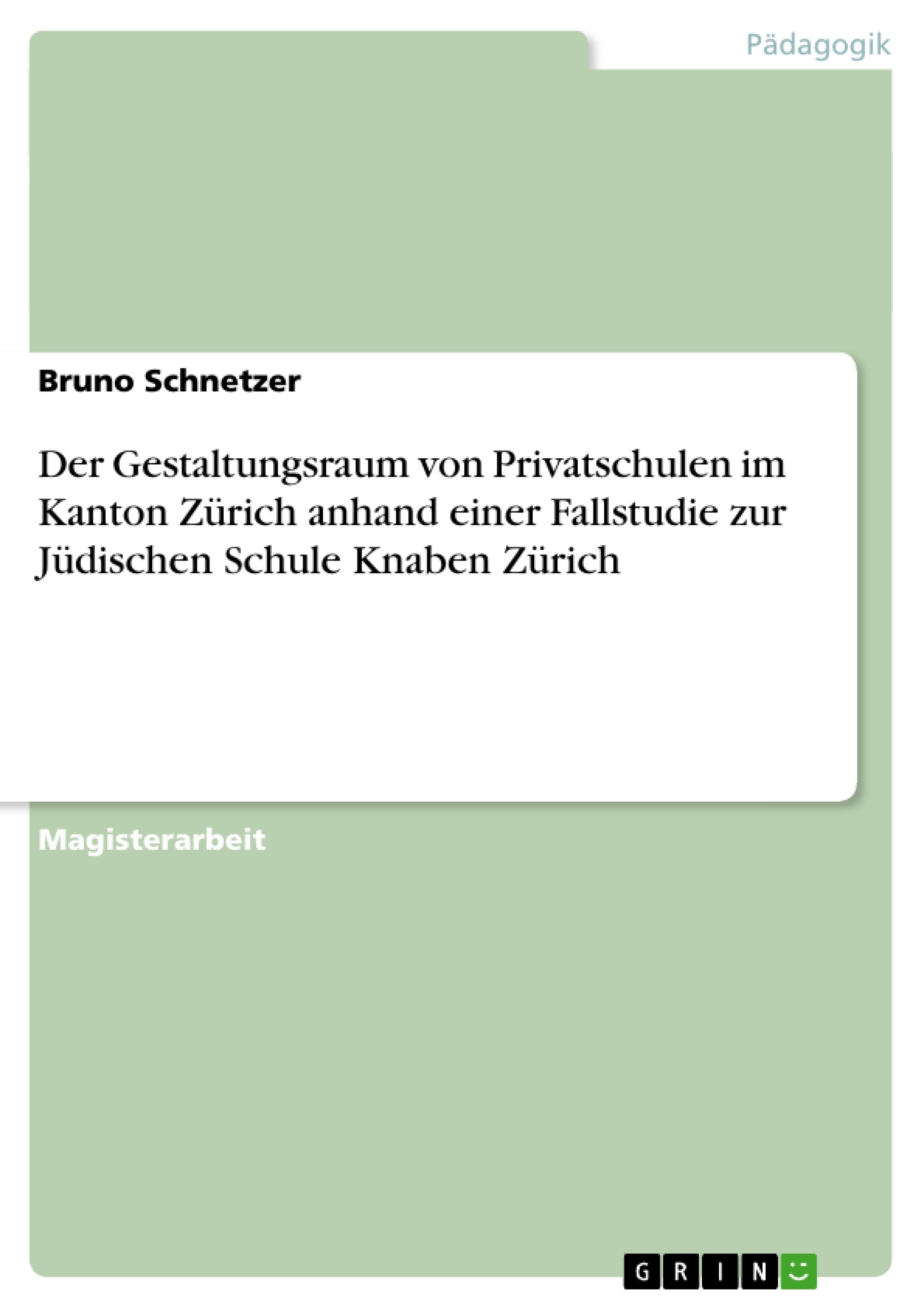Von Zeit zu Zeit geraten die Privatschulen in der Schweiz immer wieder ins Schlaglicht der Öffentlichkeit, insbesondere wenn es um bildungspolitische Entscheide wie Bildungsvielfalt, Bildungsfinanzierung, freie Schulwahl, Chancengleichheit, Integration usw. geht.
Das Mauerblümchendasein der Privatschulen in der Schweiz, nur ungefähr 5 % der schulpflichtigen Kinder besuchen eine Privatschule (vgl. Abschnitt 3.3), wird auch in der geringen Zahl hierzu veröffentlichter wissenschaftlicher Publikationen und Statistiken sichtbar.
Anknüpfend an die Dissertation von Mascello (1995), Elternrecht und Privatschulfreiheit, worin er unter anderem die juristischen Rahmenbedingungen von Privatschulen in der Schweiz analysiert, soll demgegenüber in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, inwieweit diese Rahmenbedingungen von den Zürcher Privatschulen subjektiv als einschränkend empfunden werden und damit deren Gestaltungsraum geklärt werden.
Dazu wurde als Fallbeispiel eine jüdisch-orthodoxe Privatschule ausgewählt, weil diese aufgrund ihrer eigenen kulturellen und religiösen Vorstellungen bzw. Bedürfnisse geeignet ist, die Grenzen des Gestaltungsraumes aufzuzeigen. Nachfolgend wurde eine Zufallsstichprobe (ca. 55 %) aller Zürcher Privatschulen auf Volksschulstufe zu den Ergebnissen der Fallstudie telefonisch befragt.
Diese Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Privatschulen der Volksschulstufe (Primarstufe und Sekundarstufe I), da diese aufgrund des Schulobligatoriums der stärksten Kontrolle unterliegen und auch quantitativ den grössten Anteil ausmachen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Privatschulen
2.2 Gestaltungsraum
2.3 Jüdische Begriffe
3 Der rechtliche Status und die finanzielle Situation der Privat- schulen in der Schweiz
3.1 Der Bund
3.2 Die Kantone
3.3 Statistische Daten
4 Die Rahmenbedingungen für Privatschulen im Kanton Zürich
4.1 Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich (vom 18.04.1869)
4.2 Unterrichtsgesetz (vom 23.12.1859)
4.3 Volksschulgesetz (vom 11.06.1899)
4.4 Volksschulverordnung (vom 31.03.1900)
4.5 Sonstiges
4.6 Bewilligungsvoraussetzungen
4.6.1 Prüfung des Planes
4.6.2 Prüfung der Einrichtung der Anstalt
4.6.3 Prüfung der Ausweise über die Befähigung des Lehrpersonals
4.7 Rechtliche Veränderungen
4.8 Statistische Daten
4.9 Zusammenfassung
5 Methodische Überlegungen
5.1 Bedingungen des Zugangs zur jüdischen Kultur und Schule
5.2 Methodenkonzeption
5.2.1 Problemzentrierte Interviews
5.2.2 Teilnehmende Beobachtung
5.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse
5.2.4 Telefonische Befragung
5.3 Zusammenfassung
6 Das Fallbeispiel: Die Jüdische Schule Knaben Zürich (JSKZ)
6.1 Zur Vorgeschichte
6.1.1 Geschichtlicher Hintergrund
6.1.2 Die erste jüdische Privatschule der Schweiz – die JSZ
6.1.3 Abspaltungen und heutige jüdische Schullandschaft
6.1.4 Zusammenfassung
6.2 Baustruktur und Umgebung
6.2.1 Lage
6.2.2 Das Schulgebäude
6.2.3 Zusammenfassung
6.3 Eckdaten
6.3.1 Schulform und Trägerschaft
6.3.2 Tagesablauf der 1. Sek JSKZ vom Dienstag, dem 04. Februar
6.3.3 Stundenpläne
6.4 Ziele der JSKZ
6.4.1 Die Basislegung zur Erziehung des Menschen
6.4.2 Schonraum bieten
6.4.3 Profunde Erziehung sowohl im Profanen wie im Jüdischen
6.4.4 Religiös geprägte Schulatmosphäre
6.4.5 Zusammenfassung
6.5 Spezifische Ausprägungen der JSKZ
6.5.1 Bereich „Lehrplan, Stundenplan, Stundentafel“
6.5.2 Bereich „Religionsausübung“
6.5.3 Bereich „Einrichtung“
6.5.4 Bereich „Unterricht“
6.5.5 Bereich „Eltern“
6.5.6 Bereich „Sonstiges“
6.5.7 Zusammenfassung
6.6 Jüdische Einschätzung des Gestaltungsraumes
6.6.1 Problemfeld „Kantonale Vorgaben“
6.6.2 Problemfeld „Finanzen“
6.6.3 Problemfeld „Dienste der Volksschule“
6.6.4 Zusammenfassung
7 Zur Verallgemeinerbarkeit des Fallbeispiels
8 Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Öffentliche Unterstützungsleistungen für private Bildungs- einrichtungen
Abb. 2: Auszug aus dem Zürcher Lehrplan (Grobziele) für die Mittelstufe im Bereich Mensch und Umwelt
Abb. 3: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse
Abb. 4: Entwicklung des Schüler- und Lehrerbestandes an der JSZ
Abb. 5: Das Schulgebäude der JSKZ
Abb. 6: Ergebnisse der Kurzbefragung bzgl. Einschränkungen des Gestaltungsraumes von Privatschulen der Volksschulstufe im Kanton Zürich
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Privatschulbesuch der Auszubildenden in der Schweiz nach Schulstufen
Tab. 2: Lektionentafel Mittelstufe nach Zürcher Lehrplan
Tab. 3: Obligatorische und zugelassenen Lehrmittel für die Fächer Physik und Chemie in der Volksschule des Kt. Zürich 20 Tab. 4: Auszubildende in öffentlichen und privaten Schulen 2001 im Kt. Zürich
Tab. 5: Stundenplan der Unterstufe – 2. Klasse JSKZ
Tab. 6: Stundenplan der Mittelstufe – 5. Klasse JSKZ
Tab. 7: Stundenplan der Oberstufe – 8. Klasse (2. Sek) JSKZ
1 Einleitung
Von Zeit zu Zeit geraten die Privatschulen in der Schweiz immer wieder ins Schlaglicht der Öffentlichkeit, insbesondere wenn es um bildungspolitische Entscheide wie Bildungsvielfalt, Bildungsfinanzierung, freie Schulwahl, Chancengleichheit, Integration usw. geht.
Das Mauerblümchendasein der Privatschulen in der Schweiz, nur ungefähr 5 % der schulpflichtigen Kinder besuchen eine Privatschule (vgl. Abschnitt 3.3), wird auch in der geringen Zahl hierzu veröffentlichter wissenschaftlicher Publikationen und Statistiken sichtbar.
Anknüpfend an die Dissertation von Mascello (1995), Elternrecht und Privatschulfreiheit, worin er unter anderem die juristischen Rahmenbedingungen von Privatschulen in der Schweiz analysiert, soll demgegenüber in der vorliegenden Arbeit untersucht werden, inwieweit diese Rahmenbedingungen von den Zürcher Privatschulen subjektiv als einschränkend empfunden werden und damit deren Gestaltungsraum geklärt werden.
Dazu wurde als Fallbeispiel eine jüdisch-orthodoxe Privatschule ausgewählt, weil diese aufgrund ihrer eigenen kulturellen und religiösen Vorstellungen bzw. Bedürfnisse geeignet ist, die Grenzen des Gestaltungsraumes aufzuzeigen. Nachfolgend wurde eine Zufallsstichprobe (ca. 55 %) aller Zürcher Privatschulen auf Volksschulstufe zu den Ergebnissen der Fallstudie telefonisch befragt.
Diese Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Privatschulen der Volksschulstufe (Primarstufe und Sekundarstufe I), da diese aufgrund des Schulobligatoriums der stärksten Kontrolle unterliegen und auch quantitativ den grössten Anteil ausmachen.
Im zweiten Kapitel werden Klärungen zentraler Begriffe, wie Privatschulen, Gestaltungsraum und jüdische Ausdrücke, vorgenommen. Während im dritten Kapitel die rechtlichen Rahmenbedingungen der Privatschulen in den verschiedenen Kantonen behandelt werden, wird im vierten Kapitel diese Untersuchung speziell auf den Kanton Zürich vertieft. Methodische Überlegungen zum Vorgehen der Arbeit finden sich dann im fünften Kapitel. Die Fallstudie zum Gestaltungsspielraum einer jüdisch-orthodoxen Privatschule in Zürich wird im sechsten Kapitel dargelegt. Kapitel sieben befasst sich sodann mit der Verallgemeinerbarkeit des Fallbeispiels und der Präsentation der Ergebnisse einer hierzu durchgeführten Kurzbefragung von Zürcher Privatschulen. Im achten Kapitel runden Schlussbemerkungen die Arbeit ab.
Der vorliegenden Magisterarbeit ist zudem ein Materialband beigefügt, welcher u.a. die vollständigen Interviews und Unterrichtsbilder enthält.
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Privatschulen
In der Folge befasse ich mich näher mit den Privatschulen. Es soll daher zuerst eine Begriffsklärung stattfinden, um den Gegenstandsbereich abzustecken und Schulformen voneinander abzugrenzen.
Nach Plotke (1979, 55) gilt eine Schule historisch gesehen als öffentlich, wenn sie einen öffentlich-rechtlichen Träger (Bund, Kanton, Gemeinde) hat.
„Für die Bestimmung der Trägerschaft entscheidet dabei nicht, wer die Aufwendungen deckt, sondern einzig, wem die Sorge für eine ordnungsgemässe Abwicklung des Betriebs und damit auch die Haftung gegenüber Dritten obliegt“ (ebd., 205).
Privatschulen können negativ ausgedrückt als nicht-öffentliche Schulen bezeichnet werden. Die „Subventionen der öffentlichen Hand verändern den Status einer Schule allein nicht, nämlich dann nicht, wenn die Zuschüsse die Schule nicht verpflichten, Schüler, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, aufzunehmen“ (ebd., 56). Diese Definitionsweise ist aber nicht unbedenklich, da der Umfang der letzeren den Raum für die Privatschule absteckt. Deshalb muss versucht werden diesen Begriff positiv zu umschreiben.
Die Literatur, Heckel/Avenarius (1986, 137), zit. n. Mascello (1995, 15), bezeichnet die Privatschule als „eine von einem privaten Träger aufgrund freier Initiative errichtete und betriebene Schule, die Erziehung und Unterricht in eigener Verantwortung gestaltet und die von Eltern bzw. Schüler frei gewählt werden kann“.
Als staatliche Schulen versteht man die öffentlichen kantonalen Lehranstalten, ohne die Schulen der Gemeinden oder Bezirke. Denn als Staat wird in der Schweiz, im Gegensatz zum Bund, im allgemeinen Sprachgebrauch der Kanton verstanden (vgl. Plotke 1979, 56).
„Wie die geschichtliche Entwicklung zeigt, ist der Einfluss der Kirche auf das Schulwesen stetig zurückgegangen. Sie wird heute im Gegensatz zu den Eltern und den Gemeinwesen nicht einmal mehr als selbständiger Erziehungsträger anerkannt, sondern zählt zu den privatrechtlichen Trägern. Die unmittelbare Mitwirkung der Kirche im öffentlichen Primarunterricht ist auf den Religionsunterricht beschränkt. Die kirchlichen Organe (...) werden nur auf Ermächtigung der Eltern tätig“ (Mascello 1995, 16).
Konfessionelle Schulen gelten somit als Privatschulen.
2.2 Gestaltungsraum
Unter dem Gestaltungsraum einer Privatschule soll hier der Raum verstanden werden, innerhalb dessen die Privatschulleitung entsprechend Freiheiten besitzt eigene Vorstellungen von Schule und Unterricht verwirklichen zu können.
Die Grenzen des Gestaltungsraumes werden dabei durch den rechtlichen Rahmen (Vorgaben, Auflagen, Richtwerte, Empfehlungen, Beiträge, verfügbare Dienste usw.) bzw. sozioökonomische Faktoren (Finanzen, Immobilienpreise, Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Akzeptanz usw.) gesetzt.
Die Grösse des Gestaltungsraumes wird im folgenden daran gemessen, inwieweit eigene Bedürfnisse und Vorstellungen der Privatschulbetreiber, hier konkret der orthodoxen Juden in Zürich, umgesetzt werden können und inwieweit Einschränkungen bzw. Beschränkungen empfunden werden.
2.3 Jüdische Begriffe
In der Folge werden nach De Lange (1984, 226f.) zentrale jüdische Begriffe erläutert, die im Fallbeispiel oft genannt werden, deren eingehende Erklärung im Textverlauf jedoch störend gewirkt hätte:
Mischna: (hebräisch „Lehren durch Wiederholen“). Aufzeichnung der jüdischen Religionsgesetze aus dem ersten und zweiten Jahrhundert.
Orthodoxes Die konservativste der modernistischen Richtungen im Judentum: Judentum.
Talmud: (hebräisch „Lehre“). Nachbiblisches Hauptliteraturwerk des Judentums (in hebräischer und aramäischer Sprache), das aus der Mischna und ihren rabbinischen Kommentaren (Gemara) besteht.
Thora: (hebräisch „Lehre“, „Gesetz“). Im engeren Sinn die fünf Bücher Mose (Pentateuch) bzw. die Schriftrolle, auf die sie für den Gebrauch in der Synagoge geschrieben wurden.
3 Der rechtliche Status und die finanzielle Situation der Privatschulen in der Schweiz
3.1 Der Bund
In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) wird neben Rechtsgleichheit (BV Art. 8), Schutz der Kinder und Jugendlichen (BV Art.11), Glaubens- und Gewissensfreiheit (BV Art. 15) unter anderem als Grundrecht der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (BV Art. 19) genannt.
Kinder und Jugendliche sollen nach ihren Fähigkeiten ausgebildet (BV Art. 41f.) und in ihrer Entwicklung zu selbständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert, sowie in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden (BV Art. 41g).
Im 2. Kapitel über Zuständigkeiten heisst es:
„ Art. 62 Schulwesen
1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kin- dern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. Das Schuljahr beginnt zwischen Mitte August und Mitte September.“
Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen für Stipendien und andere Ausbildungshilfen gewähren sowie unter Wahrung der konkreten Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der Ausbildung ergreifen (BV Art. 66). Aus der Bundesverfassung lässt sich jedoch kein Anspruch auf Subventionierung von Privatschulen ableiten.
Fazit:
Der Bund beauftragt die Kantone eine kostenlose obligatorische Schulbildung für alle zu schaffen. Die übrige Schulgesetzgebung, so unter anderem auch das Privatschulwesen, das in der Bundesverfassung nicht explizit erwähnt wird, überlässt er den Kantonen. Auf Bundesebene besteht somit auch kein Anspruch auf Subventionierung von Privatschulen.
Gemäss dem grundlegenden Prinzip der Wirtschaftsfreiheit (BV Art. 27) gibt die Bundesverfassung jedem das Recht, eine Privatschule zu eröffnen. Solche Schulen unterstehen indessen den geltenden kantonalen Vorschriften (Eröffnungsgenehmigung, Aufsicht usw.). Zudem kann sich eine Privatschule, sofern sie selber religiöse Zwecke verfolgt, auf das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen und eine Verletzung von BV Art. 15 rügen.
3.2 Die Kantone
Der Bund gewährt noch verbietet er private Schulen. Er delegiert die Regelung für das Bildungswesen hauptsächlich an die Kantone ab. Sie regeln das Privatschulwesen und sind zur Kontrolle der Privatschulen verantwortlich. Die Kantone bestimmen die Aufgaben und Befugnisse, die sie den Gemeinden oder Privaten übertragen wollen.
Die Eröffnung einer Privatschule auf Volksschulstufe (1.-9. Klasse) unterliegt in den meisten der 26 Schweizer Kantonen der Bewilligungspflicht (vgl. Mascello 1995, 333ff.). Hierzu gehören die Kantone
Aargau (AG) Appenzell I.Rh. (AI) Basel-Landschaft (BS
Basel-Stadt (BS) Bern (BE) Freiburg (FR)
Genf (GE) Glarus (GL) Jura (JU)
Luzern (LU) Obwalden (OW) Schaffhausen (SH)
Solothurn (SO) St. Gallen (SG) Thurgau (TG) Waadt (VD) Wallis (VS) Zürich (ZH)
In den Kantonen Appenzell A.Rh.(AR), Schwyz (SZ), Tessin (TI), Uri (UR) und Zug (ZG) findet sich auch der Begriff der Anerkennung, der implizit auch von einer Bewilligungpflicht ausgeht.
In den restlichen Kantonen Graubünden (GR), Neuenburg (NE) und Nidwalden (NW) ist nicht explizit von einer Anerkennung oder Bewilligungspflicht die Rede, sondern wird mehr die Aufsicht über die Privatschulen betont.
Die Bewilligung steht insbesondere im Rahmen des Schulobligatoriums im Vordergrund, weil hier ein präventiver Schutz der Kinder (vgl. BV Art. 11 und 19) erforderlich ist.
Die Bewilligungsvoraussetzungen lassen sich grundsätzlich in drei Bereiche aufteilen: Die Anforderungen an den a) Unterricht, b) die Lehrkräfte und den Schulleiter und c) die Schulräumlichkeiten.
a) Anforderungen an den Unterricht
„Die Kantone haben in unterschiedlicher Weise die Anforderungen an das Privatschulwesen definiert: Einige Kantone (BE, AG, AR, BL und OW) stellen an den Privatschulunterricht die gleichen Anforderungen wie an die öffentlichen Schulen, andere (FR, JU, NE, SG, TI, VD, ZH, und ZG) verlangen lediglich einen gleichwertigen Unterricht oder eine gleichwertige Ausbildung, dann finden sich wiederum Kantone (BS, LU, NW, SH, TI und ZG), die das Bildungs- oder Lehrziel der öffentlichen Schulen als Bewilligungsvoraussetzung gewählt haben, und schliesslich verweisen zwei Kantone (SZ und UR) einfach auf die vom Erziehungsrat aufgestellten Anforderungen.“ (Mascello 1995, 159f.).
b) Anforderungen an Lehrkräfte und Schulleiter
Adäquate Vorbildung der Lehrer vorhanden ist und die Schulleitung bei der Einhaltung der Schulpflicht (Absenzenführung und Meldepflicht) mithilft. Allerdings gibt es auch hier kantonal unterschiedliche Anforderungen an die Lehrer von Privatschulen (vgl. ebd., 163f.). In einigen Kantonen werden diese katalogartig aufgeführt; z.B. einen guten Leumund (BS, BE, GE, TI, VD), eine genügend moralische und sittliche Persönlichkeit (BS, LU, VD, VS), gute Kenntnisse und Fähigkeiten (BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, TI, VD, VS, ZH). In den Kantonen Genf und Neuenburg ist hierzu das Schweizer Bürgerrecht erforderlich. Demgegenüber lässt der Kanton Zug den Privatschulen hierbei freie Hand.
c) Anforderungen an die Schulbauten
Die baulichen und sanitarischen Vorschriften für Schulräumlichkeiten (Immissionen, Licht, sanitäre Anlagen usw.) beachtet werden. Die meisten Kantone haben hierzu sehr genaue Vorschriften für den Bau und die Einrichtungen von Schulanlagen erlassen. Die Schullokale der Privatschulen unterliegen dabei denselben Vorschriften wie sie für die übrigen Bauten gelten (Zweckmässigkeit in architektonischer und pädagogischer Hinsicht usw.). Die darüber hinausgehenden Vorschriften für den Schulhausbau gelten formell nur dort, wo sie gesundheitspolizeilich (Sicherheit, Gesundheitspflege bzw. Hygiene) motiviert sind. Dazu zählen insbesondere die Vorschriften in den Kantonen BS, BE, FR, JU, LU, TI, VS und ZH (vgl. ebd., 165).
Um das dauernde Erfüllen der Auflagen, insbesondere des genügenden Unterrichts, sicherzustellen, stehen die Privatschulen unter kantonaler Aufsicht. Sie wird jedoch, im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen, summarischer geregelt und beschränkt sich oft auf Auskünfte (Stundenplan, Lehrmittel usw.), Meldepflicht (Ein- und Austritte von Lehrer/Schüler), Schulbesuche und Sitzungen, so Mascello (1995, 168).
Im Falle von Verletzungen können Sanktionen und Massnahmen bis zur Untersagung des Betriebs oder Entzug der Bewilligung/Anerkennung ergriffen werden. „ Weitere Vorschriften betreffen den Schutz der öffentlichen Ordnung (z.B. Schulumgebung), die Gesundheitspolizei ( neben den Schulgebäuden auch die [zahn]ärztliche Überwachung von Schülern und Lehrern sowie die gesetzlichen Altersvorschriften beim schulpflichtigen Alter) und das Versicherungswesen (Krankheit, Unfall, Pensionskassen)“ (ebd., 165).
Viele Kantone erklären sich bereit Privatschulen finanziell zu unterstützen (vgl. ebd., 173ff.), aber grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Unterstützung. Oft sind diese Verfassungsartikel als Kann-Vorschriften ausgestaltet (AG, BL, GL, SO, TG) oder verweisen weiter auf die Gesetzgebung (JU, NW). Auf der Gesetzes- oder Verordnungsstufe sehen auch andere Kantone Unterstützungen vor (AR, AI, ZG). Oft werden solche Beiträge jedoch nur zugesprochen, wenn bestimmte Voraussetzungen, z.B. öffentliches Bedürfnis, Entlastung der Öffentlichkeit, angemessene Leistung, spezielle finanzielle Situation usw., erfüllt sind (BL, JU, LU, NW, SH, TG, TI , UR, VS, ZH). Der Kanton Jura z.B. richtet die Subventionierung pro Schüler aus und nicht etwa pro Schule. Nur der Kanton St. Gallen gibt die Lehrmittel kostenlos an die Privatschulen ab, was sonst nicht der Fall ist und eine weitere Form der Unterstützung darstellt. Die Kantone Tessin und Uri geben diese nur dann unentgeltlich ab, wenn die Schüler von der Gemeinde zugewiesen werden und im Kanton Zug werden sie nur an Zuger Schüler gratis abgegeben. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in den verschiedenen Kantonen bei der finanziellen Unterstützung privater Volksschulen generell äusserste Zurückhaltung angewandt wird (vgl. Santini-Amgarten, Staatliche Leistungen an Privatschulen, in: NZZ vom 6. Juni 1991, Nr. 128, 83).
Die Eltern werden im allgemeinen finanziell nicht unterstützt. Seit Herbst 2000 gewährt jedoch der Kanton Basel-Landschaft den Eltern von Erst- bis Neuntklässlern, die eine Privatschule besuchen 2000 Fr. Schulbeitrag pro Jahr (vgl. Verordnung über die Ausrichtung von Staatsbeiträgen an die Kosten des Privatschulbesuchs (1.-9. Schuljahr) im Kanton Basel-Landschaft, 2000). Einzig im Kanton Jura gibt es einen Anspruch auf Stipendien für den obligatorischen Unterricht (Mascello 1995, 175f.). Zudem gewährt solche der Kanton Zug bei entsprechenden finanziellen Verhältnissen der Eltern. „Anstelle der direkten Finanzierungshilfe können die Eltern in sechs Kantonen (AI, AR, BE, GL, SG, SH) einen Teil der Ausbildungskosten vom steuerbaren Einkommen abziehen“ (Baumann/Eichenberger 2001, 20).
Fazit:
Die Eröffnung einer Privatschule im Rahmen des Schulobligatoriums unterliegt somit in den meisten Kantonen der Bewilligungspflicht. Die Bewilligungsvoraussetzungen lassen sich in drei Bereiche aufteilen: a) Anforderungen an den Unterricht, b) Anforderungen an Lehrkräfte und Schulleiter und c) Anforderungen an die Schulbauten.
Um das dauernde Erfüllen der Auflagen, insbesondere des genügenden Unterrichts sicherzustellen, stehen die Privatschulen unter kantonaler Aufsicht. Im Falle von Verletzungen können Sanktionen bis zur Untersagung des Betriebs oder Entzug der Bewilligung/Anerkennung ergriffen werden.
Auf Bundes- und Kantonsstufe besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Unterstützung. Die Kantone gewähren nur äusserst zurückhaltend finanzielle Beiträge und diese sind meistens an bestimmte Voraussetzungen (z.B. öffentliches Interesse usw.) geknüpft.
3.3 Statistische Daten
Tab. 1: Privatschulbesuch der Auszubildenden in der Schweiz nach Schulstufen
(Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren: Schweizer Beitrag
für die Datenbank „Eurybase-the Information Database on Education in Europe“,
Stand 01.07.2003, 20f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Öffentliche Unterstützungsleistungen für private Bildungseinrichtungen
(OECD: Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren 2002, Tabelle B4.2, 2002, 206)
Fazit:
Während der obligatorischen Schulzeit (Primarstufe und Sekundarstufe I) besuchen ungefähr 5% der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz eine Privatschule (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 2001, 20).
Im Durchschnitt besuchen in den OECD-Ländern mehr als 10 Prozent der Schüler im Primar-, Sekundar- und post-sekundären, nicht-tertiären Bereich private Bildungseinrichtungen, die überwiegend öffentlich finanziert werden (vgl. OECD 2002, 204). In Belgien und den Niederlanden ist es sogar die Mehrheit der Schüler. In Australien, Frankreich, Korea, Spanien und dem Vereinigten Königreich beträgt der Anteil immer noch 20 Prozent. Demgegenüber liegt die Schweiz mit ungefähr 7 Prozent doch deutlich unter dem OECD-Durchschnitt, wobei dies aufgrund der geringen finanziellen Unterstützung von seiten der öffentlichen Hand (ca. 7 Prozent der für Bildungseinrichtungen vorgesehener öffentlicher Mittel an private Bildungseinrichtungen gehen) nicht überraschend ist. Die Privatschulen in der Schweiz somit überwiegend aus Mitteln der privaten Haushalte finanziert werden und damit den Zugang von Schülern aus einkommensschwachen Familien einschränken.
4 Die Rahmenbedingungen für Privatschulen im Kanton Zürich
Nun soll die Untersuchung speziell auf den Kanton Zürich vertieft werden.
4.1 Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich (vom 18.4.1869)
In der Verfassung des Kantons Zürich (vom 18.4.1869) wird das Privatschulwesen nicht explizit erwähnt.
4.2 Unterrichtsgesetz (vom 23.12.1859)
Das „4. Kapitel: Vom Privatunterricht“ (Gesetzessammlung zur Volksschule 1998, 173f.) des Unterrichtsgesetzes (vom 23.12.1859) liefert dazu erste Anhaltspunkte:
Nach § 270 bedarf es zur „Errichtung aller Arten von Privatinstituten oder Privatschulen (...) einer besonderen Bewilligung des Bildungsrates“. Anstalten, welche dabei an die Stelle der Volksschule treten, sollen entsprechend § 271 „einen der Volksschule entsprechenden Unterricht gewähren“. Dabei stehen diese, so § 272 bzw. § 268, „unter der regelmässigen Aufsicht der Schulbehörden“ und berechtigen den Bildungsrat, bei Kenntnis besonderer Übelstände, privaten Schulanstalten die Fortsetzung des Unterrichts zu untersagen.
„Der Staat kann allgemein zugängliche Einrichtungen zur Aus- und Weiterbildung insbesondere der Schulentlassenen und Erwachsenen fördern.“ (§ 273). Über die Beitragsleistung heisst es unter § 273a:
„Der Staat leistet an die anerkannten Einrichtungen des Bildungswesens Kostenanteile bis zu 80% des anrechenbaren Betriebsaufwandes.
Die Beitragsanerkennung setzt voraus, dass die Einrichtungen einem öffentlichen Interesse dienen, die vom Regierungsrat festzusetzenden Bedingungen und Auflagen erfüllen und dass die Standortgemeinde angemessene Leistungen erbringt.“
4.3 Volksschulgesetz (vom 11.6.1899)
Im „2. Abschnitt: Schulpflicht und Schuljahr“ (ebd., 221) des Volksschulgesetzes (vom 11.6.1899) wird unter § 14 festgehalten, dass die Schulpflicht durch den Besuch einer anderen öffentlichen Schule, einer Privatschule oder durch Privatunterricht erfüllt werden kann. Die Eltern haben der Schulpflege des Wohnortes Anzeige zu erstatten. Nach § 15 überwacht die Schulpflege die Erfüllung der Schulpflicht und sorgt insbesondere dafür, dass schulpflichtige Kinder, die nicht die Volksschule besuchen, einen ihr entsprechenden Unterricht empfangen. Die Schulpflege setzt, entsprechend § 17, die Ferienzeit fest und berücksichtigt die örtlichen Bedürfnisse unter Wahrung der Interessen des Unterrichts.
Im „3. Abschnitt: Primarschule“, Kapitel 5. Schulordnung (Gesetzessammlung zur Volksschule 1998, 225) des Volksschulgesetzes (vom 11.6.1899) heisst es in § 53:
„Der Bildungsrat wird über Zucht und Ordnung in den Schulen, über Einhaltung der gesetzlichen Stundenzahl und des richtigen Masses der häuslichen Aufgaben sowie über das Absenzenwesen Vorschriften erlassen.
Er bestimmt, inwieweit diese Vorschriften auch für Privatschulen Gültigkeit haben.“
4.4 Volksschulverordnung (vom 31.3.1900)
Genauere Ausführungen bezüglich der Privatschulen findet man im „Neunten Abschnitt: Privatschulen und Privatunterricht“ (ebd., 255f.) der Volksschulverordnung (vom 31.3.1900).
Nach § 150 erfordert die Errichtung und Führung von Privatschulen, in denen schulpflichtige Kinder unterrichtet werden, eine Bewilligung des Erziehungsrates. Dabei liegt eine Privatschule vor, „wenn gleichzeitig sechs oder mehr Kinder unterrichtet oder Kinder in mehreren Gruppen von je höchstens fünf Kinder regelmässig zur selben Zeit und am selben Ort unterrichtet werden.“ In § 151 heisst es über die Bewilligung:
„Die Bewilligung des Erziehungsrates wird erteilt, wenn eine genaue Prüfung des Planes, der Einrichtung der Anstalt und der Ausweise über die Befähigung des Lehrpersonals ergeben hat, dass die Schüler einen der Volksschule entsprechenden Unterricht erhalten.“
Alle Privatschulen sind dabei der Aufsicht der Gemeinde- und Bezirksschulpflege unterstellt (§ 152). Dabei erstreckt sich diese nach § 153 auf
„die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften betreffend Ein- und Austritt der Schüler, Handhabung der allgemeinen Absenzenordnung und die sanitarischen Verhältnisse. Im weiteren haben die Schulbehörden darauf zu achten, ob der vom Erziehungsrat genehmigte Lehrplan der Anstalt eingehalten werde, ob die vom Erziehungsrat bewilligten Lehrmittel im Gebrauch stehen, ob der den Schülern erteilte Unterricht in seiner Gesamtleistung demjenigen der allgemeinen Volksschule entspreche."
4.5 Sonstiges
Unter „IV. Besondere Bestimmungen“ (Gesetzessammlung zur Volksschule 1998, 263) der Uebertrittsverordnung (vom 28.10.1997) findet sich § 35:„Privatschulen sind an den letzten Zuteilungsentscheid der Oberstufenschulpflege vor Eintritt der Schülerin oder des Schülers in eine Privatschule gebunden.“
Im Anhang der Uebertrittsordnung (vom 7.12.1983) in „V. Privatschulen“ (ebd., 269) werden die Übertrittsverfahren für Privatschulen geregelt. Dabei wird gemäss § 22 für alle Schüler, die aus Privatschulen in die öffentlichen Schulen übertreten, eine Bewährungszeit angesetzt. Beim Wechsel in eine intellektuell anspruchsvollere Schule der Oberstufe muss eine Prüfung abgelegt werden.
Zudem wird unter 4.3 (ebd., 332f.) der Richtlinien zum Sonderklassenreglement (vom 27.12.1985) die Zulassung von Privatschulen als Sonderschulen im Einzelfall geregelt.
4.6 Bewilligungsvoraussetzungen
Aufgrund des Merkblattes „Bewilligungsverfahren bei Privatschulen“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom November 1999 (s. Materialband, 2) und nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung der Volksschule des Kantons Zürich lassen sich die Bewilligungsvoraussetzungen entsprechend § 151 der Volksschulverordnung (vom 31.3.1900) (vgl. Abschnitt 4.4) wie folgt auffächern.
4.6.1 Prüfung des Planes
a) Entstehungs- und Beweggründe
Nur zur Information der Schulbehörde.
b) Pädagogisches Grundkonzept
Dieses muss aber, aufgrund anderer Weltanschauung (Glaubens- und Gewissensfreiheit), nicht mit dem Zweckartikel der Schule § 1 des Volksschulgesetzes übereinstimmen. Nicht zulässig sind aber von extremistischen, staatsfeindlich indoktrinierenden Vereinigungen geführte Schulen. Die Scientologen z.B. erhielten erst ab 2000 die Bewilligung zur Führung von Privatschulen. Vorher hielten sie Privatunterricht (in Lerngruppen bis zu 5 Schüler/innen). Hierzu gab es auch einen Bundesgerichtsentscheid. Ebenso erhielt der VPM („Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis“) erst nach heftigen Diskussionen in der 2. Hälfte der 90er-Jahre die definitiven Bewilligungen.
c) Organisation der geplanten Schule
Prinzipiell gelten die Vorgaben für die öffentlichen Schulen:
- Lektionentafel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Lektionentafel Mittelstufe
(Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich: Ausgabe 2002, 14)
Für die Lektionentafel der Unter- und Oberstufe siehe Materialband, 4f.. Kleinere Abweichungen hierzu sind möglich. Es wird jedoch auf eine nicht allzu hohe zeitliche Belastung der Schüler geachtet.
- Lehrplan
Die stufenbezogene Lehrzielerreichung (Ende Unterstufe, Ende Mittelstufe und Ende Oberstufe) sollte eingehalten werden. Diese bezieht sich auf die stufenbezogenen Grobziele, die im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (Ausgabe 2002), 21ff. auf die fünf Unterrichtsbereiche (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik und Sport) aufgeführt sind.
Abb. 2: Auszug aus dem Zürcher Lehrplan (Grobziele) für die Mittelstufe im Bereich Mensch und Umwelt (ebd., 71)
Abweichungen unter Respektierung der Glaubens- und Gewissensfreiheit sind möglich. Gemäss Art. 19 der Bundesverfassung hat jedoch jedes Kind den Anspruch auf einen ausreichenden, unentgeltlichen Grundschulunterricht.
- Lehrmittel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für die öffentlichen Schulen gilt das „Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kanton Zürich (Ausgabe August 2001)“. Von den Privatschulen wird erwartet, dass diese im Unterricht zumindest teilweise mitbenutzt werden und damit zur Erreichung des Lehrplans beitragen. Speziellen Privatschulen, wie z.B. Steiner- oder Montessori-Schulen, wird allerdings eine eigenständige, alternative Lehrmittelverwendung zugestanden.
Tab. 3: Obligatorische und zugelassene Lehrmittel für die Fächer Physik und Chemie in der Volksschule des Kt. Zürich (Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kt. ZH, 2001, 5)
- Stundenplan
Diese Gestaltung ist grundsätzlich frei. Es wird jedoch auf eine gleichmässige Verteilung der Lektionen und auf eine nicht allzu hohe zeitliche Belastung der Schüler geachtet. Als Richtschnur dient dabei das Stundenplanreglement (vom 10.12.1991), s. Gesetzessammlung zur Volksschule 1998, 279ff..
- Anzahl Klassen
Frei, nur zur Orientierung der Schulbehörde.
- Klassengrösse
Kein Thema bei der Bewilligung, eventuell jedoch bei der Schulaufsicht, wenn z.B. deshalb ein ordentlicher Unterricht nicht mehr durchgeführt werden kann.
4.6.2 Prüfung der Einrichtung der Anstalt
Für Privatschulen, welche Unterricht für Kinder im volksschulpflichtigen Alter anbieten, gelten sinngemäss die „Anforderungen an Bauten und Anlagen“ (vgl. 4ff.) gemäss Kapitel B. der Schulbaurichtlinien (vom 1.10.1999) der Baudirektion/Bildungsdirektion Kanton Zürich. Es ist jedoch immer abhängig von den Anforderungen. Nicht jede Schule kann sich zum Beispiel eine eigene Turnhalle, Küche oder Werkstatt leisten. Da muss eine Lösung, z.B. Anmieten einer Turnhalle, Projektwochen usw., gefunden werden.
a) Mindestanforderungen an Schulanlagen
- Rauminhalt, -fläche und –höhe
Unterrichtsräume haben eine Bodenfläche von 2,5 m2 und einen Rauminhalt von 6,0 m3 pro Schüler/in aufzuweisen; die lichte Raumhöhe beträgt 3,0 m.
- Belichtung, Raumtiefen
Die Fensterfläche der Unterrichtsräume, gemessen über Tischhöhe (80 cm ab Boden), hat 20 % der Bodenfläche zu betragen. Maximale Raumtiefe bei einseitiger Beleuchtung für Unterrichtsräume: 7,5 m (inkl. Schränke). Bei grösseren Raumtiefen sind zusätzliche natürliche Lichtquellen anzuordnen.
- Massnahmen für Behinderte
Es soll die Zugänglichkeit für Behinderte entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet werden.
b) Grundsätze für Planung und Ausführung
Schulhausanlagen und Heime sind in einfacher, solider, dem Orts- und Landschaftsbild angepasster Bauart auszuführen. Standortwahl unter Berücksichtigung der Richtplanung, insbesondere ist der Sicherheit der Kinder (Schulweg, geringe Lärmbelastung, abgas- und staubfreie Umgebung) besondere Beachtung zu schenken. Ferner sollten die Schulhausanlagen vielfältig genutzt werden können und unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Energieverbrauchsminimierung konzipiert werden.
c) Richtraumflächen für Anlagen der Volksschule
Für Neubauten gelten diese (s. Materialband, 6) als Richtmasse; sie sollen nicht mehr als +/- 10 % unter- oder überschritten werden; in begründeten Fällen, insbesondere bei bestehenden Bauten, Liegenschaftserwerb etc. sind Ausnahmen möglich.
d) Zuständigkeit
Zuständig für „schulische“ Belange, insbesondere für Bedarfsfragen (Raumbedarf), ist die Bildungsdirektion mit den entsprechenden Ämtern. Die Baudirektion, im speziellen das Hochbauamt, ist für die „baulichen“ Belange (Planung, Projektierung) und die Beiträge an die Bauvorhaben zuständig.
4.6.3 Prüfung der Ausweise über die Befähigung des Lehrpersonals
Gemäss Beschluss des Erziehungsrates über den Befähigungsausweis der Lehrkräfte an Privatschulen (vom 25.6.1974) (Gesetzessammlung zur Volksschule 1993, 353) ist eine Ausbildung erforderlich, die im wesentlichen den zürcherischen kantonalen Vorschriften entspricht. Einer allzu restriktiven Handhabung dieses Aspekts stände sonst auch die Handels- und Gewerbefreiheit entgegen.
4.7 Rechtliche Veränderungen
Am 24. November 2002 hat das Zürcher Stimmvolk das Volksschulgesetz vom 1.7.2002 abgelehnt und das Bildungsgesetz vom 1.7.2002 angenommen. Dadurch kann die langjährig vorbereitete Zürcher Schulreform nur partiell durchgeführt werden und gerät ins Stocken.
Mit dem Inkrafttreten des Bildungsgesetzes vom 1.7.2002 ist erst um 2004/2005 zu rechnen und werden dabei folgende Erlasse aufgehoben:
a) das Unterrichtsgesetz vom 23.12.1859,
b) das Gesetz über Schulversuche vom 7.9.1975.
Durch das alleinige Inkrafttreten des Bildungsgesetzes vom 1.7.2002 werden jedoch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Privatschulen nicht tangiert.
4.8 Statistische Daten
Tab. 4: Auszubildende in öffentlichen und privaten Schulen 2001 im Kanton Zürich
(Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2002): Die Schulen im Kanton Zürich 2001/2002, 4)
Hinweis: Die ursprünglich separat aufgeführten Privatschulen mit alternativem Lehrplan
wurden nun dank der Abteilung Bildungsstatistik den verschiedenen Schulstufen zugeordnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.9 Zusammenfassung
Entsprechend dem § 14 des Volksschulgesetzes kann die Schulpflicht auch durch den Besuch einer Privatschule erfüllt werden. Die Errichtung von Privatschulen, in denen schulpflichtige Kinder unterrichtet werden, bedürfen dabei (gemäss § 270 des Unterrichtsgesetzes bzw. § 150 der Volksschulverordnung) einer Bewilligung des Erziehungsrates. Diese Bewilligung wird erteilt, wenn eine genaue Prüfung des Planes (Lektionentafel, Lehrplan, Lehrmittel), der Einrichtung der Anstalt (Schulbaurichtlinien) und der Ausweise über die Befähigung des Lehrpersonals (die im wesentlichen den zürcherischen kantonalen Vorschriften entspricht) ergeben hat, dass die Schüler einen der Volksschule entsprechenden Unterricht erhalten (§ 151 der Volksschulverordnung) und den Bildungsrat, bei Kenntnis besonderer Übelstände, berechtigt Privatschulen die Fortsetzung des Unterrichts zu untersagen (§ 272 des Unterrichtsgesetzes). Der Staat kann, nach § 273a des Unterrichtsgesetzes, Kostenanteile bis zu 80% des anrechenbaren Betriebsaufwandes der anerkannten Einrichtungen leisten, wenn bestimmte Voraussetzungen (öffentliches Interesse, Auflagen des Regierungsrates und angemessene Leistungen der Standortgemeinde) erfüllt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Seite?
Diese Seite enthält eine umfassende Inhaltsvorschau, einschliesslich Titeln, Inhaltsverzeichnis, Zielen und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern. Der Schwerpunkt liegt auf Privatschulen in der Schweiz, insbesondere im Kanton Zürich, unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen und methodischer Überlegungen.
Was sind Privatschulen im Kontext dieses Dokuments?
Privatschulen werden als nicht-öffentliche Schulen definiert, die von privaten Trägern gegründet und betrieben werden. Sie gestalten Erziehung und Unterricht in eigener Verantwortung und können von Eltern bzw. Schülern frei gewählt werden.
Was versteht man unter Gestaltungsraum einer Privatschule?
Der Gestaltungsraum bezieht sich auf den Spielraum, innerhalb dessen die Privatschulleitung Freiheiten besitzt, eigene Vorstellungen von Schule und Unterricht zu verwirklichen. Die Grenzen werden durch den rechtlichen Rahmen und sozioökonomische Faktoren gesetzt.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten für Privatschulen in der Schweiz?
Die Kantone sind für das Schulwesen zuständig. Die Eröffnung einer Privatschule auf Volksschulstufe (1.-9. Klasse) unterliegt in den meisten Kantonen der Bewilligungspflicht. Es gibt Anforderungen an den Unterricht, die Lehrkräfte/Schulleiter und die Schulräumlichkeiten. Eine finanzielle Unterstützung durch Bund oder Kantone besteht grundsätzlich nicht.
Welche Rolle spielt der Bund im Privatschulwesen?
Der Bund beauftragt die Kantone, eine kostenlose obligatorische Schulbildung für alle zu schaffen. Die Regelung des Privatschulwesens wird den Kantonen überlassen. Auf Bundesebene besteht kein Anspruch auf Subventionierung von Privatschulen.
Welche Bewilligungsvoraussetzungen gibt es für Privatschulen im Kanton Zürich?
Die Bewilligung wird erteilt, wenn eine genaue Prüfung des Planes (Lektionentafel, Lehrplan, Lehrmittel), der Einrichtung der Anstalt (Schulbaurichtlinien) und der Ausweise über die Befähigung des Lehrpersonals ergeben hat, dass die Schüler einen der Volksschule entsprechenden Unterricht erhalten.
Wie werden Privatschulen im Kanton Zürich beaufsichtigt?
Alle Privatschulen sind der Aufsicht der Gemeinde- und Bezirksschulpflege unterstellt. Diese erstreckt sich auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften betreffend Ein- und Austritt der Schüler, Handhabung der allgemeinen Absenzenordnung und die sanitarischen Verhältnisse. Zudem wird geprüft, ob der genehmigte Lehrplan eingehalten wird und ob der Unterricht dem der Volksschule entspricht.
Welche statistischen Daten werden zu Privatschulen erwähnt?
Während der obligatorischen Schulzeit besuchen ungefähr 5% der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz eine Privatschule. Im Kanton Zürich besuchten im Jahr 2001 5,5 % der schulpflichtigen Kinder eine Privatschule.
Welche jüdischen Begriffe werden im Dokument erläutert?
Es werden die Begriffe Mischna, Orthodoxes Judentum, Talmud und Thora erläutert.
Welche Gesetze werden im Bezug auf Privatschulen im Kanton Zürich erwähnt?
Es werden die Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich, das Unterrichtsgesetz, das Volksschulgesetz und die Volksschulverordnung erwähnt, sowie die dazugehörigen Paragraphen.
- Quote paper
- Bruno Schnetzer (Author), 2003, Der Gestaltungsraum von Privatschulen im Kanton Zürich anhand einer Fallstudie zur Jüdischen Schule Knaben Zürich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146159