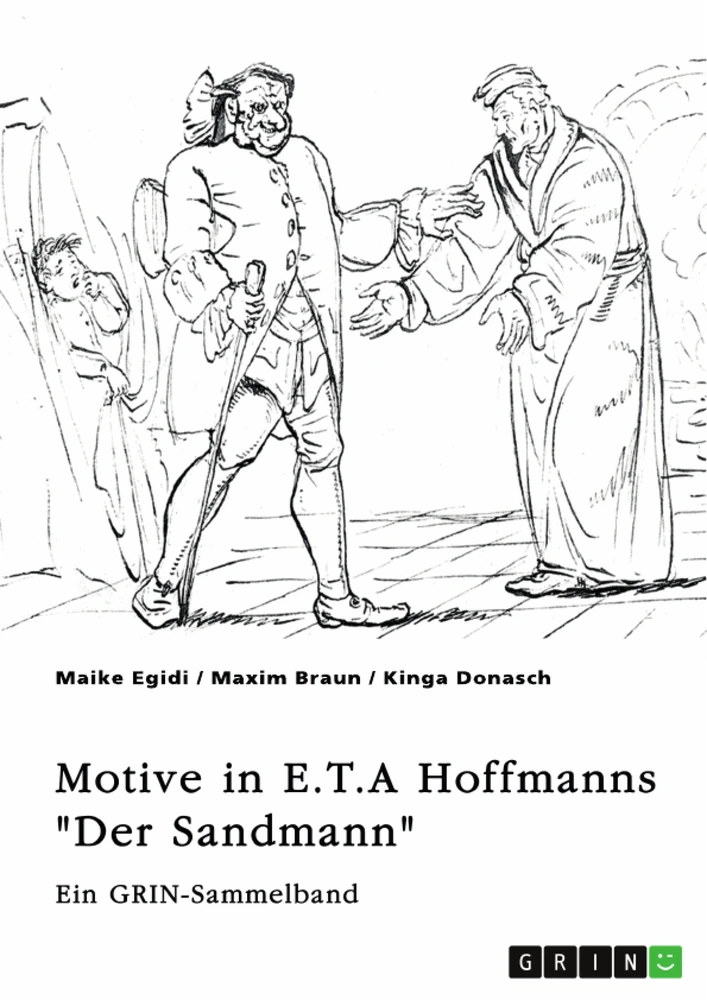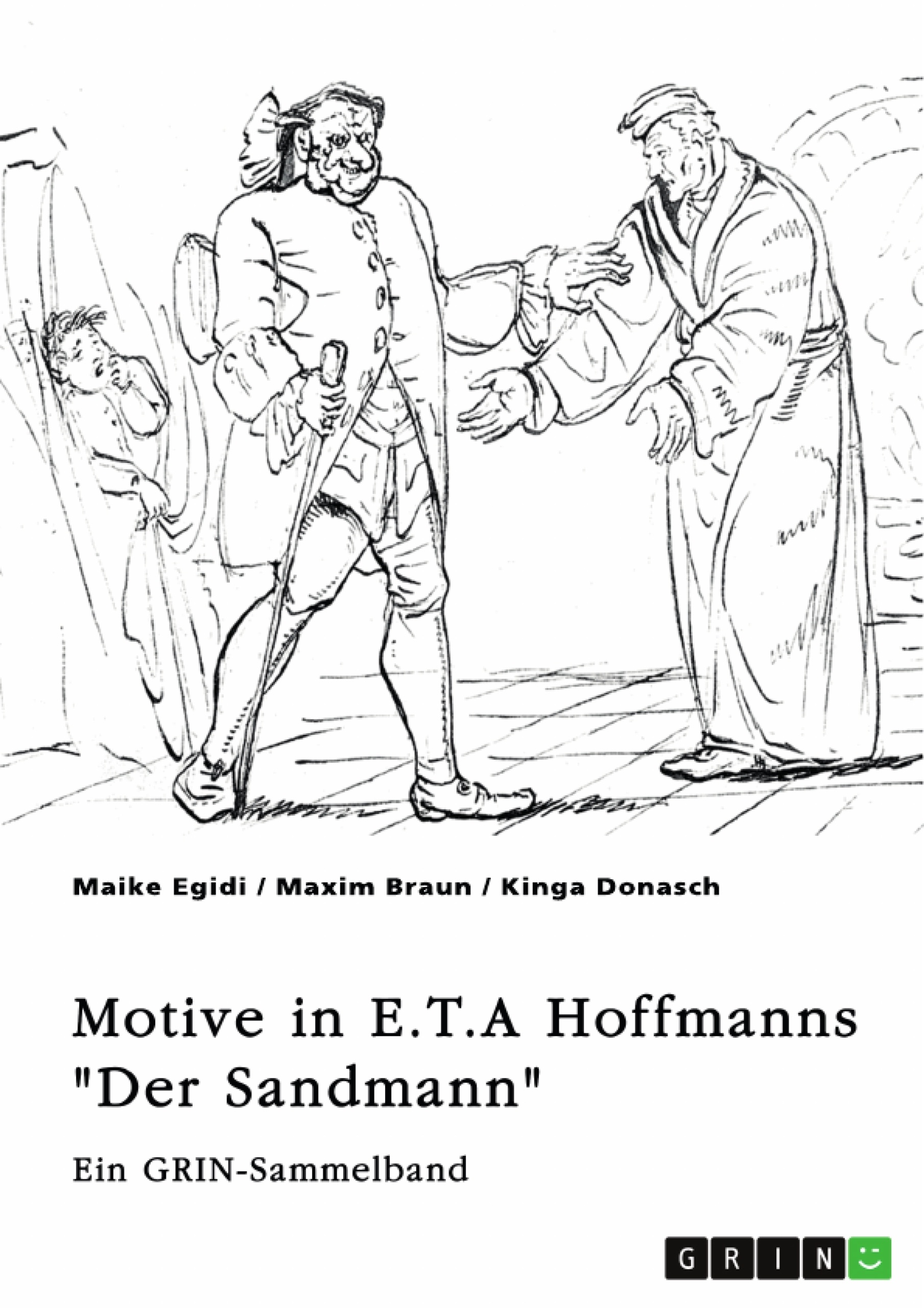Dieser Sammelband enthält vier Hausarbeiten.
Die erste Arbeit setzt sich mit den Aspekten der Erzählgestaltung in der Novelle auseinander und betrachtet, wie diese eingesetzt werden, um die Wahrnehmung des Lesers zu steuern und zu beeinflussen. Dabei wird zentral gesetzt, wie einerseits Nathanaels Wahrnehmungen wiedergegeben werden und wie der Leser in seiner Wahrnehmung von Nathanaels Wahrnehmung gelenkt wird. Es soll geklärt werden, inwiefern die angewandten Erzählstrategien die fiktionale Realität verzerren und den Eindruck des Wahnsinns evozieren.
Die zweite Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, was den "Sandmann" von E.T.A. Hoffmann dunkel und unheimlich macht. Dabei wird sowohl auf die epochentypische Unheimlichkeit als auch die inhaltliche Verunsicherung eingegangen. Wodurch wird Unwohlsein und Unbehagen verursacht? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, betrachten wir zunächst die Begrifflichkeit selbst.
Anhand des Pygmalion-Mythos, auf der Basis des Textes aus den Metamorphosen von Ovid, und zwei romantischen Texten aus unterschiedlichen literarischen Kontexten – "Der Sandmann" von E.T.A. Hoffmann und "Ligeia" von Edgar Allan Poe – soll im dritten Text die romantische Aktualisierung des Pygmalion-Stoffes, mit speziellem Fokus auf das Motiv der Augen, verdeutlicht werden. Des Weiteren gilt es herauszuarbeiten, wie der Mythos in den Erzählungen verwendet und verändert wird, und was aus ihm entsteht.
Im Rahmen der vierten Hausarbeit wird die Forschungsfrage beantwortet, inwiefern sich das Frauenbild, welches durch Clara und Olimpia in "Der Sandmann" vermittelt wird, unterscheidet. Aufgrund der Tatsache, dass in der Epoche der Romantik zwei Frauenbilder gegenwärtig waren, beinhaltet diese Hausarbeit eine Analyse der Frauenfiguren der Erzählung. Es wird prognostiziert, dass die Frauenfiguren Clara und Olimpia ein konträres Frauenbild vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Wahrnehmungssteuerung in "Der Sandmann". Erzählstrategien
- Einleitung
- Rezeptionsästhetik und ihre Bedeutung für die Betrachtung des Sandmanns
- Erzähltechniken im Sandmann
- Die Textstrukturierung
- Die Erzählhaltung
- Wahn oder fiktionale Realität?
- Fazit
- Das Unheimliche in "Der Sandmann" von E.T.A Hoffmann
- Einführung
- Epochentypische Unheimlichkeit und die Strukturelle Ambivalenzen im Textaufbau
- Inhaltliche Verunsicherung: Das Unheimliche im Text und zwischen den Zeilen
- Schluss
- Das Pygmalion-Motiv in Hoffmanns "Der Sandmann" und Poes "Ligeia". Die Augen als Spiegel oder Abgrund
- Der Mythos heute und in der Literatur der Romantik
- Ovids Pygmalion-Mythos und seine Grundmotive
- Konzepte romantischer Künstlerfiguren
- Der Sandmann – Ein vielseitiges Nachtstück
- Der Pygmalion-Mythos in der Verlebendigung der Automate
- Die Augen als Spiegel der Seele
- Der Künstler zwischen Innen und Außen
- Ligeia - Tod und Wiederauferstehung der schönen Frau
- Der Pygmalion-Mythos in der Wiederbelebung von den Toten
- Die Augen der Frau als Abgrund
- Der Künstler als Verdammter
- Fazit - Zwei pessimistische Künstlerbilder
- Die Frauenfiguren Clara und Olimpia in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann". Das Frauenbild im 19. Jahrhundert
- Einleitung
- Zwischen Frauenemanzipation und traditionellem Frauenbild im 19. Jahrhundert
- Die Frauenfiguren in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann
- Clara
- Olimpia
- Traditionelles oder emanzipatorisches Frauenbild?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" und untersucht die erzählerischen Mittel, die der Autor einsetzt, um die Wahrnehmung des Lesers zu steuern. Sie beleuchtet die Rezeptionsästhetik, die in der Novelle eine zentrale Rolle spielt, und analysiert die verwendeten Erzähltechniken, um die Auswirkungen auf die Interpretation des Textes aufzuzeigen.
- Die Rolle der Erzählstrategien in der Steuerung der Leserwahrnehmung
- Die Darstellung von Nathanaels Wahrnehmung und deren Einfluss auf die Leserinterpretation
- Die Verschmelzung von Schauermotiven und romantischen Elementen in der Novelle
- Die Verbindung von Realismus und Phantastik im Text und ihre Wirkung auf die Rezeption
- Die Rezeptionsästhetik als Schlüssel zum Verständnis der Interpretationsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit den Erzählstrategien in "Der Sandmann", indem er die Rezeptionsästhetik als Grundlage für die Analyse der Wahrnehmungssteuerung durch den Text beleuchtet. Die Analyse der Erzähltechniken, darunter Textstrukturierung, Erzählhaltung und die Frage nach Wahn oder Realität, zeigt auf, wie Hoffmann die Wahrnehmung des Lesers beeinflusst und die Grenzen zwischen fiktionaler Welt und Wahn verschwimmen lässt.
Das zweite Kapitel untersucht das Unheimliche in "Der Sandmann" und beleuchtet die epochentypische Unheimlichkeit, die im Textaufbau angelegt ist. Die inhaltliche Verunsicherung durch das Unheimliche im Text und zwischen den Zeilen wird analysiert und unterstreicht die Spannung zwischen Realismus und fantastischen Elementen.
Im dritten Teil wird das Pygmalion-Motiv in "Der Sandmann" und in Edgars Allan Poes "Ligeia" untersucht. Der Mythos wird im Kontext der romantischen Künstlerfigur analysiert, wobei der Fokus auf die Verlebendigung der Automate, die symbolische Bedeutung der Augen und die Spannungen zwischen Innen- und Außenwelt liegt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Frauenfiguren Clara und Olimpia in "Der Sandmann" und setzt diese in Bezug zum Frauenbild im 19. Jahrhundert. Die Analyse der Frauenemanzipation im Kontext des traditionellen Frauenbildes untersucht die Rolle von Clara und Olimpia als Verkörperungen unterschiedlicher Frauenbilder in der Novelle.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Erzählstrategien, Wahrnehmungssteuerung, Rezeptionsästhetik, Unheimlichkeit, Pygmalion-Motiv, Frauenfiguren, Clara, Olimpia, Frauenbild, Romantik, Schauerliteratur, Phantastik, Realismus.
- Quote paper
- GRIN Verlag (Hrsg.) (Editor), Maike Egidi (Author), Maxim Braun (Author), Kinga Donasch (Author), 2024, Motive und Erzählstrategien in E.T.A Hoffmanns "Der Sandmann". Das Unheimliche, das Pygmalion-Motiv und die Frauenfiguren Clara und Olimpia, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1461186