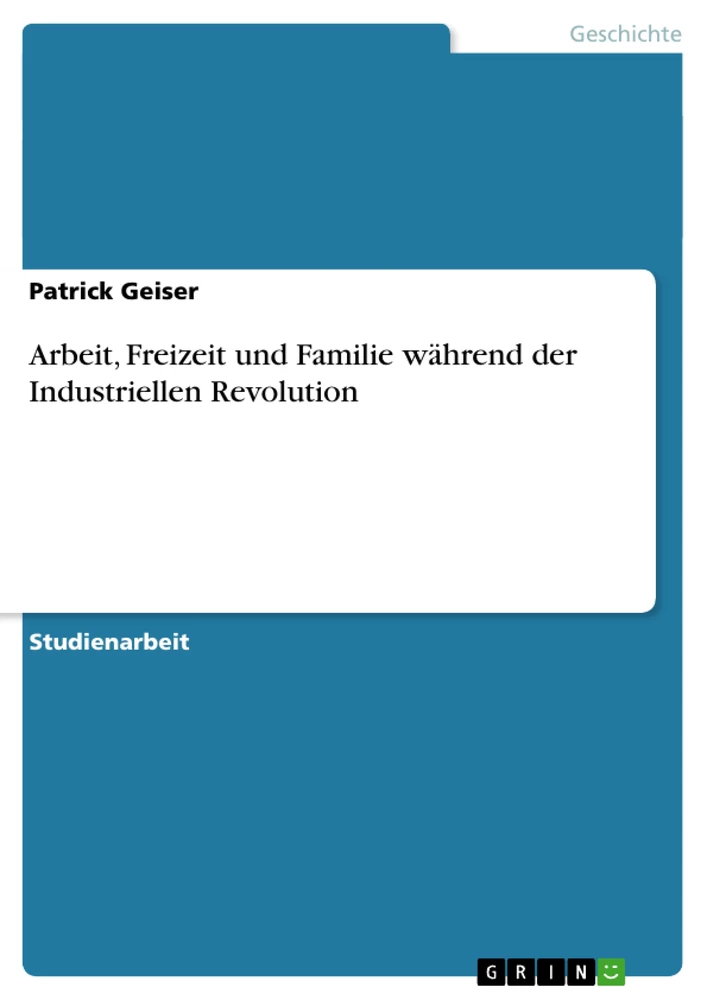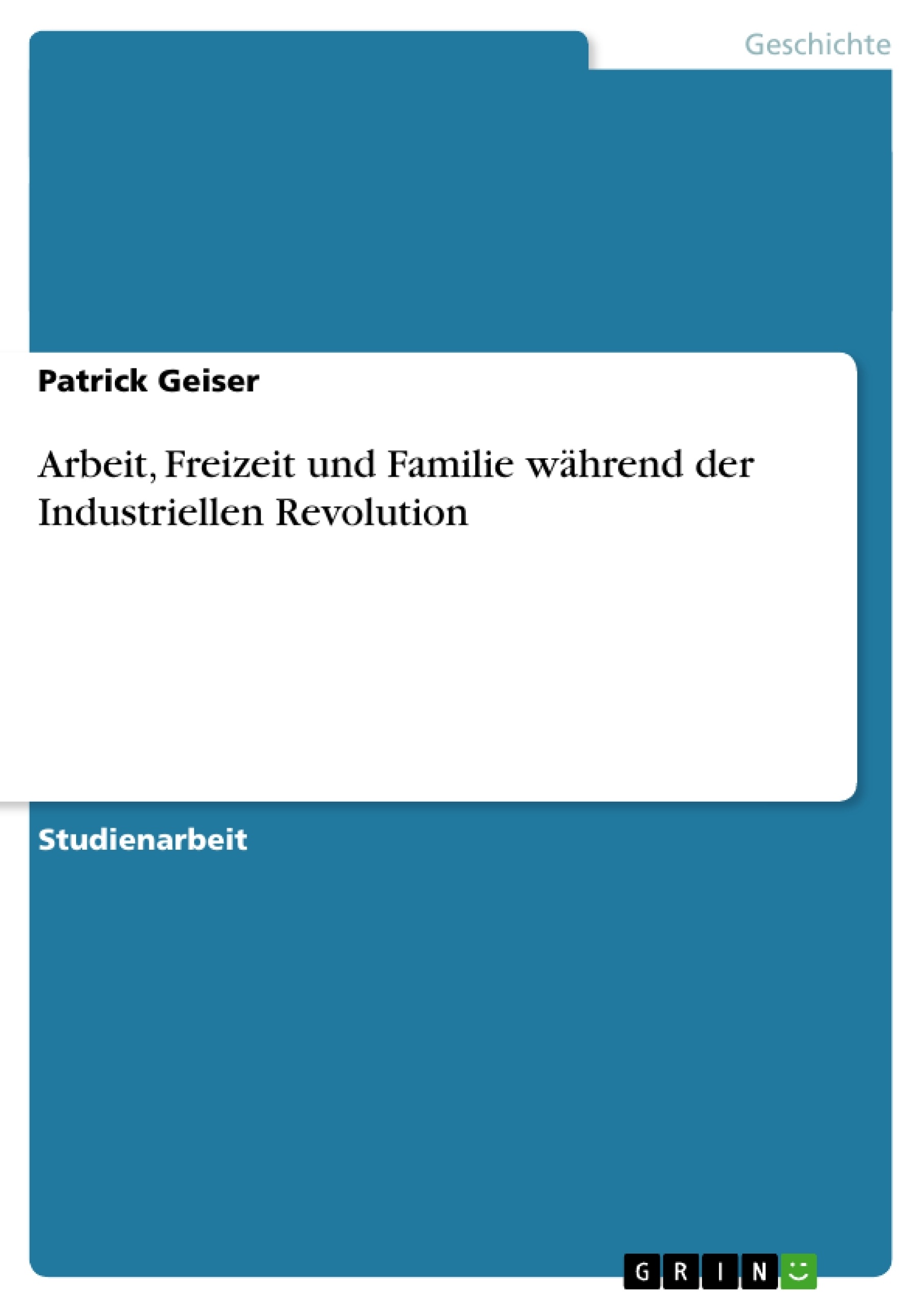Großbritannien ist das erste Land, welches eine Industrielle Revolution beziehungsweise Industrialisierung in diesem Maße erfahren hat. Dabei hat die Industrielle Revolution viele wirtschaftliche und soziale Aspekte des 18. und 19. Jahrhunderts grundlegend verändert. Ziel meiner Hausarbeit ist es hierbei einige dieser Merkmale aufzugreifen und zu erörtern.
Dabei werde ich anfangs auf die Arbeitsverteilung und deren Umstrukturierung während der Industriellen Revolution eingehen. Zum Zweiten werde ich darlegen inwiefern sich Arbeiter in den Fabriken strengen Kontrollen und Ungerechtigkeit von Seiten ihrer Arbeitgeber hingeben mussten, beziehungsweise wie diese umgangen werden konnten.
In den zwei folgenden Kapiteln vier und fünf werde ich mich näher mit der Frauen- und Kinderarbeit während der Industrialisierung auseinandersetzten, die beide eine sehr fundamentale Rolle während der Industriellen Revolution spielen, und dabei unter starker Belastung und Unterdrückung litten.
In den letzten beiden Kapiteln werde ich näher auf die Strukturen und Gegebenheiten der Familie, sowie auf die damals gegenwärtigen Freizeitaktivitäten der Arbeiter während der Industriellen Revolution eingehen. Einer der wichtigsten Faktoren des sozialen Wandels auf dem Weg zur Industrialisierung des frühindustriellen Großbritanniens ist die Umstrukturierung der Arbeit beziehungsweise der Arbeitsbedingungen. Für den größten Teil der arbeitenden Bevölkerung von Männern, Frauen und Kindern bedeutete dies einen langen Arbeitstag von mindestens 12 Stunden an zumindest 6 Tagen der Woche. Dabei war es innerhalb der Familien der Arbeiterklasse von großer Wichtigkeit untereinander zu kooperieren und viel und hart zu arbeiten um geringfügig besser als von der Hand in den Mund zu leben.
Aufgrund der Vielfalt der industriellen Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt war es den Arbeitern möglich, durch besondere erworbene Fähigkeiten höhere Löhne zu erwirtschaften, was in der Folge zu sowohl sozialer als auch geographischer Mobilität führen konnte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Arbeitsverteilung
- III. Arbeit und Arbeitskontrolle
- IV. Frauenarbeit
- V. Kinderarbeit
- VI. Familie
- VII. Freizeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der Industriellen Revolution auf die Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung in Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert. Die Arbeit beleuchtet die Veränderungen in der Arbeitsverteilung, die Arbeitsbedingungen, die Rolle von Frauen und Kindern in der Arbeitswelt sowie die familiären Strukturen und die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
- Die Umstrukturierung der Arbeit und Arbeitsbedingungen
- Die Bedeutung von Frauen- und Kinderarbeit
- Die Arbeitskontrolle in den Fabriken und die daraus resultierenden Konflikte
- Die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Familienstruktur
- Die Entstehung und Entwicklung von Freizeitaktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die allgemeine Entwicklung der Industriellen Revolution in Großbritannien vor und skizziert die zentralen Themen der Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt die Veränderungen in der Arbeitsverteilung und die Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Arbeiter. Das dritte Kapitel analysiert die Arbeitsbedingungen in den Fabriken und die Machtverhältnisse zwischen Arbeitern und Arbeitgebern. Die Kapitel vier und fünf widmen sich der Rolle von Frauen und Kindern in der industriellen Produktion. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Familie und den Auswirkungen der Industrialisierung auf die familiären Strukturen. Das siebte Kapitel untersucht die Freizeitaktivitäten der Arbeiter im Kontext der Industrialisierung.
Schlüsselwörter
Industrielle Revolution, Großbritannien, Arbeit, Arbeitsbedingungen, Frauenarbeit, Kinderarbeit, Familie, Freizeit, soziale Veränderungen, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Mobilität, Arbeitskontrolle, Fabrik, Arbeitsdisziplin.
- Quote paper
- M.A. Patrick Geiser (Author), 2005, Arbeit, Freizeit und Familie während der Industriellen Revolution, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146069