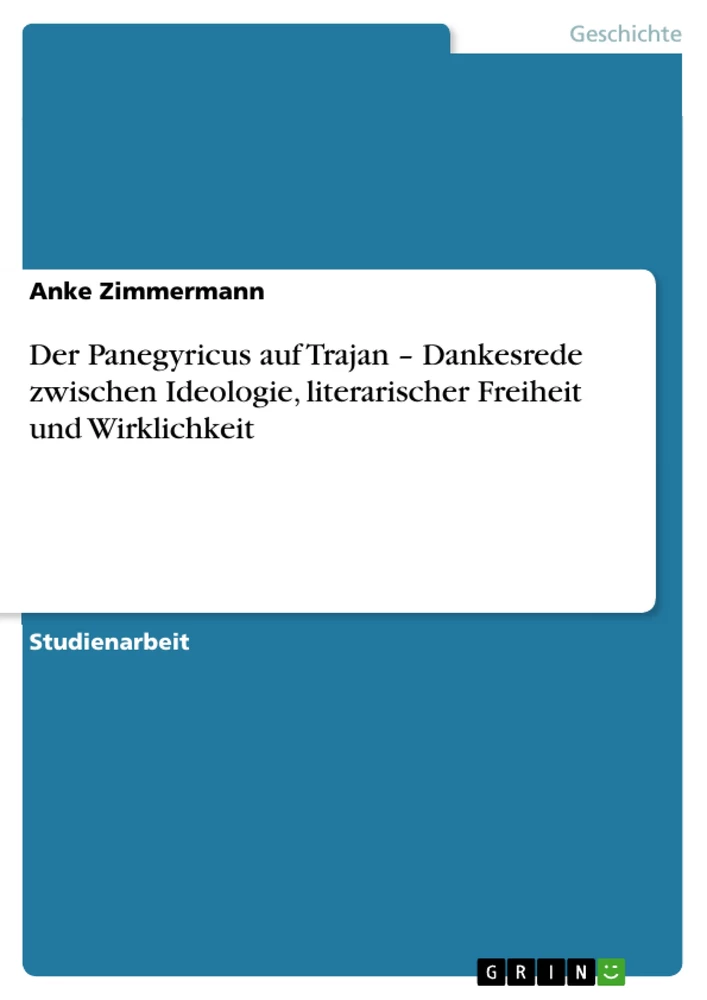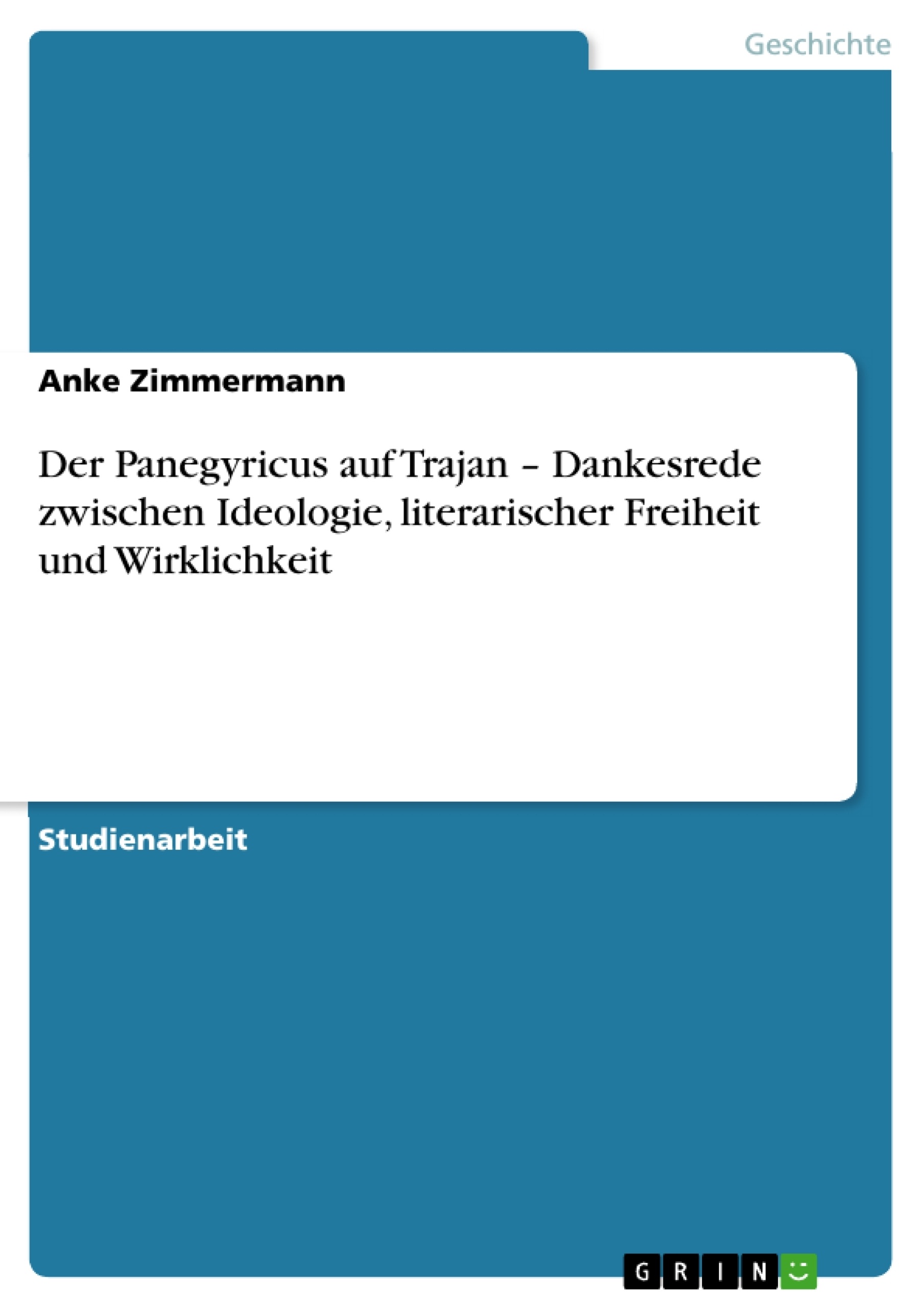Die vorliegende Arbeit befasst sich anhand ausgewählter Textpassagen des Panegyricus auf Trajan mit Wesen, Entstehungs- und Wirkungsintention sowie mit der politischen und literarischen Bedeutung der Dankesrede Plinius’ des Jüngeren. In Anbetracht des begrenzten Rahmens dieser Arbeit wird auf eine ausführliche Darstellung biografischer Fakten des jüngeren Plinius verzichtet, lediglich die für den Gegenstand der Betrachtung relevanten Aspekte werden an geeigneter Stelle Erwähnung finden.
Im Hinblick auf die Frage, inwieweit der Panegyricus auf Trajan ein Abbild der offiziellen Herrscherideologie seiner Zeit war, soll es konkret um folgende Aspekte gehen: Welche inneren und äußeren Beweggründe veranlassten Plinius d. J. dazu, eine solche Lobeshymne auf den römischen Kaiser Trajan zu verfassen? Wie ist der Panegyricus von Zeitgenossen aufgenommen worden und welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen? Und: Wie ist der Wert des Panegyricus als historische Quelle für die trajanische Ära innerhalb der römischen Kaiserzeit unter Beachtung aller quellenkritischen Aspekte insgesamt zu beurteilen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungskontext und Präsentation
- Literarische Vorbilder und Gattungsfragen
- Das Verhältnis des jüngeren Plinius zu Kaiser Trajan
- Der Panegyricus als historische Quelle
- Die offizielle Herrscherideologie Trajans und ihre Entsprechung im Panegyricus
- Die Selbstdarstellung Kaiser Trajans
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Panegyricus auf Trajan, eine Dankesrede des jüngeren Plinius, und beleuchtet seine Entstehungsgeschichte, Wirkungsintention sowie seine politische und literarische Bedeutung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, inwieweit der Panegyricus ein Abbild der offiziellen Herrscherideologie seiner Zeit darstellt.
- Die inneren und äußeren Beweggründe Plinius' für die Verfassen des Panegyricus
- Die Rezeption des Panegyricus durch Zeitgenossen und die daraus ableitbaren Rückschlüsse
- Der Wert des Panegyricus als historische Quelle für die trajanische Ära unter Berücksichtigung quellenkritischer Aspekte
- Die literarischen Vorbilder und Gattungsfragen, die dem Panegyricus zugrunde liegen
- Die Bedeutung des Panegyricus als Vorbild für spätere Werke der Panegyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik und Zielsetzung der Arbeit sowie über die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes.
Das Kapitel „Entstehungskontext und Präsentation“ beleuchtet den Anlass und die Entstehungsgeschichte des Panegyricus. Der Text wurde im Jahr 100 n. Chr. anlässlich des Amtsantritts Plinius' als Suffektkonsul verfasst.
Im Kapitel „Literarische Vorbilder und Gattungsfragen“ wird die Einordnung des Panegyricus in den Kontext der antiken Redeformen beleuchtet. Plinius verbindet Elemente des griechischen Panegyricos mit der römischen gratiarum actio, um eine neue Form der Lobeshymne zu schaffen.
Das Kapitel „Der Panegyricus als historische Quelle“ analysiert den Wert des Textes als Quelle für die trajanische Epoche. Hierbei wird die offizielle Herrscherideologie Trajans und ihre Entsprechung im Panegyricus untersucht.
Das Kapitel „Die Selbstdarstellung Kaiser Trajans“ fokussiert auf die Darstellung des römischen Kaisers im Panegyricus.
Schlüsselwörter
Panegyricus auf Trajan, Plinius der Jüngere, Herrscherideologie, römische Kaiserzeit, Gratulationsschrift, literarische Gattungen, historische Quelle, Trajan, Selbstdarstellung.
- Arbeit zitieren
- Anke Zimmermann (Autor:in), 2003, Der Panegyricus auf Trajan – Dankesrede zwischen Ideologie, literarischer Freiheit und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146055