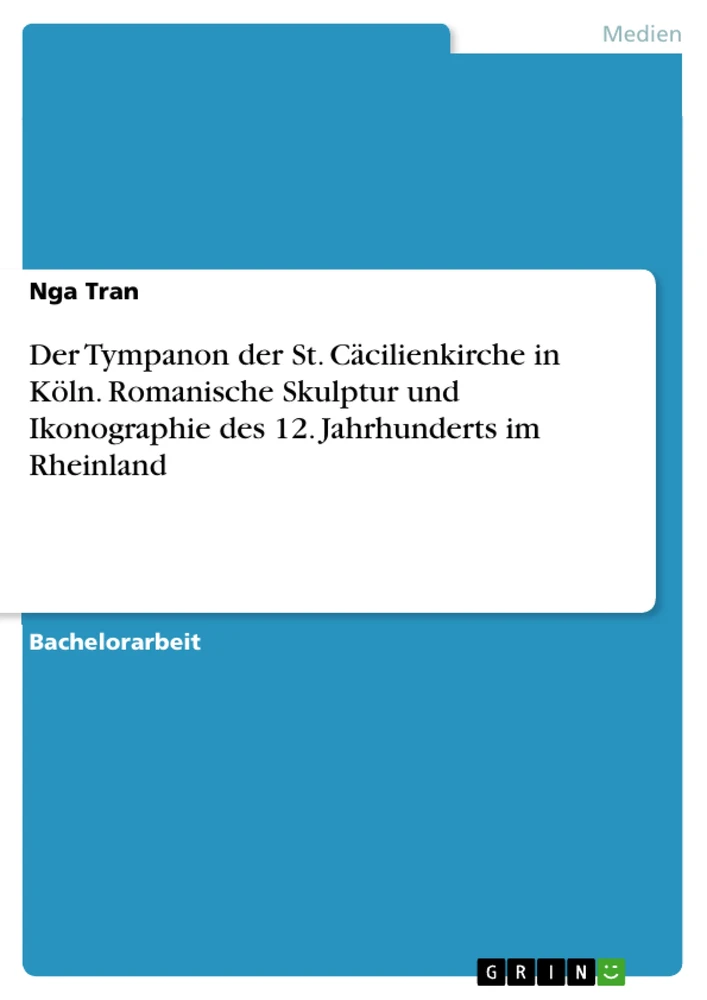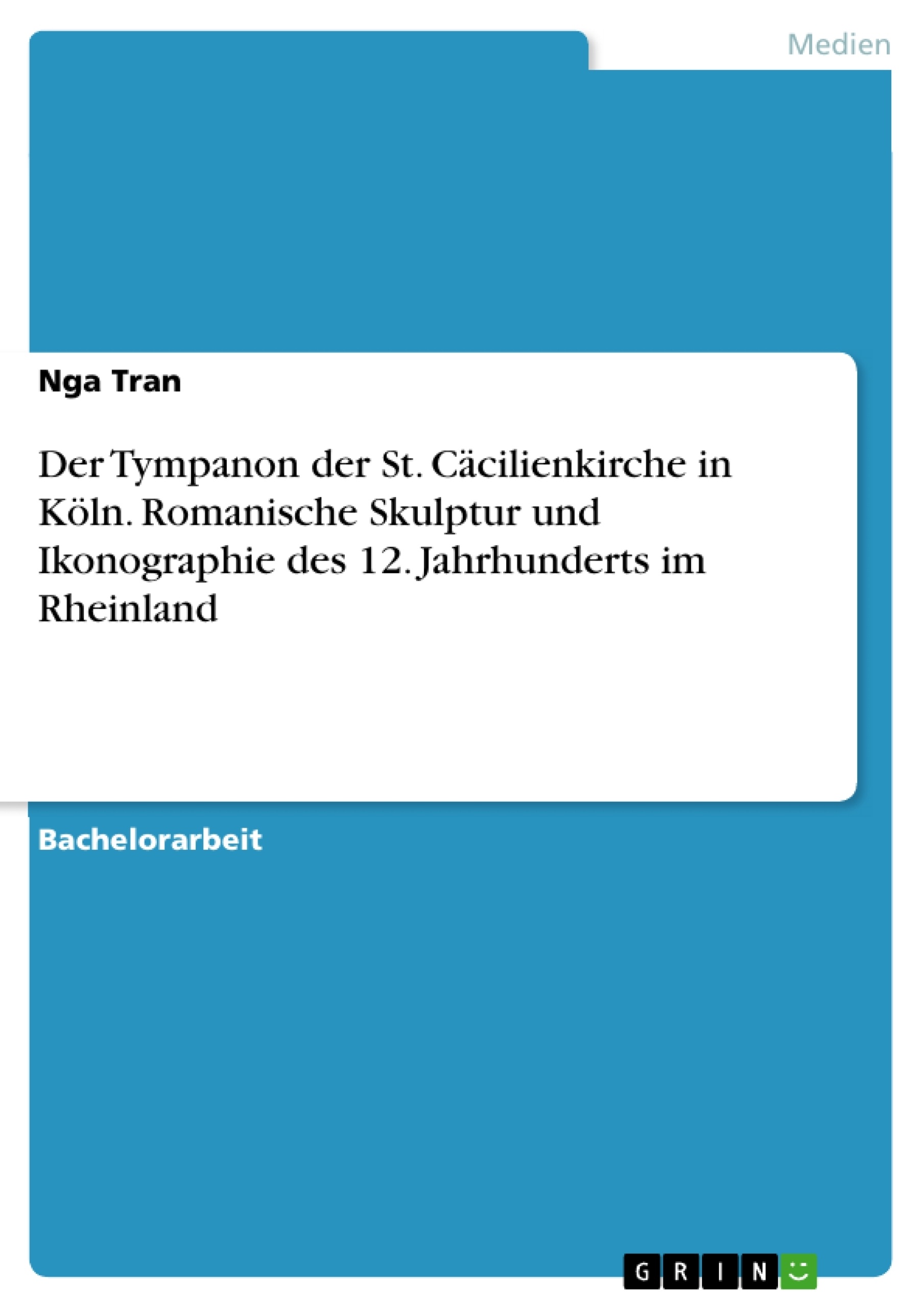Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich einer umfassenden Analyse des reliefierten Tympanons der ehemaligen Stiftskirche St. Cäcilien in Köln, einem der herausragendsten Zeugnisse romanischer Skulptur des 12. Jahrhunderts im Rheinland. Durch eine detaillierte Betrachtung der Forschungslage, stilistischen Merkmale und ikonographischen Inhalte, sowie der Einbettung des Werks in den Kontext der rheinischen und europäischen Skulptur jener Epoche, unternimmt die Arbeit den Versuch, das Cäcilientympanon in seiner künstlerischen und historischen Bedeutung neu zu bewerten.
Im Zentrum der Untersuchung steht die detaillierte Beschreibung und Interpretation des Tympanons, wobei insbesondere auf die Darstellung der hl. Cäcilia und ihrer Begleiter, des hl. Valerianus und des hl. Tiburtius, eingegangen wird. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen den dargestellten Figuren und dem Betrachter, die durch die Gestaltung und Anordnung der Reliefs hervorgerufen werden. Ebenso wird die symbolische Bedeutung der himmlischen Krönung Cäciliens, als zentrales Motiv des Tympanons, innerhalb der christlichen Ikonographie erörtert.
Darüber hinaus werden die künstlerischen Einflüsse und technischen Aspekte der Skulptur untersucht, um die stilistische Einordnung des Werks innerhalb der rheinischen Skulptur des 12. Jahrhunderts zu präzisieren. Die Analyse der Bauornamentik und der Beziehungen zu anderen Werken der zeitgenössischen Skulptur, insbesondere jenen der Brauweiler Kreuzgangswerkstatt, ermöglicht es, neue Einblicke in die Werkstattpraxis und die kulturellen Austauschprozesse jener Zeit zu gewinnen.
Durch die Einbettung des Cäcilientympanons in den breiteren Kontext der mittelalterlichen Kunst und Kultur des Rheinlands liefert die Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Entwicklungen in der romanischen Skulptur und der Rolle religiöser Thematiken in der Kunst des Mittelalters. Die Betrachtung der Forschungsgeschichte und methodischen Ansätze unterstreicht zudem die Notwendigkeit einer kontinuierlichen kritischen Auseinandersetzung mit etablierten Interpretationen und Datierungen, um die vielschichtigen Bedeutungsebenen mittelalterlicher Kunstwerke adäquat erfassen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Tympanon von St. Cäcilien in Köln
- Forschungslage
- Verortung und Zusammensetzung
- Beschreibung
- Interpretation
- Das Cäcilientympanon und die rheinische Skulptur des 12. Jahrhunderts
- Das Cäcilientympanon und die Brauweiler Bauornamentik
- Das Cäcilientympanon und der Jahreszeitensockel
- Das Cäcilientympanon und das Medardusrelief aus Brauweiler
- Das Cäcilientympanon und das Tympanon von St. Pantaleon
- Das Cäcilientympanon und die Gustorfer Chorschranken
- Das Cäcilientympanon und die Grabplatte der Plektrudis
- Das Cäcilientympanon und das Marienretabel aus Brauweiler
- Das Cäcilientympanon, die Sitzstatue des hl. Nikolaus in Brauweiler und ein Kopf eines Bischofs
- Zwischenresümee
- Die rheinische und europäische Skulptur im 12. Jahrhundert
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem Tympanon der ehemaligen Stiftskirche St. Cäcilien in Köln und der rheinischen Skulptur des 12. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Besonderheiten und Bedeutung des Tympanons im Kontext der Skulpturen jener Zeit besser zu erfassen und zu würdigen.
- Die Entstehungsumstände und formale Gestaltung des Cäcilientympanons
- Die Einordnung des Tympanons innerhalb der Brauweiler Kreuzgangswerkstatt
- Der Vergleich des Cäcilientympanons mit ausgewählten Werken der rheinischen Skulptur
- Die Einordnung der rheinischen Skulptur des 12. Jahrhunderts in den europäischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungslage zum Cäcilientympanon beleuchtet und die Forschungslücken aufzeigt, die diese Arbeit schließen möchte. Im zweiten Kapitel werden die Entstehungsumstände des Tympanons, seine formalen Wesensmerkmale sowie eine ikonographische Interpretation des Werks behandelt.
Das dritte Kapitel vergleicht das Cäcilientympanon mit ausgewählten Werken der rheinischen Skulptur des 12. Jahrhunderts. Hierbei werden insbesondere die Werke der Brauweiler Kreuzgangswerkstatt betrachtet, wie die Freisäulenkapitelle der Benediktuskapelle, der Jahreszeitensockel, das Medardusrelief und das Tympanon von St. Pantaleon.
Des Weiteren wird das Cäcilientympanon mit den Gustorfer Chorschranken, der Grabplatte der Plektrudis, dem Marienretabel aus Brauweiler, der Sitzstatue des hl. Nikolaus und einem Kopf eines Bischofs verglichen.
Im vierten Kapitel werden die Beziehungen der rheinischen Skulptur zum europäischen Kontext, insbesondere zu Oberitalien und Frankreich, untersucht.
Schlüsselwörter
Cäcilientympanon, rheinische Skulptur, Brauweiler Kreuzgangswerkstatt, Bauornamentik, Jahreszeitensockel, Medardusrelief, Tympanon von St. Pantaleon, Gustorfer Chorschranken, Grabplatte der Plektrudis, Marienretabel, Sitzstatue des hl. Nikolaus, Bischofskopf, europäische Skulptur, Byzanz, Frankreich, Oberitalien.
- Quote paper
- Nga Tran (Author), 2007, Der Tympanon der St. Cäcilienkirche in Köln. Romanische Skulptur und Ikonographie des 12. Jahrhunderts im Rheinland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1460034