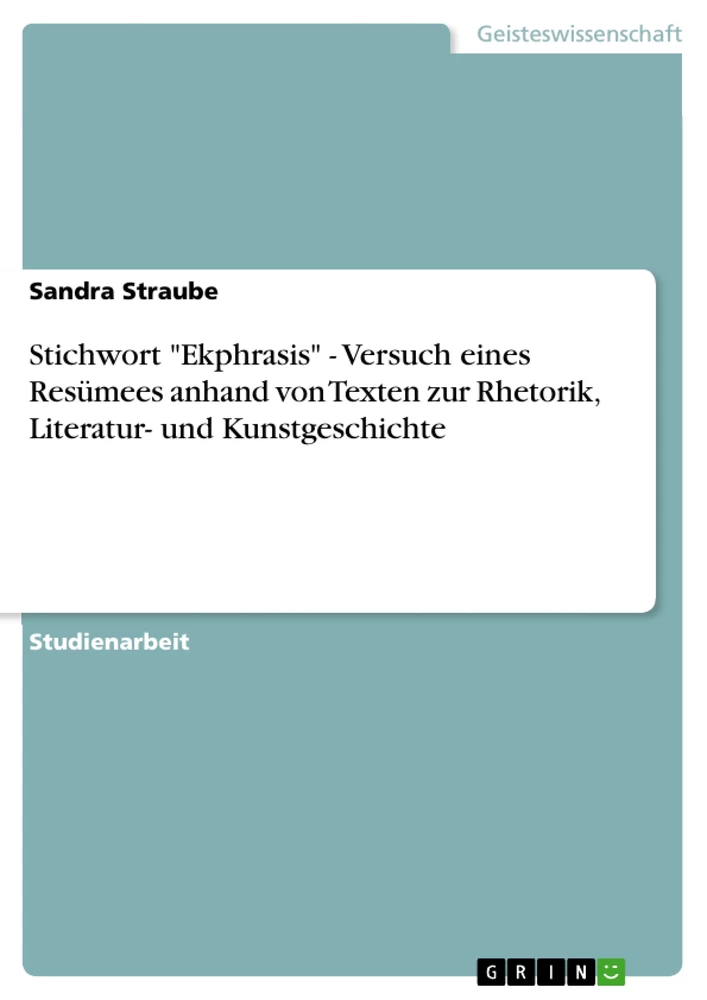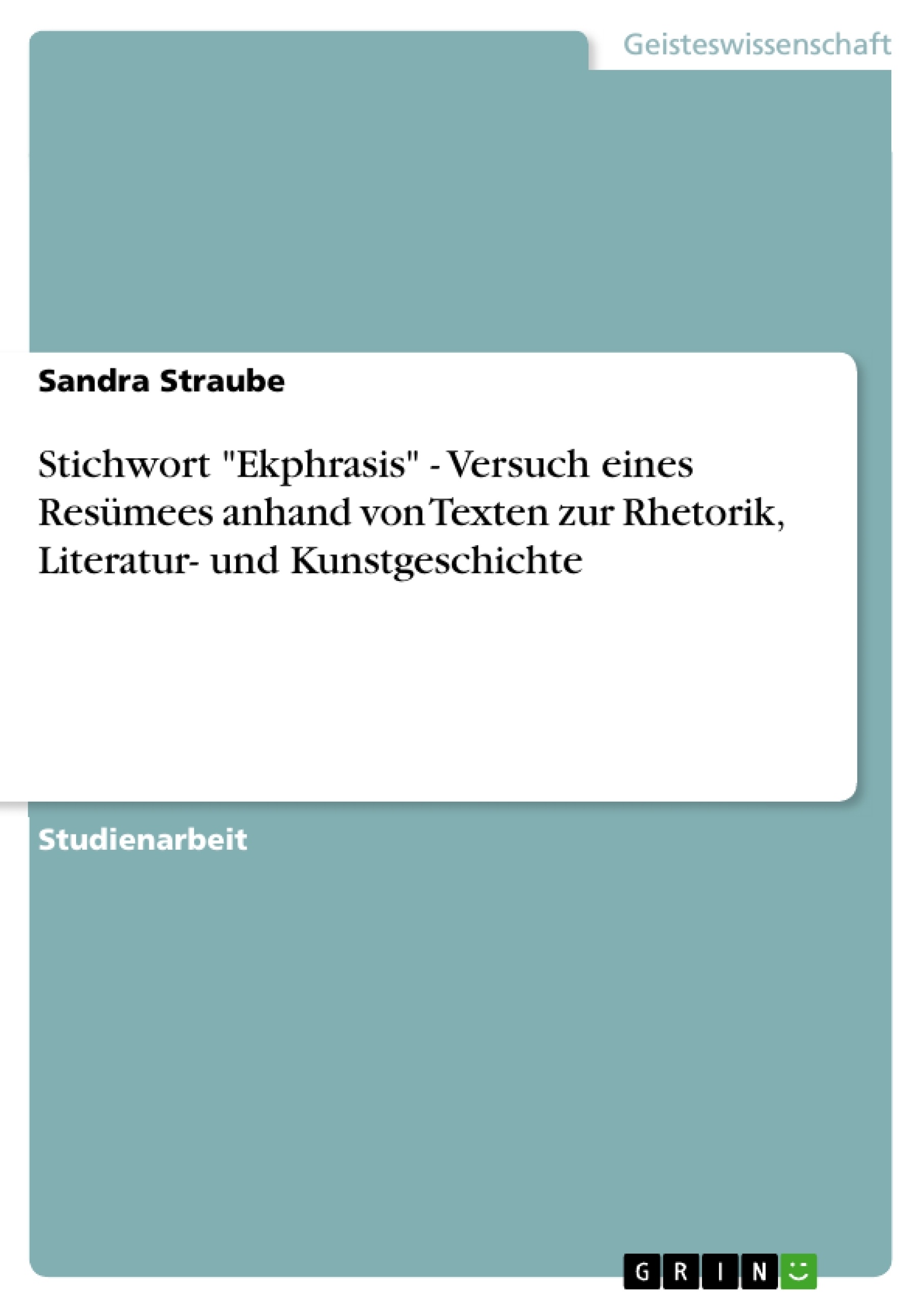Im ersten Teil wird das Problem einer fehlenden einheitlichen Definition des Begriffs "Ekphrasis" diskutiert und damit verbundene Problematiken aufgezeigt. Im Hauptteil beziehe ich mich auf einen Texte von Fritz Graf (= Entstehung von Ekphrasis, Gattung oder nicht?), betrachte und diskutiere die erste überlieferte Ekphrasis (="Der Schild des Achilleus" in Homers Illias) und diskutiere Ruth Webbs Beitrag zum Diskurs über die modernen Künste und das Problem ihrer Rezipation/Interpretation. Abschließend greife ich das Problem Wort-/Bildkunst nochmal auf, in dem ich einen Bezug zum intermedialen Theater herstelle (Robert Wilsons Hamletmaschine) und hier eine Lösung der Gleichberechtigung der Künste sehe.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Problemerläuterung des Begriffs „Ekphrasis“ und Anmerkungen zur nachfolgenden Seminararbeit
- II.) Untersuchung ausgewählter „Ekphrasis“ – Texte: Aspekte, Schlussfolgerungen und Perspektiven
- 1.) „Der Schild des Achilleus“: Eine Auseinandersetzung mit der ersten überlieferten Ekphrasis
- 2.) Fragen zur Gattung und der Herkunft bei Fritz Graf.
- 3.) Diskussion in Anlehnung an Ruth Webb: Ekphrasen und ihr Beitrag zum modernen Diskurs über die Künste
- III.)Exkurs: Problematik von Wort-& Bildkunst im Theater..
- IV.) Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist es, den Begriff „Ekphrasis“ zu erforschen und die Frage zu beantworten, warum dieser Begriff in der Moderne soviel Konfliktpotenzial aufzuwerfen scheint. Die Arbeit untersucht ausgewählte „Ekphrasis“ – Texte und analysiert ihre Aspekte, Schlussfolgerungen und Perspektiven. Dabei wird ein subjektives Resümee des Seminars erstellt, aus dem objektive Schlüsse gezogen werden sollen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Ekphrasis“
- Die Beziehung zwischen Wort- und Bildkunst
- Die Funktion von Ekphrasis in der Literatur und Kunstgeschichte
- Die Problematik von Ekphrasis in der Moderne
- Die Wirkung von Ekphrasis auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Begriff „Ekphrasis“ und bietet eine erste, vorläufige Definition. Es wird argumentiert, dass „Ekphrasis“ eine besondere Form der Bildbeschreibung ist, die es schafft, ein Kunstwerk so lebendig zu beschreiben, dass der Leser sich eine genaue Vorstellung davon machen kann, ohne es tatsächlich zu sehen. Dieses Kapitel untersucht auch die Frage, ob „Ekphrasis“ eine eigene Gattung darstellt oder nur eine Untergattung. Das zweite Kapitel analysiert ausgewählte „Ekphrasis“ – Texte, beginnend mit „Der Schild des Achilleus“ von Erika Simon. Der Text wird als eine der ersten überlieferten Bildbeschreibungen betrachtet und seine Wirkung auf die visuelle Vorstellungskraft des Lesers analysiert. Es wird argumentiert, dass Ekphrasis nicht unbedingt auf real existierende Kunstwerke beschränkt sein muss, sondern auch gedachte Kunstwerke beschreiben kann. Das Kapitel untersucht auch die Argumentation von Erika Simon in ihrem Aufsatz und stellt heraus, dass sie sich mit der Auflösung des neuzeitlichen Problems zwischen der Simultanität der Bildkunst und dem Nacheinander der Wortkunst auseinandersetzt. Die weiteren Kapitel werden nicht in dieser Zusammenfassung behandelt, da sie möglicherweise Spoiler für den gesamten Text enthalten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Seminararbeit sind: „Ekphrasis“, Bildbeschreibung, Wortkunst, Bildkunst, Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, Wirkung, Vorstellungskraft, Simultanität, Nacheinander, neuzeitliches Problem.
- Quote paper
- Sandra Straube (Author), 2009, Stichwort "Ekphrasis" - Versuch eines Resümees anhand von Texten zur Rhetorik, Literatur- und Kunstgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145989