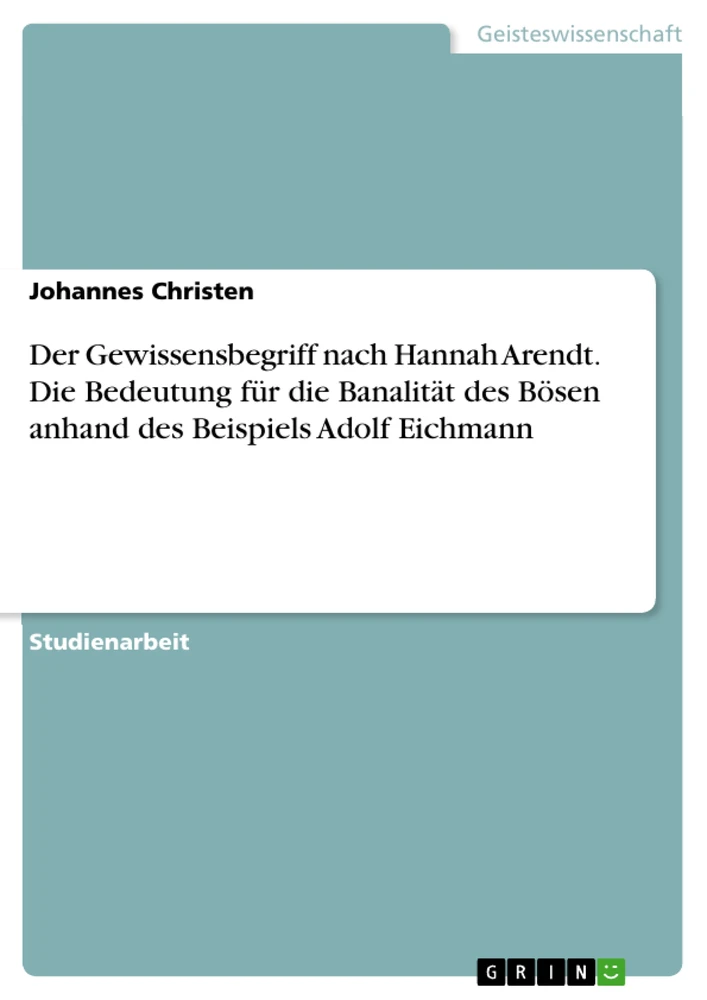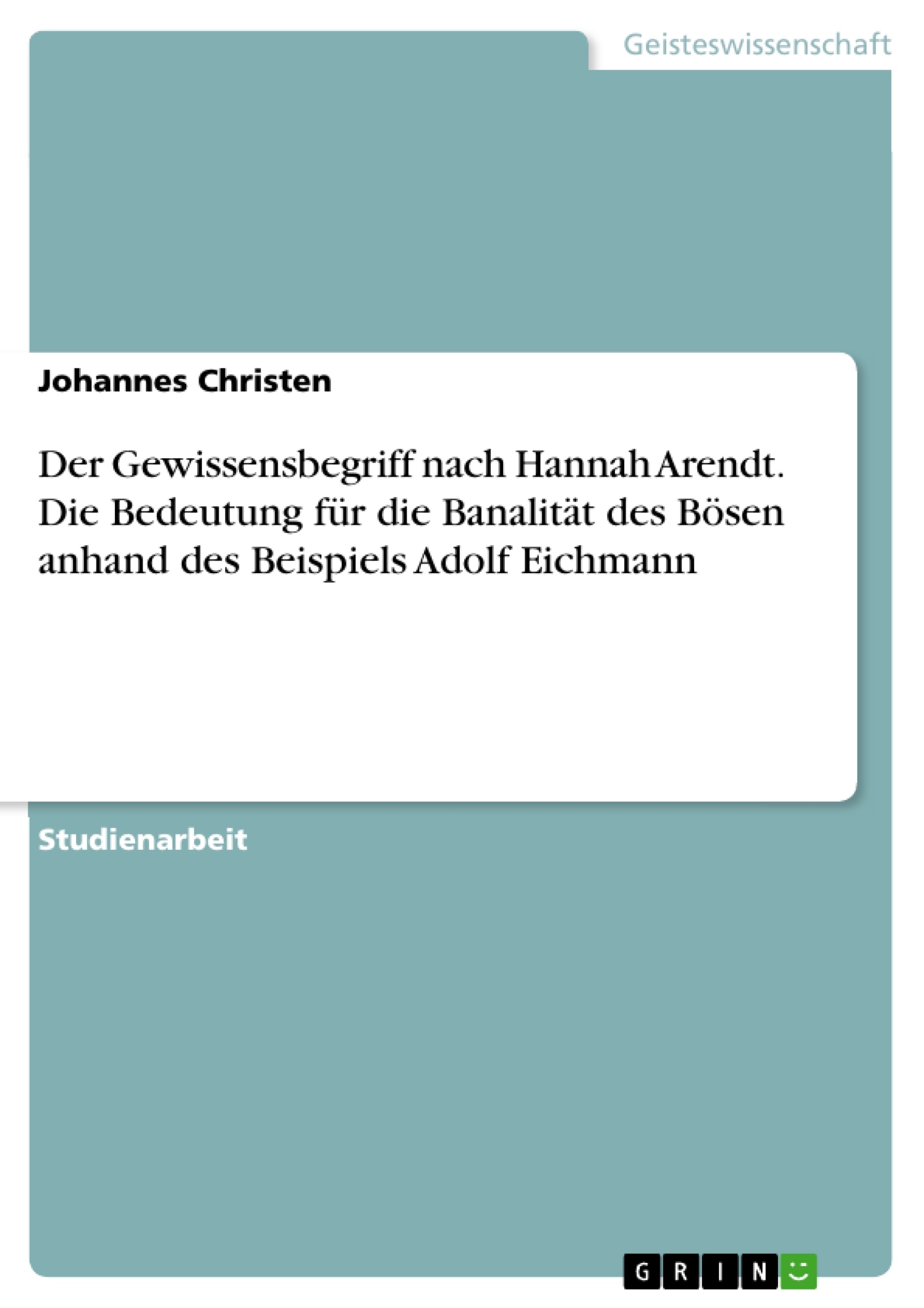Wie kann ein Mensch wie Adolf Eichmann, der für die Deportation und den Mord an Millionen von Jüdinnen und Juden verantwortlich ist, ein Gewissen haben? Und sich auch noch auf dieses berufen? Diese Frage stellten sich nicht nur die Richter des vom Bezirksgericht Jerusalem geführten Prozess gegen den SS-Obersturmbannführer im Jahre 1961, sondern auch Hannah Arendt selbst - und viele weitere Menschen, die den Prozess verfolgten. Arendts Bericht hierzu, welcher 1963 erstmalig erschien, löste folglich bei den Leserinnen und Lesern heftige Kritik und langanhaltende Kontroversen aus.
Arendt schildert in ihrem Werk einen "Kollaps des Gewissens" und beweist, warum das Gewissen nicht als moralische Instanz des Menschen fungieren kann. Sie zeigt auf, nach welchen Mechanismen die Nazis den Begriff und "moralisches Handeln" an sich pervertiert haben, um ihre Gräueltaten zu rechtfertigen und sagen zu können, sie hätten dabei ein reines Gewissen gehabt.
Was als "Eichmann-Kontroverse" bekannt ist und damals zur Erscheinung des Werkes für viel Kritik gesorgt hat, birgt für den modernen Leser eine wichtige Lektion - nämlich dass das Gewissen nicht als sichere moralische Instanz im Denken und Handeln fungieren sollte, denn es ist anfällig für Manipulation und Irrtümer.
In der Arbeit gehen wir diesen Gedanken auf den Grund. Dabei geht es nicht nur um den Begriff des Gewissens und dessen Pervertierung, sondern auch um die Entwicklung des Begriffs anhand Arendts Denktagebüchern. Ihre gedanklichen Ursprünge hierzu reichen zurück bis zu Sokrates.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Suche nach dem Gewissen bei Eichmann in Jerusalem
- Der Kollaps des Gewissens im 20. Jahrhundert
- Die Eichmann-Kontroverse
- Der Missbrauch der kantischen Moralphilosophie
- Die Banalität des Bösen und das Gewissen
- Entwicklung des Gewissensbegriffs im Werke Arendts
- Sokrates und Arendts Gewissensposition
- Der Begriff im Denktagebuch 1, 1950-1953
- Eine Gewissensdefinition zu Eichmann in Jerusalem
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hannah Arendts Gewissensbegriff und dessen Bedeutung für ihr Konzept der „Banalität des Bösen“, anhand des Beispiels Adolf Eichmann. Ziel ist es, Arendts These, dass Eichmann ein funktionierendes Gewissen besaß, zu beleuchten und im Kontext der Eichmann-Kontroverse zu diskutieren. Die Arbeit analysiert den Kollaps des traditionellen Gewissensbegriffs im 20. Jahrhundert und untersucht die Entwicklung von Arendts Gewissensposition.
- Hannah Arendts Gewissensbegriff
- Die Banalität des Bösen und ihre Verbindung zum Gewissen
- Der Kollaps des traditionellen Gewissensbegriffs
- Die Eichmann-Kontroverse und ihre Bedeutung
- Die Entwicklung von Arendts Gewissensposition im Laufe ihres Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gewissens ein und beschreibt die unterschiedlichen Auffassungen und Interpretationen des Begriffs. Sie hebt die Ambivalenz des Gewissens hervor und betont die besondere Relevanz von Hannah Arendts Werk "Eichmann in Jerusalem" für die Diskussion um den Gewissensbegriff im 20. Jahrhundert. Die Arbeit fokussiert sich auf Arendts Analyse und stellt die These auf, dass Eichmanns Handeln nicht auf einem fehlenden Gewissen beruhte, sondern auf einer anderen Form von Gewissen, welche die traditionelle Vorstellung vom Gewissen in Frage stellt.
Die Suche nach dem Gewissen bei Eichmann in Jerusalem: Dieses Kapitel analysiert Arendts Darstellung Eichmanns im gleichnamigen Werk. Es untersucht, wie Arendt Eichmanns Handlungen und sein Verhalten im Prozess interpretiert und wie sie die Frage nach seinem Gewissen behandelt. Arendt widerlegt die gängige Annahme, dass Eichmann ein Gewissenloser war, und zeigt, dass er ein funktionierendes Gewissen hatte, das jedoch im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und der Bürokratie funktioniert hat. Dieser Punkt ist essentiell, um Arendts Konzept der Banalität des Bösen zu verstehen.
Der Kollaps des Gewissens im 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die Eichmann-Kontroverse, die durch Arendts These ausgelöst wurde. Es diskutiert die Kritik an ihrer Interpretation und den Bruch mit traditionellen Konzeptionen des Gewissens. Die Arbeit analysiert, wie der Missbrauch der kantischen Moralphilosophie und die Banalität des Bösen zum Kollaps des traditionellen Gewissensbegriffs beitrugen. Dieser Kollaps stellt die selbstverständliche Zuordnung des Gewissens zur sittlichen Gutheit in Frage, was ein zentrales Thema der Arbeit bildet.
Entwicklung des Gewissensbegriffs im Werke Arendts: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung von Arendts Gewissensbegriff im Kontext ihres Gesamtwerks. Es vergleicht ihre frühen Überlegungen mit ihrer Analyse in "Eichmann in Jerusalem". Die Betrachtung von Sokrates und Arendts Position und ihrer Aufarbeitung im "Denktagebuch" ermöglicht es, die Genese ihrer Gewissenstheorie nachzuvollziehen. Die Analyse ihrer Eichmann-Interpretation führt schließlich zu einer umfassenderen Definition des Gewissens im Werk Arendts.
Schlüsselwörter
Hannah Arendt, Gewissen, Banalität des Bösen, Adolf Eichmann, Eichmann-Prozess, Kollaps des Gewissens, Moralphilosophie, 20. Jahrhundert, Denktagebuch, Sokrates.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Suche nach dem Gewissen bei Hannah Arendt"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Hannah Arendts Gewissensbegriff und dessen Bedeutung für ihr Konzept der „Banalität des Bösen“, insbesondere anhand der Figur Adolf Eichmann. Der Fokus liegt auf der Analyse von Arendts These, dass Eichmann ein funktionierendes Gewissen besaß, und der Diskussion dieser These im Kontext der Eichmann-Kontroverse. Die Arbeit analysiert zudem den Kollaps des traditionellen Gewissensbegriffs im 20. Jahrhundert und die Entwicklung von Arendts Gewissensposition.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Hannah Arendts Gewissensbegriff, die Verbindung zwischen der Banalität des Bösen und dem Gewissen, den Kollaps des traditionellen Gewissensbegriffs, die Bedeutung der Eichmann-Kontroverse und die Entwicklung von Arendts Gewissensposition im Laufe ihres Werkes. Es werden Arendts Interpretationen von Eichmanns Handeln analysiert, die Kritik an ihrer These diskutiert und der Einfluss von Sokrates auf Arendts Gewissensverständnis untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von Arendts Darstellung Eichmanns in "Eichmann in Jerusalem", ein Kapitel zum Kollaps des Gewissensbegriffs im 20. Jahrhundert, ein Kapitel zur Entwicklung von Arendts Gewissensbegriff und ein Fazit. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich primär auf Hannah Arendts Werk "Eichmann in Jerusalem" und ihr Denktagebuch. Zusätzlich werden relevante Sekundärliteratur und philosophische Texte, insbesondere im Bezug auf Sokrates und die kantische Moralphilosophie, herangezogen, um Arendts Positionen zu kontextualisieren und zu diskutieren.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Arendts Interpretation von Eichmanns Handeln, nämlich dass er ein funktionierendes Gewissen besaß, das traditionelle Verständnis von Gewissen herausfordert und den Kollaps des traditionellen Gewissensbegriffs im 20. Jahrhundert aufzeigt. Arendt argumentiert, dass Eichmanns Gewissen im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie und Bürokratie funktionierte, jedoch nicht im Sinne einer traditionellen moralischen Verantwortung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Hannah Arendt, Gewissen, Banalität des Bösen, Adolf Eichmann, Eichmann-Prozess, Kollaps des Gewissens, Moralphilosophie, 20. Jahrhundert, Denktagebuch, Sokrates.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Hannah Arendts Philosophie, die Eichmann-Kontroverse, den Gewissensbegriff und die philosophischen Fragen des 20. Jahrhunderts interessieren. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke, wie etwa Seminararbeiten oder wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Arendts Werk.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Arendts Analyse von Eichmanns Gewissen eine tiefgreifende Kritik an traditionellen Moralvorstellungen darstellt. Sie zeigt, wie der Kontext, insbesondere die nationalsozialistische Ideologie und die bürokratische Struktur, das Funktionieren des Gewissens beeinflussen und zu Handlungen führen kann, die als „banales Böses“ bezeichnet werden können. Die Arbeit unterstreicht die Komplexität des Gewissensbegriffs und dessen Wandel im 20. Jahrhundert.
- Quote paper
- Johannes Christen (Author), 2022, Der Gewissensbegriff nach Hannah Arendt. Die Bedeutung für die Banalität des Bösen anhand des Beispiels Adolf Eichmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1458227