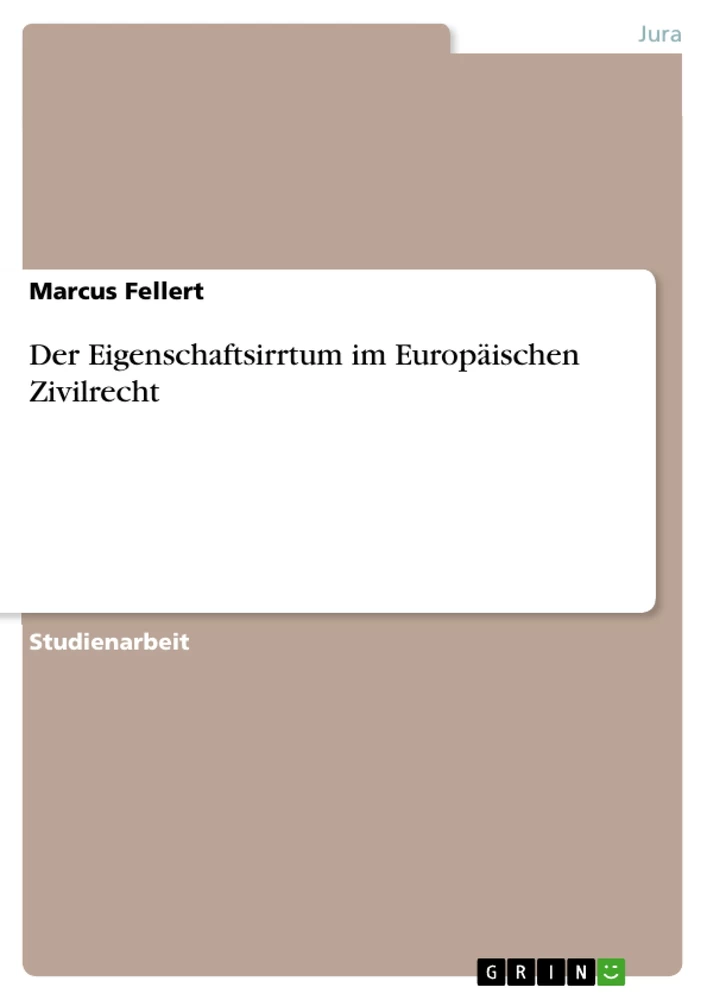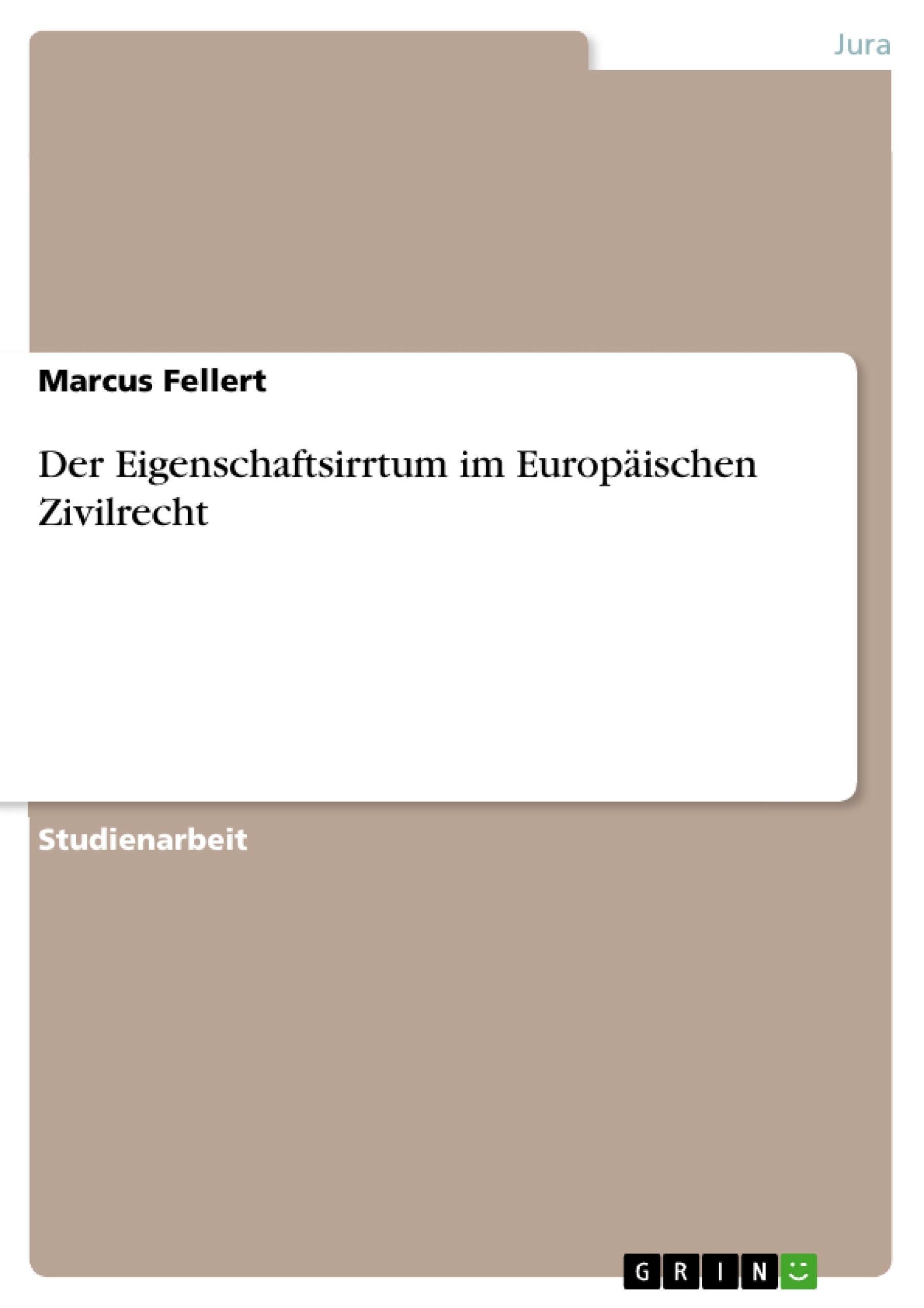Der Käufer einer antiken Skulptur stellt nach einiger Zeit fest, dass die Skulptur nicht von dem Bildhauer war, der ihm versprochen worden ist, sondern eine billige Kopie. Die Frage, die sich der Käufer nun stellt, ist, ob er den Kaufvertrag für nichtig erklären kann. Mit dieser Frage beschäftigen sich Juristen und Gelehrte seit langer Zeit.
Diese Arbeit soll den Versuch unternehmen die wichtigsten Stationen der historischen Entwicklung des Eigenschaftsirrtums darzustellen. Beginnend bei den römischen Juristen, weiter zu den Glossatoren im Mittelalter, zu Savignys Modell und schließlich zur Kodifikation des §119 Abs. 2 BGB.
Im Anschluss daran werden drei europäische Länder, Deutschland, Schweiz und Frankreich vorgestellt. Bei den Ländern wird auf den Tatbestand der jeweiligen Norm eingegangen, Konkurrenzprobleme zu anderen Normen aufgezeigt und am Ende die Frist und Wirkung der Anfechtung kurz dargestellt.
In den Schlussbemerkungen werden zwei Aspekte des Eigenschaftsirrtums der jeweiligen Länder miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- II) Historische Entwicklung des Eigenschaftsirrtums
- 1) Die Irrtumslehre der römischen Juristen
- 2) Die Wiederentdeckung und Weiterentwicklung im Mittelalter
- 3) Die Renaissance der römischen Irrtumslehre durch Savigny
- 4) Die Kodifikation des § 119 Abs. 2 BGB
- III) Der Eigenschaftsirrtum in Deutschland
- 1) Anwendungsvoraussetzungen
- a) Eigenschaften
- b) Verkehrswesentlichkeit von Eigenschaften
- 2) Anwendbarkeit und Konkurrenzprobleme
- a) Sachmängelgewährleistung
- b) Störung der Geschäftsgrundlage
- 3) Anfechtungsfrist und Wirkung der Anfechtung
- 1) Anwendungsvoraussetzungen
- IV) Der Eigenschaftsirrtum in der Schweiz
- 1) Anwendungsvoraussetzungen
- a) Falsche Vorstellung über einen bestimmten Sachverhalt
- b) Subjektive Wesentlichkeit
- c) Objektive Wesentlichkeit
- d) Erkennbarkeit
- 2) Anwendbarkeit und Konkurrenzprobleme
- a) Sachmängelgewährleistung
- b) Gemeinsamer Motivirrtum
- 3) Anfechtungsfrist und Wirkung der Anfechtung
- 1) Anwendungsvoraussetzungen
- V) Der Eigenschaftsirrtum in Frankreich
- 1) Anwendungsvoraussetzungen
- a) Irrtum über die ,,Substanz der Sache‘‘
- b) Erkennbarkeit
- 2) Anwendbarkeit und Konkurrenzprobleme
- a) Sachmängelgewährleistung
- b) Gemeinsamer Irrtum
- 3) Anfechtungsfrist und Wirkung der Anfechtung
- 1) Anwendungsvoraussetzungen
- VI) Vergleichende Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung und die aktuelle Rechtslage des Eigenschaftsirrtums im europäischen Privatrecht. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze in Deutschland, der Schweiz und Frankreich und vergleicht diese miteinander.
- Historische Entwicklung des Eigenschaftsirrtums vom römischen Recht bis zur Kodifikation
- Anwendungsvoraussetzungen des Eigenschaftsirrtums in den drei ausgewählten Ländern
- Konkurrenzprobleme mit anderen Rechtsinstituten (z.B. Sachmängelgewährleistung)
- Anfechtungsfristen und -wirkungen
- Vergleichende Analyse der Rechtslagen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung: Die Einleitung präsentiert das Problem des Eigenschaftsirrtums anhand eines Beispiels (Kauf einer antiken Skulptur, die sich als Fälschung herausstellt) und beschreibt den Umfang der Arbeit. Es wird angekündigt, die historische Entwicklung des Eigenschaftsirrtums von den römischen Juristen bis zur Kodifikation im BGB zu beleuchten und anschließend die Rechtslage in Deutschland, der Schweiz und Frankreich zu vergleichen. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Tatbeständen, Konkurrenzproblemen und der Anfechtung.
II) Historische Entwicklung des Eigenschaftsirrtums: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung des Eigenschaftsirrtums durch die Rechtsgeschichte. Es beginnt mit der römischen Irrtumslehre, die den Irrtum auf den Geschäftstatbestand bezog und einen Konsens beider Parteien für die Gültigkeit des Rechtsakts voraussetzte. Ein einseitiger Irrtum führte nicht zur Ungültigkeit. Die Weiterentwicklung im Mittelalter durch die Glossatoren wird beschrieben, die einen Katalog beachtlicher Irrtumstypen entwickelten und die Möglichkeit eines einseitigen Irrtums einführten. Die subjektive Ansicht der Parteien wurde stärker berücksichtigt. Die Kapitel beschreibt die Bedeutung der Glossatoren für die Entwicklung der modernen Jurisprudenz.
III) Der Eigenschaftsirrtum in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt den Eigenschaftsirrtum im deutschen Recht, insbesondere § 119 Abs. 2 BGB. Es definiert die Anwendungsvoraussetzungen, untersucht die Bedeutung von Eigenschaften und ihrer Verkehrswesentlichkeit und beleuchtet die Konkurrenzprobleme mit der Sachmängelgewährleistung und der Störung der Geschäftsgrundlage. Abschließend wird auf die Anfechtungsfrist und die Wirkung der Anfechtung eingegangen.
IV) Der Eigenschaftsirrtum in der Schweiz: Dieses Kapitel widmet sich dem schweizerischen Recht. Es erläutert die Anwendungsvoraussetzungen des Eigenschaftsirrtums, einschließlich der Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Wesentlichkeit und der Erkennbarkeit des Irrtums. Die Konkurrenz zu anderen Rechtsinstituten wie der Sachmängelgewährleistung und dem gemeinsamen Motivirrtum wird analysiert. Schließlich werden die Anfechtungsfrist und die Wirkung der Anfechtung behandelt.
V) Der Eigenschaftsirrtum in Frankreich: Dieses Kapitel befasst sich mit dem französischen Recht. Es definiert die Anwendungsvoraussetzungen, insbesondere den Irrtum über die „Substanz der Sache“, und die Bedeutung der Erkennbarkeit. Konkurrenzprobleme mit der Sachmängelgewährleistung und dem gemeinsamen Irrtum werden untersucht. Abschließend wird die Anfechtungsfrist und deren Wirkung dargestellt.
Schlüsselwörter
Eigenschaftsirrtum, europäisches Privatrecht, römisches Recht, Glossatoren, Savigny, § 119 Abs. 2 BGB, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Sachmängelgewährleistung, Störung der Geschäftsgrundlage, Anfechtung, Verkehrswesentlichkeit, Konsens, subjektive Wesentlichkeit, objektive Wesentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Eigenschaftsirrtum im europäischen Privatrecht
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Eigenschaftsirrtum im europäischen Privatrecht. Er behandelt die historische Entwicklung, die Rechtslage in Deutschland, der Schweiz und Frankreich sowie einen Vergleich der verschiedenen Rechtsansätze. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen, Konkurrenzproblemen mit anderen Rechtsinstituten (z.B. Sachmängelgewährleistung) und den Anfechtungsfristen und -wirkungen.
Welche Rechtsordnungen werden im Text verglichen?
Der Text vergleicht die Rechtslage zum Eigenschaftsirrtum in Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Es werden die jeweiligen gesetzlichen Regelungen, die Rechtsprechung und die doktrinären Ansätze analysiert und gegenübergestellt.
Wie ist die historische Entwicklung des Eigenschaftsirrtums dargestellt?
Die historische Entwicklung wird von der römischen Irrtumslehre über das Mittelalter bis zur Kodifikation im BGB nachgezeichnet. Es wird der Wandel der juristischen Auffassungen vom Konsensbedürfnis bis zur Berücksichtigung des einseitigen Irrtums und der subjektiven Wesentlichkeit beleuchtet. Die Rolle der römischen Juristen und der Glossatoren wird hervorgehoben.
Welche Anwendungsvoraussetzungen gelten für den Eigenschaftsirrtum in Deutschland?
In Deutschland regelt § 119 Abs. 2 BGB den Eigenschaftsirrtum. Die Anwendungsvoraussetzungen beinhalten das Vorliegen einer Eigenschaft der Sache, deren Verkehrswesentlichkeit und den Irrtum über diese Eigenschaft. Der Text beleuchtet die Definition von „Eigenschaften“ und die Bedeutung ihrer Verkehrswesentlichkeit.
Welche Konkurrenzprobleme bestehen zum Eigenschaftsirrtum in Deutschland?
In Deutschland besteht insbesondere ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem Eigenschaftsirrtum und der Sachmängelgewährleistung sowie der Störung der Geschäftsgrundlage. Der Text untersucht die Abgrenzungskriterien und die jeweiligen Vor- und Nachteile der Anwendung der verschiedenen Rechtsinstitute.
Welche Anwendungsvoraussetzungen gelten für den Eigenschaftsirrtum in der Schweiz?
In der Schweiz sind für den Eigenschaftsirrtum eine falsche Vorstellung über einen bestimmten Sachverhalt, die subjektive und objektive Wesentlichkeit des Irrtums sowie die Erkennbarkeit des Irrtums erforderlich. Der Text erklärt die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Wesentlichkeit im Detail.
Welche Konkurrenzprobleme bestehen zum Eigenschaftsirrtum in der Schweiz?
In der Schweiz besteht ein Konkurrenzverhältnis zum Eigenschaftsirrtum insbesondere mit der Sachmängelgewährleistung und dem gemeinsamen Motivirrtum. Der Text analysiert die Abgrenzung dieser Rechtsinstitute.
Welche Anwendungsvoraussetzungen gelten für den Eigenschaftsirrtum in Frankreich?
In Frankreich ist für den Eigenschaftsirrtum ein Irrtum über die „Substanz der Sache“ und die Erkennbarkeit des Irrtums erforderlich. Der Text definiert den Begriff der „Substanz der Sache“ im französischen Recht.
Welche Konkurrenzprobleme bestehen zum Eigenschaftsirrtum in Frankreich?
In Frankreich besteht ein Konkurrenzverhältnis zum Eigenschaftsirrtum insbesondere mit der Sachmängelgewährleistung und dem gemeinsamen Irrtum. Der Text analysiert die Abgrenzung dieser Rechtsinstitute.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Schlüsselbegriffe sind unter anderem: Eigenschaftsirrtum, europäisches Privatrecht, römisches Recht, Glossatoren, Savigny, § 119 Abs. 2 BGB, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Sachmängelgewährleistung, Störung der Geschäftsgrundlage, Anfechtung, Verkehrswesentlichkeit, Konsens, subjektive Wesentlichkeit, objektive Wesentlichkeit.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert in Einleitung, historische Entwicklung des Eigenschaftsirrtums, Eigenschaftsirrtum in Deutschland, Schweiz und Frankreich sowie vergleichende Schlussbemerkungen. Er enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Marcus Fellert (Author), 2010, Der Eigenschaftsirrtum im Europäischen Zivilrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145609