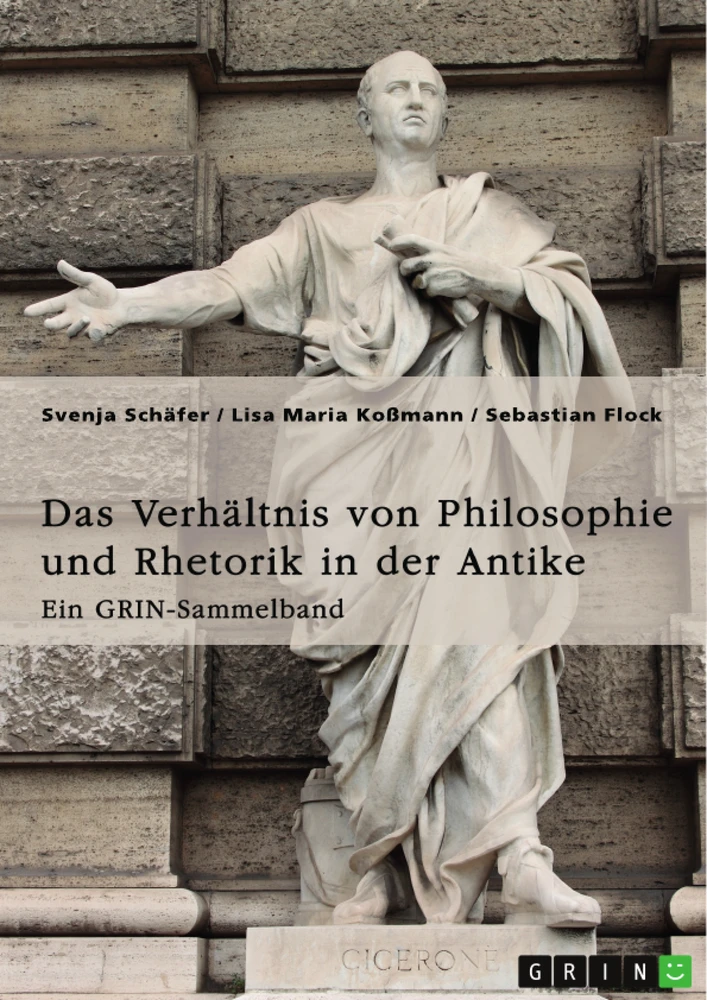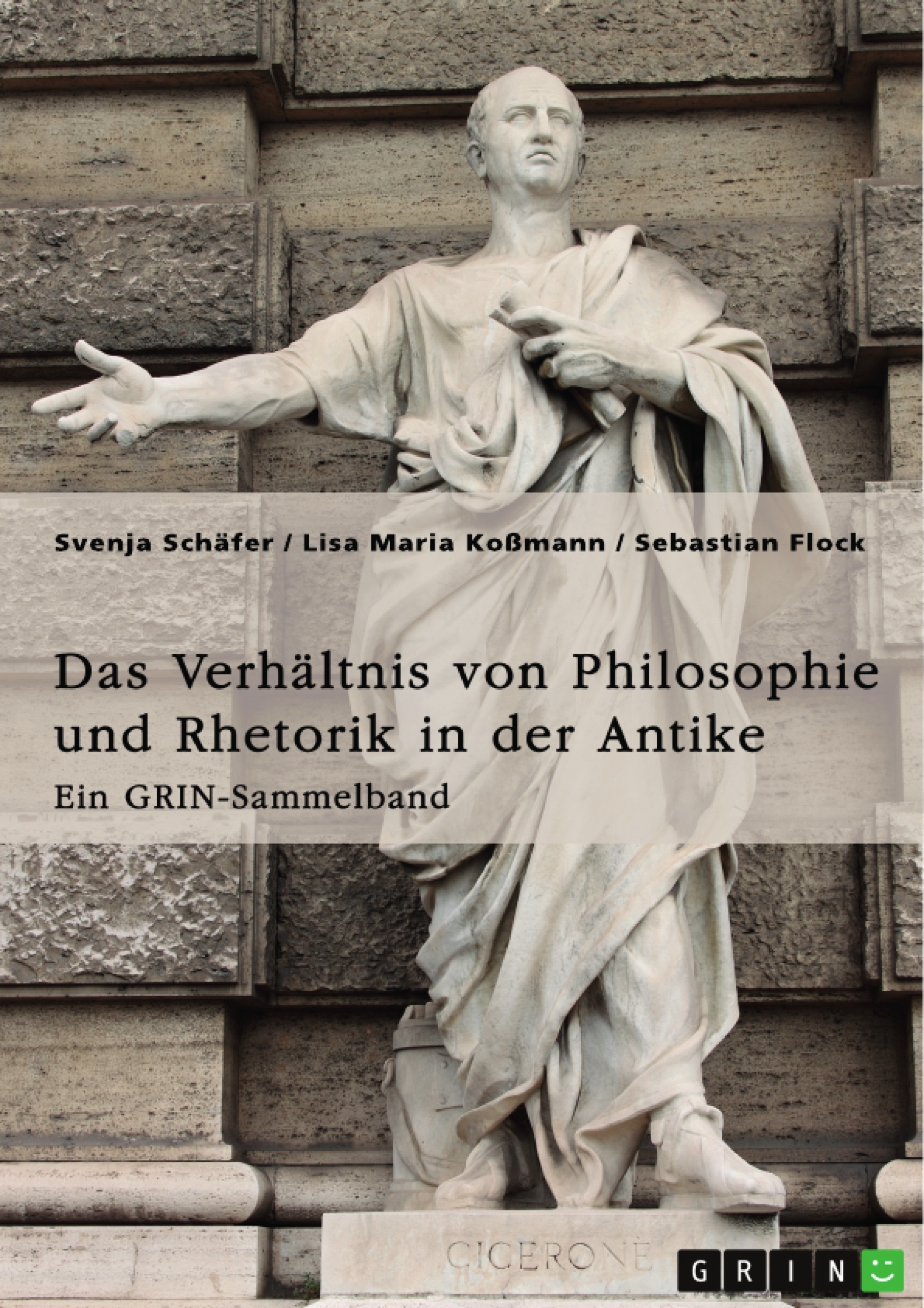Dieser Sammelband enthält drei Hauptseminararbeiten und eine Bachelorarbeit.
In der ersten Hausarbeit soll das Verhältnis zwischen Rhetorik und Philosophie in der Antike sowie Platons Stellung zur Rhetorik verdeutlicht werden. Als Grundlage dient hierfür ein Werk Platons, nämlich der Dialog „Gorgias“. Die zentrale These, die im Laufe dieser Hausarbeit genauer beleuchtet und bewiesen werden soll, lautet: Die Stellung Platons zur Rhetorik, wie sie im Dialog „Gorgias“ zum Vorschein kommt, ist in ihren Grundzügen eine Darstellung des Verhältnisses zwischen den beiden rivalisierenden Schulen Rhetorik und Philosophie.
Eine Analyse von Ciceros Rednerkonzept ist schon deshalb nötig, weil es einige Fragen aufwirft, die für die Rhetorik relevant sind: Was soll ein Redner eigentlich tun, was soll er können und wie soll er sein? Welche Rolle hat er in der Gesellschaft? Und nicht zuletzt: Wozu formuliert Cicero in dieser Deutlichkeit einen Anspruch, dem unmöglich ein Redner gerecht werden kann? Die zweite Arbeit versucht Antworten auf diese Fragen zu finden. Anhand ausgewählter rhetorischer Schriften Ciceros, in denen der orator perfectus thematisiert wird, erfolgt eine Darstellung des Ideals. Ziel ist es, die zahlreichen Definitionen und Anforderungen, die Cicero in seinen Schriften entwickelt, zu einem einheitlichen Konzept des idealen Redners zusammenzustellen.
Was ist der perfectus orator bei Quintilian, den er immer wieder beschwört, und wozu dient dieses schwerlich erreichbare Leitbild? Die dritte Arbeit versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Zunächst wird hierbei das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik ausgelotet, da Quintilian mit vir bonus einen stark philosophisch konnotierten Begriff als Synonym zum perfectus orator verwendet. Des Weiteren gehen wir der Frage nach, welche Rolle die Natur, auf die Quintilian immer wieder verweist, im Leitbild des idealen Redners spielt. In den folgenden Abschnitten wird schließlich die Frage nach der Erreichbarkeit und nach dem Zweck des ambitionierten Programms Quintilians erörtert.
Mit der vierten Arbeit soll untersucht werden, wie sich das Verhältnis zwischen der Philosophie und der Rhetorik in der Hohen Kaiserzeit gestaltete und ob man für diese Zeit von einem Konflikt sprechen kann. Die Thematik wird anhand von Aulus Gellius‘ "Noctes Atticae" bearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Rhetorik und Philosophie in der Antike. Der Dialog "Gorgias" von Platon
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Die Geschichte der Rhetorik
- Die Philosophie als Gegenströmung der Rhetorik
- Der Dialog "Gorgias"
- Platons Haltung zur Rhetorik
- Schlussfolgerung
- Orator perfectus. Zu Ciceros Rednerideal
- Einleitung
- Der orator perfectus
- Bildungsanforderungen
- Rhetorische Fähigkeiten
- Persönlichkeit des Redners
- Rednerideal und Moral
- Rednerische Pflichten
- Naturanlage und Ausbildung
- Wozu das Ideal?
- Die Rolle des Redners im Staat
- Das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik
- Weiterwirken des orator perfectus bei Quintilian
- Conclusio
- Zum Ideal des Perfectus Orator in Quintilians "Institutio Oratoria"
- Vir bonus dicendi peritus
- Einleitung
- Der orator perfectus
- Orator, id est vir bonus - Der gute Redner, ein Philosoph?
- naturae ipsi ars inerit - Die Rolle der Natur
- Orator ille, qui nondum fuit - Erreichbarkeit des Ideals
- Quod magis petimus, bonam voluntatem – Wozu das Ideal?
- Conclusio: vir bonus dicendi peritus
- Die Darstellung in Aulus Gellius' "Noctes Atticae". Das Verhältnis zwischen Philosophie und Rhetorik in der Hohen Kaiserzeit
- Einleitung
- Quellenkapitel
- Das Verhältnis zwischen Philosophie und Rhetorik in der Hohen Kaiserzeit
- Die Darstellung des Verhältnisses zwischen Philosophie und Rhetorik in den Noctes Atticae
- Die Darstellung des Favorinus von Arelate
- Die Darstellung des Lukios Kalbenos Tauros
- Die Darstellung des Herodes Atticus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik in der Antike, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Ideal des Redners in Republik und Kaiserzeit.
- Die Geschichte der Rhetorik und ihr Verhältnis zur Philosophie
- Platons Kritik an der Rhetorik im Dialog "Gorgias"
- Ciceros Konzept des "orator perfectus" und dessen Bedeutung für die römische Gesellschaft
- Die Weiterentwicklung des Rednerideals bei Quintilian
- Die Auseinandersetzung mit Philosophie und Rhetorik in der Hohen Kaiserzeit anhand von Aulus Gellius' "Noctes Atticae"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert Platons Dialog "Gorgias" und zeigt die gegensätzlichen Positionen von Philosophie und Rhetorik auf. Das zweite Kapitel befasst sich mit Ciceros idealem Redner, dem "orator perfectus", und dessen Anforderungen an Bildung, Fähigkeiten und Moral. Das dritte Kapitel untersucht, wie Quintilian das Rednerideal weiterentwickelt und die Rolle des Redners in der Gesellschaft neu definiert. Das vierte Kapitel betrachtet die Darstellung des Verhältnisses zwischen Philosophie und Rhetorik in Aulus Gellius' "Noctes Atticae" und analysiert die Positionen verschiedener Rhetoriker der Hohen Kaiserzeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Rhetorik, Philosophie, Rednerideal, "orator perfectus", "vir bonus dicendi peritus", Antike, Republik, Kaiserzeit, Platon, Gorgias, Cicero, Quintilian, Aulus Gellius, "Noctes Atticae". Die Untersuchung fokussiert auf die Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis, dem Verhältnis von Bildung und Gesellschaft sowie den ethischen Dimensionen der Rhetorik.
- Quote paper
- GRIN Verlag (Hrsg.) (Editor), Svenja Schäfer (Author), Lisa Maria Koßmann (Author), Sebastian Flock (Author), 2024, Das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik in der Antike. Zum Ideal des Redners, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1455376