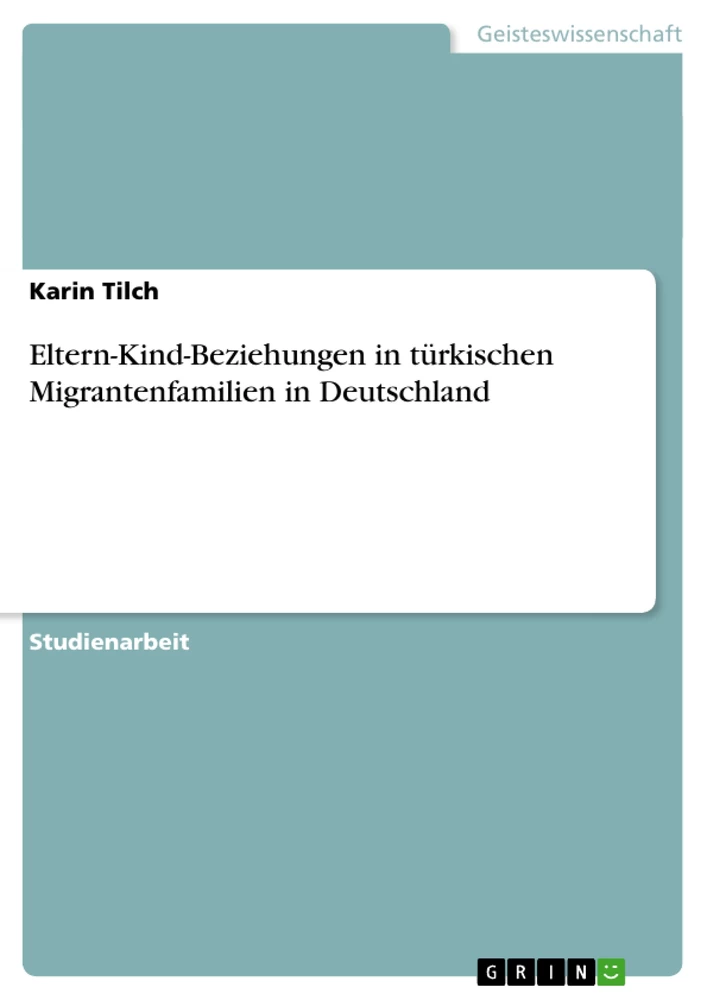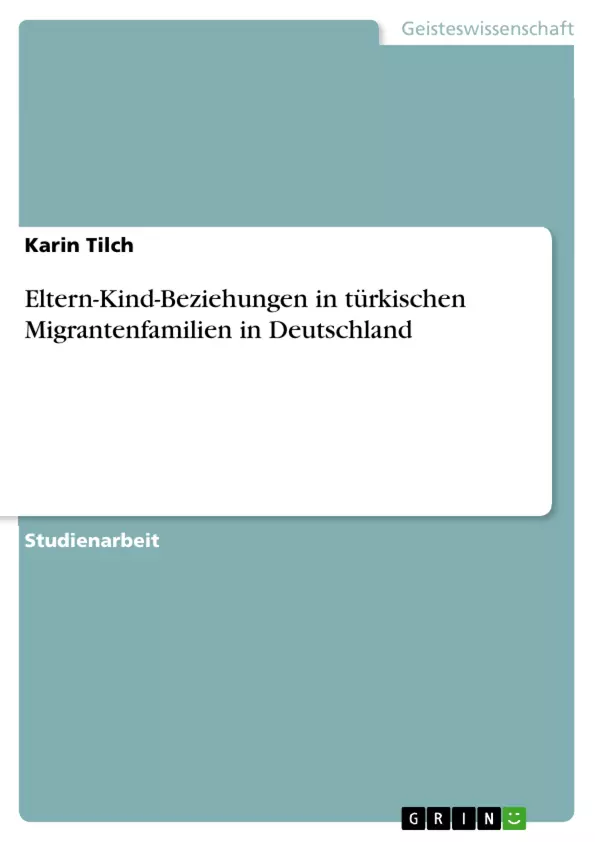Die größte Gruppe der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Migranten sind die türkischen Arbeitsmigranten. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist in dieser Bevölkerungsgruppe sehr hoch.
In der amerikanischen Soziologie sind Migranten schon früh zum Forschungsthema geworden. Im Mittelpunkt des Interesses standen Fragen nach der Assimilation und Integration, abweichendem erhalten und ethnischer Identität. In der deutschen Soziologie entstand dieser Forschungsschwerpunkt erst nach der Anwerbung der Gastarbeiter (ab 1955). Auch hier wurden ähnliche Fragen bearbeitet. Die Forschung orientiert sich dabei oft an den kulturellen und politischen Leitbildern westlicher Gesellschaften. (Beispielsweise in wiefern die Eingliederung gelingt.)
Auch die Jugendforschung hat sich in den letzten 20 Jahren zunehmend mit ausländischen Jugendlichen beschäftigt. Hier stehen vor allem Problemkonstellationen im Vordergrund. Dabei wird generell von einer strukturellen Benachteiligung und von einer Gefährdung der Identitätsbildung ausgegangen. Die Jugendlichen wachsen zwischen zwei Kulturen auf. Zum Teil müssen sie deshalb mit sehr gegensätzlichen Erwartungen umgehen. Hypothesen gehen von einer hohen Wahrscheinlichkeit für Kulturkonflikte aus. Aber auch Generationenkonflikte scheinen sehr wahrscheinlich, da die Jugendlichen stärker von den Werten des Aufnahmelandes geprägt werden als ihre Eltern.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Generationenbeziehungen in türkischen Migrantenfamilien in der Bundesrepublik Deutschland. Das Ziel ist die Determinanten, die die Eltern-Kind-Beziehungen beeinflussen zu beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familienform
- Erziehungsziele
- Geschlechtsrollenverständnis
- Bezugsgruppen und Freizeit
- Generationenkonflikte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eltern-Kind-Beziehungen in türkischen Migrantenfamilien in Deutschland. Ziel ist die Beschreibung der Determinanten, welche diese Beziehungen beeinflussen. Die Arbeit beleuchtet dabei die Auswirkungen der Migration auf traditionelle Familienstrukturen und -werte.
- Familienstrukturen und -formen in türkischen Migrantenfamilien
- Erziehungsvorstellungen und -praktiken
- Geschlechtsrollenverständnis und Arbeitsteilung
- Bedeutung von Bezugsgruppen und Freizeitaktivitäten
- Generationenkonflikte und ihre Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsstand zu Migrantenfamilien, insbesondere türkischen Familien in Deutschland, und fokussiert auf Assimilation, Integration, abweichendes Verhalten und ethnische Identität. Sie hebt die Forschungslücke hinsichtlich der Determinanten von Eltern-Kind-Beziehungen hervor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Bedeutung kultureller und politischer Leitbilder westlicher Gesellschaften in der Forschung wird kritisch beleuchtet, ebenso wie die gängige Fokussierung auf Problemkonstellationen in der Jugendforschung.
Familienform: Dieses Kapitel analysiert die Familienstruktur türkischer Migrantenfamilien in Deutschland im Vergleich zu deutschen Familien. Es beschreibt die prägende Rolle der traditionellen, oft großfamiliären Strukturen aus der ländlichen Türkei, die durch patriarchale Hierarchien und strikte Arbeitsteilung gekennzeichnet sind. Der hohe Stellenwert von Familie und Loyalität, die kollektivistische Orientierung und die gegenseitigen Abhängigkeiten werden hervorgehoben. Der Gegensatz zu den individualistisch geprägten Familienstrukturen der deutschen Gesellschaft wird deutlich gemacht. Es wird der "Funktionsverlust der Familie" in der deutschen Gesellschaft der "Renaissance des Familienverbandes" bei Migranten gegenübergestellt, wobei Identitätsstiftung in der Fremde als wichtiger Faktor betont wird. Der Einfluss von Migration auf Geburtenrate und Ausbildung der Frauen wird ebenfalls diskutiert, wobei der Rational-Choice-Ansatz zur Erklärung des Geburtenrückgangs herangezogen wird.
Schlüsselwörter
Türkische Migrantenfamilien, Eltern-Kind-Beziehungen, Familienstrukturen, Erziehungsziele, Geschlechtsrollen, Generationenkonflikte, Interkulturelle Sozialisation, Migration, Integration, Identität, Tradition, Modernisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Eltern-Kind-Beziehungen in türkischen Migrantenfamilien in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Eltern-Kind-Beziehungen in türkischen Migrantenfamilien in Deutschland und analysiert die Faktoren, welche diese Beziehungen beeinflussen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen der Migration auf traditionelle Familienstrukturen und -werte.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter Familienstrukturen und -formen, Erziehungsvorstellungen und -praktiken, Geschlechtsrollenverständnis und Arbeitsteilung, die Bedeutung von Bezugsgruppen und Freizeitaktivitäten sowie Generationenkonflikte und deren Ursachen. Es wird ein Vergleich zwischen türkischen Migrantenfamilien und deutschen Familien angestellt.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Familienform, Erziehungszielen, Geschlechtsrollenverständnis, Bezugsgruppen und Freizeit, Generationenkonflikten und einer Zusammenfassung. Die Einleitung beleuchtet den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise. Die weiteren Kapitel analysieren die jeweiligen Themen im Detail.
Wie wird die Familienform in der Hausarbeit dargestellt?
Das Kapitel "Familienform" vergleicht die Familienstrukturen türkischer Migrantenfamilien mit deutschen Familien. Es beschreibt traditionelle, oft großfamiliäre Strukturen aus der ländlichen Türkei, geprägt von patriarchalen Hierarchien und strikter Arbeitsteilung. Der hohe Stellenwert von Familie und Loyalität, die kollektivistische Orientierung und gegenseitige Abhängigkeiten werden im Gegensatz zu individualistischen deutschen Familienstrukturen hervorgehoben. Der Einfluss von Migration auf Geburtenrate und Frauenbildung wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt die Migration in der Analyse?
Die Migration spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht, wie die Migration traditionelle Familienstrukturen und -werte beeinflusst und welche Herausforderungen und Anpassungsprozesse sich daraus ergeben. Es wird der "Funktionsverlust der Familie" in der deutschen Gesellschaft dem "Renaissance des Familienverbandes" bei Migranten gegenübergestellt, wobei die Identitätsstiftung in der Fremde betont wird.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet unter anderem den Rational-Choice-Ansatz zur Erklärung des Geburtenrückgangs. Kritisch wird auch die gängige Fokussierung auf Problemkonstellationen in der Jugendforschung und die Bedeutung kultureller und politischer Leitbilder westlicher Gesellschaften in der Forschung beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Türkische Migrantenfamilien, Eltern-Kind-Beziehungen, Familienstrukturen, Erziehungsziele, Geschlechtsrollen, Generationenkonflikte, Interkulturelle Sozialisation, Migration, Integration, Identität, Tradition, Modernisierung.
Welche Forschungslücke schließt die Hausarbeit?
Die Arbeit hebt eine Forschungslücke hinsichtlich der Determinanten von Eltern-Kind-Beziehungen in türkischen Migrantenfamilien hervor. Bestehende Forschung wird kritisch beleuchtet, da sie oft Assimilation, Integration, abweichendes Verhalten und ethnische Identität im Vordergrund stellt.
- Quote paper
- Karin Tilch (Author), 2002, Eltern-Kind-Beziehungen in türkischen Migrantenfamilien in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145427