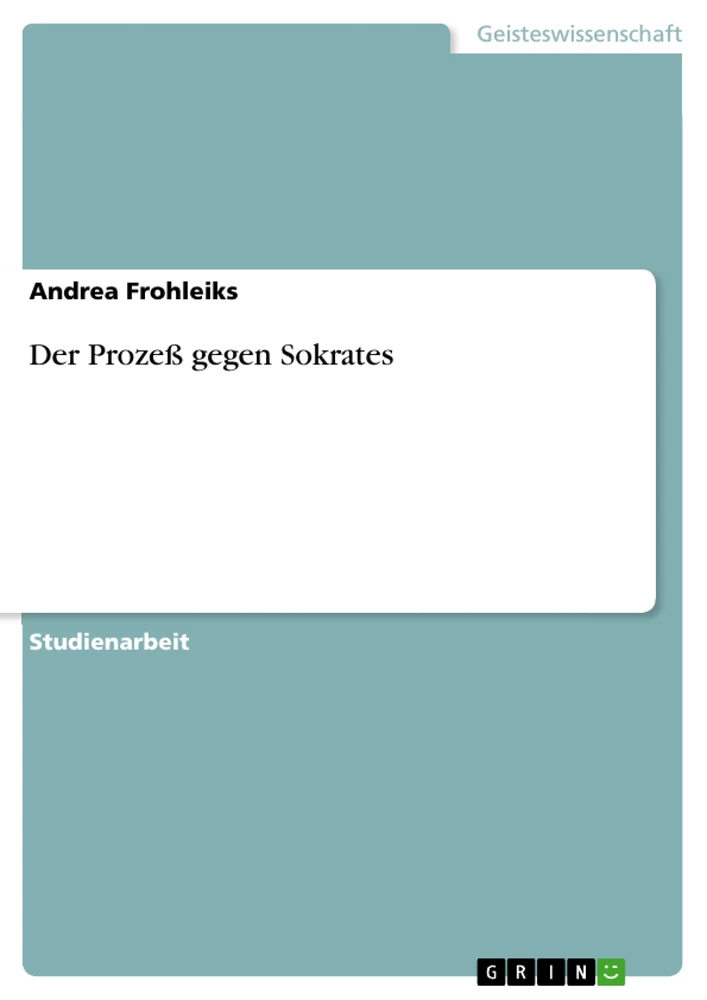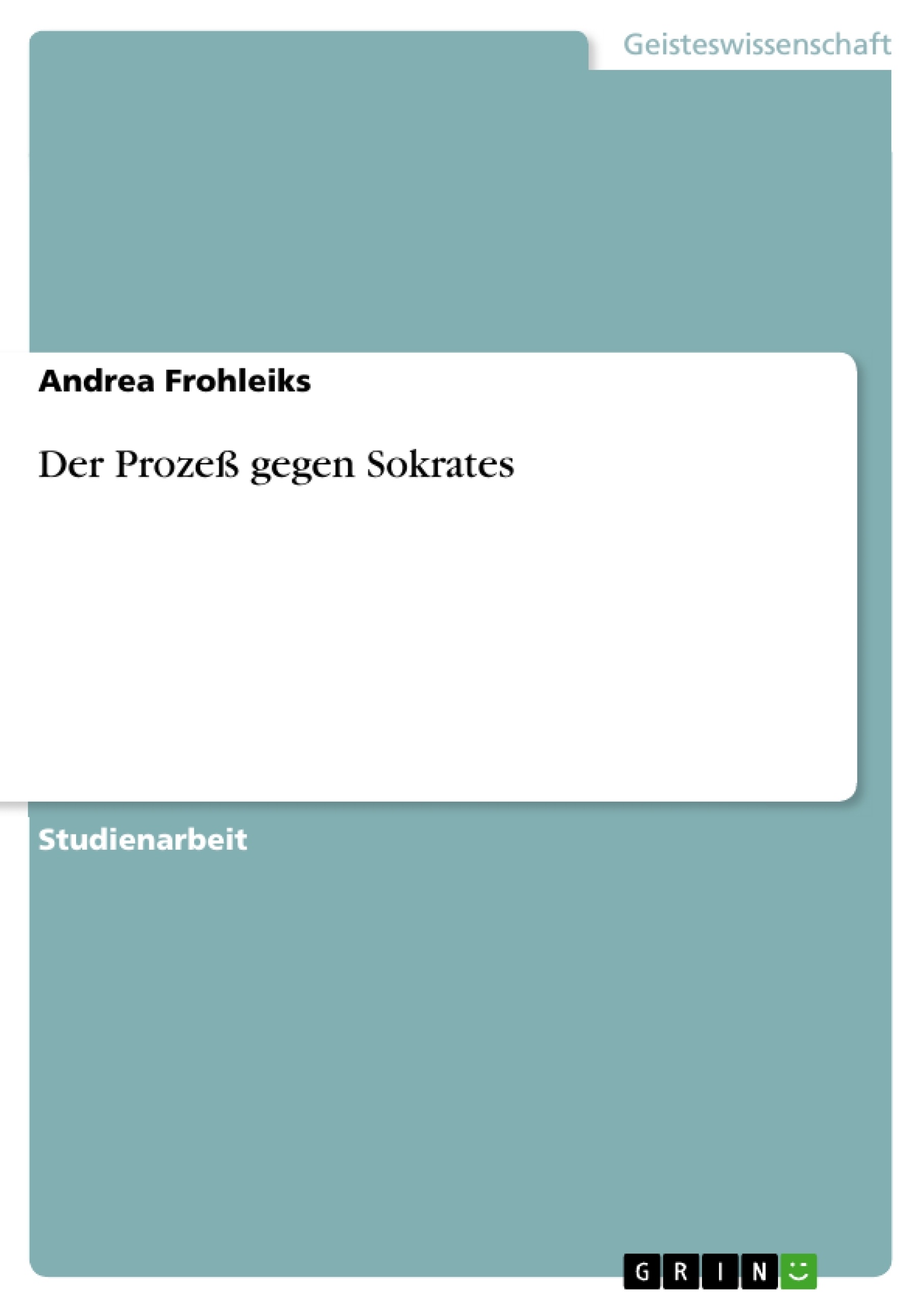Sokrates: das Urbild des Philosophen. Mit seiner Überleitung „in das rationale Denken der Philosophie“ kann er zu Recht als Begründer der Moderne und der mit ihr verbundenen abendländischen Philosophie bezeichnet werden. Legendär ist nicht nur die Lehre seines Nichtwissens („ich weiß, daß ich nichts weiß“) sondern auch sein spektakulärer Prozeß im Jahre 399 vor Christus mit der Verurteilung zum Tode durch den Schierlingsbecher.
Mit diesem Prozeß will sich die hier vorliegende Arbeit befassen. Dabei sollen weniger historische Fakten als der Philosoph Sokrates im Mittelpunkt stehen.
Da von Sokrates selbst keine niedergeschriebene Lehre existiert, ist man auf die Zeugnisse seiner Zeitgenossen angewiesen, will man sich der Person Sokrates und seiner Philosophie nähern. Diese Arbeit wird dabei auf Platons „Apologie des Sokrates“ und Xenophons „Erinnerungen an Sokrates“ zurückgreifen. Diese beiden Dokumente sind als Antwort der Sokrates-Verehrer auf die um das Jahr 392 vor Christus erschienene Pamphlete des Redners und Politikers Polykrates anzusehen. Mit dieser als einer von Anytos vorgebrachten Anklagerede fingierten Polemik sollte gegen den wachsenden Einfluß der Sokrates’ Schüler vorgegangen werden. Diese machten ihren Widerspruch durch Werke wie Platons „Apologie“ und Xenophons „Erinnerungen“ deutlich. Bei der Analyse der Dokumente von Platon und Xenophon muß immer im Blick behalten werden, daß keine dieser Sokrates-Darstellungen mit dem historischen Sokrates identifiziert werden darf: viel zu unterschiedlich fallen die verschiedenen Berichte über Sokrates aus. Vor allem bei Platon bleibt ungewiß, inwieweit dieser seinem Lehrer und Vorbild Sokrates seine eigene Lehre in den Mund gelegt hat. Bei dem Schiftsteller und Historiker Xenophon ist deshalb eine größere Historizität zu vermuten, andererseits ist relativ sicher, daß er sich Werke anderer Sokrates-Autoren zum Vorbild genommen hat, gerade da er selbst zur Zeit des Prozesses gegen Sokrates nicht in Athen zugegen gewesen ist.
Ziel dieser Arbeit wird es sein, ein Bild des Philosophen Sokrates bezüglich seines Prozesses zu zeichnen. Die Darstellung Platons durch Sokrates’ Reden vor dem Gerichtshof sowie die Beurteilung der Anklage durch Xenophon bilden dabei den Schwerpunkt. Als Ergänzungen sollen eine Präsentation des historischen Rahmens und ein Vergleich der platonischen und xenophontischen Schilderungen dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der Prozeß gegen Sokrates – Der historische Rahmen
- Platons „Apologie des Sokrates“
- Sokrates' Verteidigungsrede
- Verteidigungsstrategie
- Tätigkeit als Philosoph
- Verderbender Jugend
- Gottesleugnung und Daimonion
- Sokrates Vorschlag zum Strafmaß
- Vorschläge zum Strafmaß
- Todesauffassung
- Philosophische Tätigkeit
- Sokrates Rede nach seiner Verurteilung zum Tode
- Überzeugungen zur Gerechtigkeit
- Überlegungen zum Tod
- Sokrates' Verteidigungsrede
- Xenophons „Erinnerungen an Sokrates“
- Beurteilung der Anklage gegen Sokrates
- Anklage der Asebie
- Anklage wegen Verderbens der Jugend
- Darstellung des Sokrates im Rahmen seines Prozesses
- Beurteilung der Anklage gegen Sokrates
- Vergleich
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung des Philosophen Sokrates im Kontext seines Prozesses. Die Analyse von Platons Darstellung durch Sokrates' Reden vor Gericht und Xenophons Beurteilung der Anklage bilden den Schwerpunkt. Ergänzend werden der historische Rahmen und ein Vergleich der platonischen und xenophontischen Schilderungen präsentiert.
- Sokrates' Verteidigungsstrategie und seine philosophische Tätigkeit
- Die Anklagepunkte Asebie und Verführung der Jugend
- Der historische Kontext des Prozesses und die politische Situation Athens
- Vergleich der Darstellungen Sokrates bei Platon und Xenophon
- Sokrates' Todesauffassung und seine Überzeugungen zur Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und stellt Sokrates als Urbild des Philosophen und Begründer der Moderne dar. Es betont die Bedeutung seines Prozesses und die Abhängigkeit von den Zeugnissen seiner Zeitgenossen (Platon und Xenophon) für die Rekonstruktion seines Lebens und seiner Philosophie. Die unterschiedlichen Darstellungen und die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion des historischen Sokrates werden hervorgehoben.
Der Prozeß gegen Sokrates – der historische Rahmen: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess gegen Sokrates im Jahr 399 v. Chr., einschließlich der Anklagepunkte (Asebie und Verführung der Jugend), der beteiligten Personen (Meletos, Anytos, Lykon) und des Verfahrens vor der Heliaia. Es beleuchtet das athenische Rechtssystem und die Rolle der Bürger bei der Anklageerhebung und der Rechtsprechung. Der Kontext der politischen und gesellschaftlichen Situation Athens nach dem Peloponnesischen Krieg und die Spannung zwischen traditioneller und neuer Ethik werden erläutert, wobei Sokrates als Repräsentant eines neuen, rationalen Ethos dargestellt wird, das im Konflikt mit der traditionellen Ordnung stand.
Platons „Apologie des Sokrates“: Dieses Kapitel analysiert Platons Darstellung des Prozesses. Es wird auf die Verteidigungsrede Sokrates eingegangen, einschließlich seiner Strategien, seiner Darstellung seiner philosophischen Tätigkeit, der Widerlegung der Anklagepunkte und seines Vorschlags zum Strafmaß. Die unterschiedlichen Aspekte von Sokrates' Reden vor und nach der Verurteilung werden beleuchtet, insbesondere seine Überzeugungen zur Gerechtigkeit und seine Überlegungen zum Tod. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gesamtdarstellung und die zentralen Argumente Platons, ohne die Unterkapitel einzeln zusammenzufassen.
Xenophons „Erinnerungen an Sokrates“: Dieses Kapitel behandelt Xenophons Bericht über den Prozess und seine Beurteilung der Anklage gegen Sokrates. Es analysiert Xenophons Darstellung des Sokrates und seiner Philosophie im Kontext des Prozesses. Der Schwerpunkt liegt auf der Beurteilung der Anklagepunkte Asebie und Verführung der Jugend. Die Darstellung wird als Ganzes betrachtet, ohne einzelne Unterkapitel herauszugreifen. Der Unterschied zur Darstellung Platons wird implizit thematisiert.
Schlüsselwörter
Sokrates, Platon, Xenophon, Apologie, Erinnerungen, Asebie, Verführung der Jugend, Athen, Peloponnesischer Krieg, Philosophie, Demokratie, Rechtssystem, Ethik, Tradition, Moderne, Rationalität, Irrationalität.
Häufig gestellte Fragen zu: Platon und Xenophons Darstellung des Sokratischen Prozesses
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des Philosophen Sokrates im Kontext seines Prozesses im Jahr 399 v. Chr., basierend auf Platons „Apologie des Sokrates“ und Xenophons „Erinnerungen an Sokrates“. Sie untersucht die Verteidigungsstrategie Sokrates, die Anklagepunkte (Asebie und Verführung der Jugend), den historischen Kontext des Prozesses und vergleicht die beiden Darstellungen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquellen sind Platons „Apologie des Sokrates“ und Xenophons „Erinnerungen an Sokrates“. Die Arbeit analysiert die Reden Sokrates vor Gericht (Platon) und Xenophons Beurteilung der Anklage. Der historische Kontext des Prozesses wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Sokrates' Verteidigungsstrategie und seine philosophische Tätigkeit, die Anklagepunkte Asebie und Verführung der Jugend, den historischen Kontext des Prozesses (inkl. der politischen Situation Athens nach dem Peloponnesischen Krieg), den Vergleich der Darstellungen bei Platon und Xenophon sowie Sokrates' Todesauffassung und seine Überzeugungen zur Gerechtigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, ein Kapitel zum historischen Rahmen des Prozesses, Kapitel zu Platons und Xenophons Darstellungen, ein Vergleichskapitel und eine Schlussbemerkung. Die Kapitel zu Platon und Xenophon analysieren jeweils die wichtigsten Aspekte der jeweiligen Texte, ohne detailliert auf alle Unterkapitel einzugehen.
Was wird im Vorwort behandelt?
Das Vorwort führt in die Thematik ein, stellt Sokrates als Urbild des Philosophen dar und betont die Bedeutung seines Prozesses und die Herausforderungen bei der Rekonstruktion seines Lebens und seiner Philosophie aufgrund der unterschiedlichen Darstellungen bei Platon und Xenophon.
Was wird im Kapitel zum historischen Rahmen erläutert?
Dieses Kapitel beschreibt den Prozess detailliert, inklusive der Anklagepunkte, der beteiligten Personen und des athenischen Rechtssystems. Es beleuchtet den Kontext des Peloponnesischen Krieges und die Spannung zwischen traditioneller und neuer Ethik in Athen.
Wie wird Platons „Apologie“ analysiert?
Die Analyse von Platons „Apologie“ konzentriert sich auf Sokrates' Verteidigungsrede, seine philosophischen Argumente, die Widerlegung der Anklagepunkte und seinen Vorschlag zum Strafmaß. Seine Überzeugungen zur Gerechtigkeit und seine Überlegungen zum Tod werden ebenfalls behandelt.
Wie wird Xenophons Bericht analysiert?
Das Kapitel zu Xenophon analysiert dessen Darstellung des Prozesses und seine Beurteilung der Anklagepunkte Asebie und Verführung der Jugend. Der Fokus liegt auf Xenophons Darstellung Sokrates und seiner Philosophie im Kontext des Prozesses und dem impliziten Vergleich zu Platons Darstellung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sokrates, Platon, Xenophon, Apologie, Erinnerungen, Asebie, Verführung der Jugend, Athen, Peloponnesischer Krieg, Philosophie, Demokratie, Rechtssystem, Ethik, Tradition, Moderne, Rationalität, Irrationalität.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung wird in der Schlußbemerkung dargelegt und ist aus dem gegebenen Textfragment nicht ersichtlich.
- Quote paper
- M.A. Andrea Frohleiks (Author), 2002, Der Prozeß gegen Sokrates , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145404