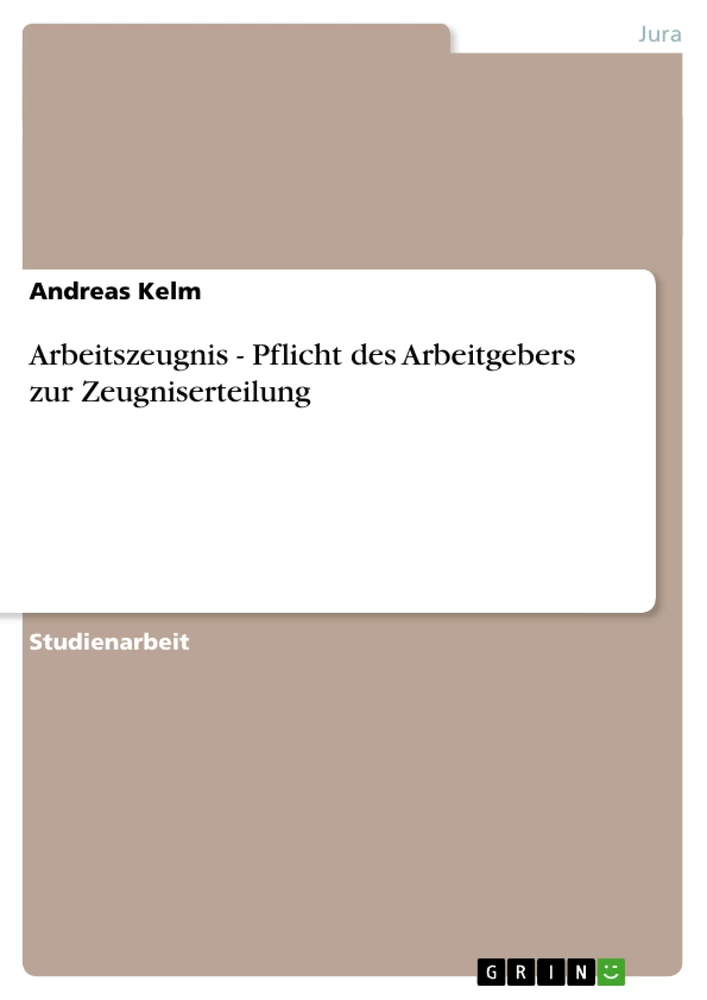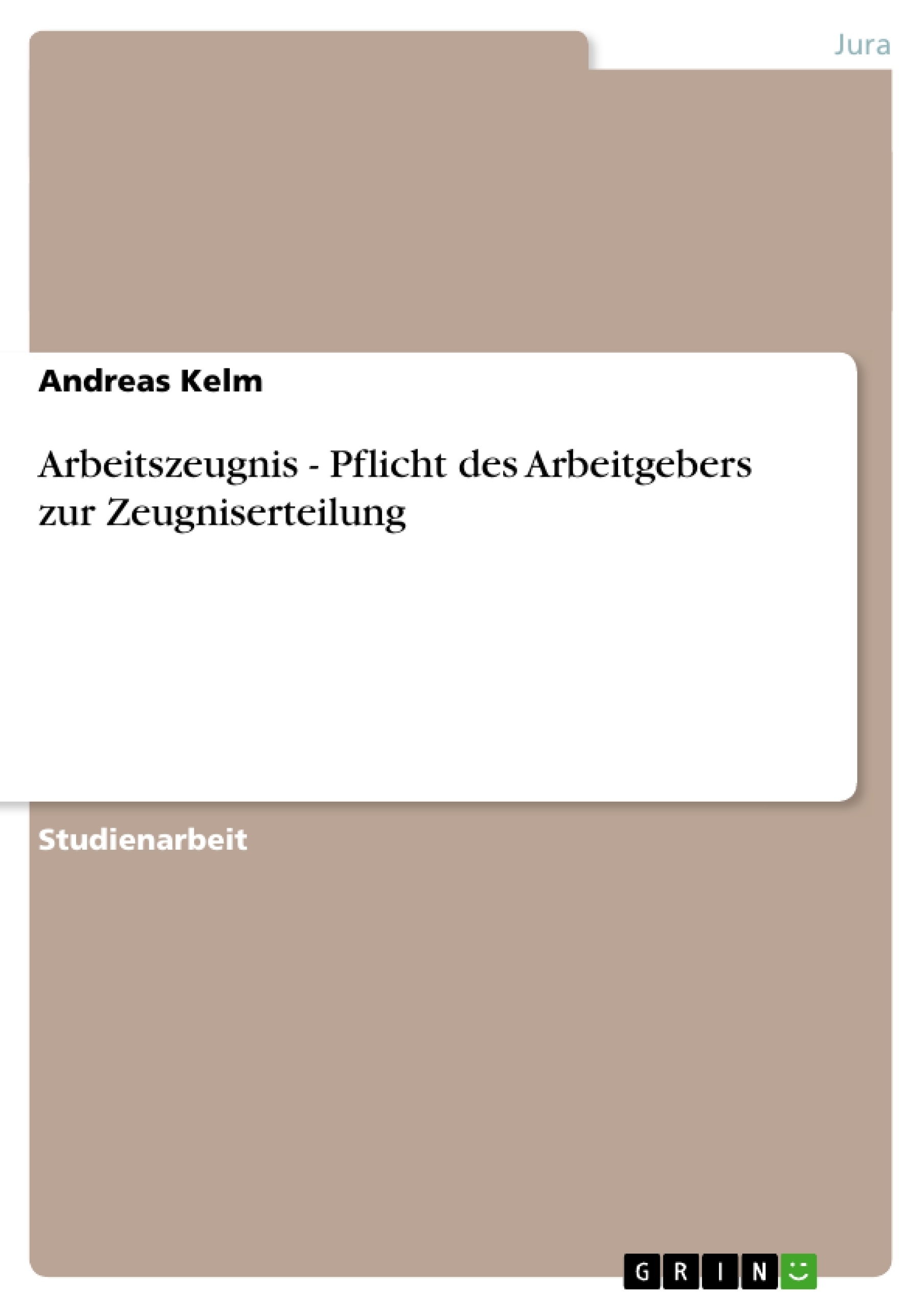Zeugnissen wird in der beruflichen Praxis eine große Bedeutung beigemessen. Sie dienen dem beruflichen Fortkommen des Bewerbers. Das setzt eine wohlwollende Beurteilung durch den Arbeitgeber voraus. Zeugnisse sind dabei Bewerbungsunterlage und gleichsam Visitenkarte eines Arbeitnehmers bei der Stellensuche. Der Arbeitnehmer hat mittels der Zeugnisse zum einen die Möglichkeit, seinen beruflichen Werdegang lückenlos nachzuweisen, zum anderen aber auch eine Bescheinigung über Führung und Leistung zu erbringen. Dabei soll dem neuen, potentiellen Arbeitgeber eine möglichst wahrheitsgemäße Unterrichtung über die fachlichen und persönlichen Qualifikationen des Bewerbers ermöglicht werden. Seit dem 01.01.2003 regelt § 109 GewO die allgemeine gesetzliche Grundlage für den Zeugnisanspruch, der nach § 6 Abs. 2 GewO für alle Arbeitnehmer gilt. Demgegenüber beschränkt § 630 S. 4 BGB den Anwendungsbereich auf Dienstverhältnisse. Bei der Erfüllung des Zeugnisanspruchs hat der Arbeitnehmer die Wahl zwischen einem sog. einfachen Zeugnis (§ 109 Abs.1 S. 2 GewO), das nur Angaben über die Art und die Dauer des Arbeitsverhältnisses enthält und einem sog. qualifizierten Zeugnis (§ 109 Abs.1 S.3 GewO), das sich auf die Führung und Leistung des Arbeitnehmers erstreckt.
B. Kapitel 1 – Entstehung des Zeugnisanspruchs
Entstehung und Fälligkeit des Zeugnisanspruchs
Da der Arbeitnehmer das Zeugnis i.d.R. benötigt, um sich für eine neue Stelle zu bewerben, entsteht der Anspruch auf ein Zeugnis nicht erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sondern über den Wortlaut des § 109 GewO („bei Beendigung“) hinaus bereits mit Zugang der Kündigung und ist dann auch sofort fällig. Auch wenn sich die Parteien in einem laufenden Kündigungsschutzprozess über die Rechtmäßigkeit der Kündigung streiten, steht es einem Zeugnisanspruch nicht entgegen. Desweiteren darf sich der Arbeitgeber bei laufendem Kündigungsschutzverfahren auch nicht auf ein Zwischenzeugnis beschränken. Die Zeugniserteilung ist eine Holschuld, deshalb muss das Zeugnis vom AN beim AG abgeholt werden (§ 269 BGB). Jedoch kann der AG im Einzelfall verpflichtet sein, das Zeugnis dem AN nachzuschicken, wenn die Abholung für den AN mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder besonderen Mühen verbunden wäre. Solche Gründe würden bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dann vorliegen, wenn das Zeugnis trotz Verlangen des AN nicht rechtzeitig vom AG bereitgestellt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung und Rechtsgrundlagen
- B. Kapitel 1 – Entstehung des Zeugnisanspruchs
- C. Kapitel 2 - Zeugnisarten
- I. Leistung
- II. Verhalten
- D. Kapitel 3 – Maßgebliche Grundsätze
- E. Kapitel 4 - Ansprüche des Arbeitnehmers
- F. Kapitel 5 - Verjährung, Verwirkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die rechtliche Pflicht des Arbeitgebers zur Zeugniserteilung. Sie analysiert die Entstehung des Zeugnisanspruchs, die verschiedenen Zeugnisarten und die maßgeblichen Grundsätze für die Zeugnisgestaltung. Zudem werden die Ansprüche des Arbeitnehmers sowie die Themen Verjährung und Verwirkung im Zusammenhang mit der Zeugniserteilung beleuchtet.
- Entstehung des Zeugnisanspruchs
- Verschiedene Zeugnisarten
- Maßgebliche Grundsätze für die Zeugnisgestaltung
- Ansprüche des Arbeitnehmers
- Verjährung und Verwirkung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 – Entstehung des Zeugnisanspruchs
Dieses Kapitel behandelt die Entstehung und Fälligkeit des Zeugnisanspruchs. Der Anspruch entsteht bereits mit Zugang der Kündigung und ist dann sofort fällig, da der Arbeitnehmer das Zeugnis in der Regel für Bewerbungen benötigt. Auch ein laufendes Kündigungsschutzverfahren steht dem Zeugnisanspruch nicht entgegen. Der Arbeitgeber darf sich in diesem Fall nicht auf ein Zwischenzeugnis beschränken.
Kapitel 2 - Zeugnisarten
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Zeugnissen. Es werden das einfache Zeugnis, das nur Angaben über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses enthält, und das qualifizierte Zeugnis, das sich auf die Führung und Leistung des Arbeitnehmers erstreckt, erläutert. Die Kapitel betrachten zudem die Inhalte eines Zeugnisses, die sich auf Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers beziehen.
Kapitel 3 – Maßgebliche Grundsätze
Dieses Kapitel untersucht die maßgeblichen Grundsätze für die Zeugniserteilung. Es werden die rechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers hinsichtlich der Zeugnisgestaltung beleuchtet. Diese umfassen u.a. die Pflicht zur Wahrheitstreue, zur wohlwollenden Beurteilung und zur Vermeidung von negativen Formulierungen.
Kapitel 4 - Ansprüche des Arbeitnehmers
Dieses Kapitel beleuchtet die Ansprüche des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit der Zeugniserteilung. Es werden die rechtlichen Möglichkeiten des Arbeitnehmers zur Durchsetzung seiner Ansprüche, wie z.B. die Möglichkeit, eine Zeugnisberichtigung zu verlangen, beschrieben.
Kapitel 5 - Verjährung, Verwirkung
Dieses Kapitel befasst sich mit den Themen Verjährung und Verwirkung im Zusammenhang mit dem Zeugnisanspruch. Es wird erläutert, wann der Anspruch des Arbeitnehmers auf ein Zeugnis verjährt und welche Voraussetzungen für die Verwirkung des Anspruchs erfüllt sein müssen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rechtsgrundlagen und die praktische Bedeutung der Zeugniserteilung im Arbeitsrecht. Sie analysiert die Entstehung des Zeugnisanspruchs, die verschiedenen Zeugnisarten, die Gestaltungsrichtlinien für Zeugnisse und die Ansprüche des Arbeitnehmers. Die Arbeit befasst sich zudem mit den Themen Verjährung und Verwirkung im Zusammenhang mit dem Zeugnisanspruch.
- Quote paper
- Andreas Kelm (Author), 2009, Arbeitszeugnis - Pflicht des Arbeitgebers zur Zeugniserteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145312