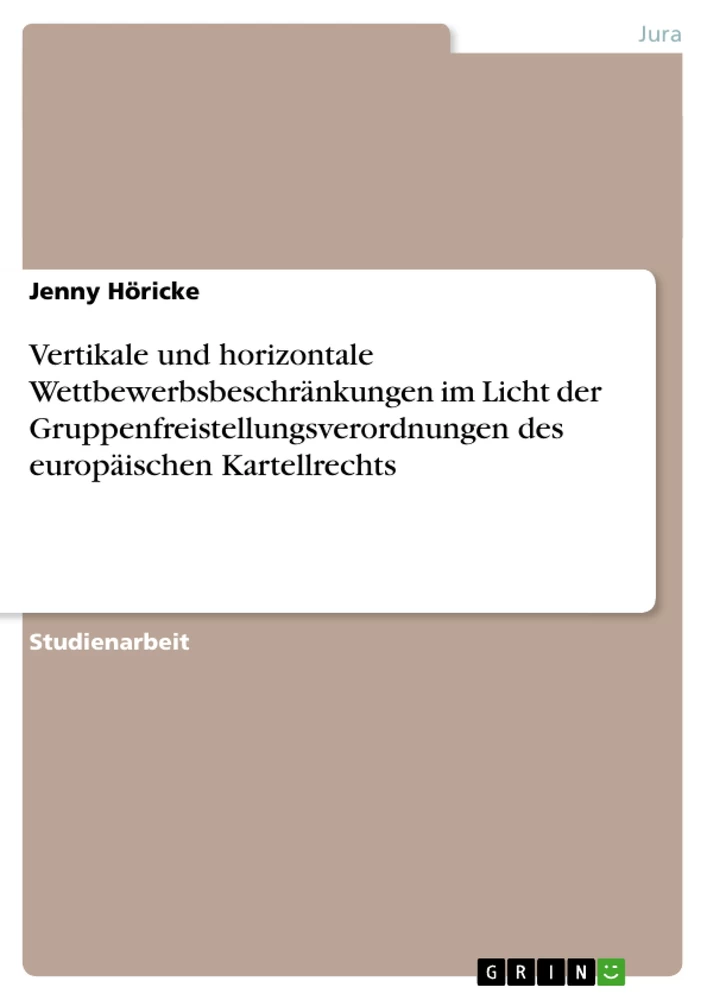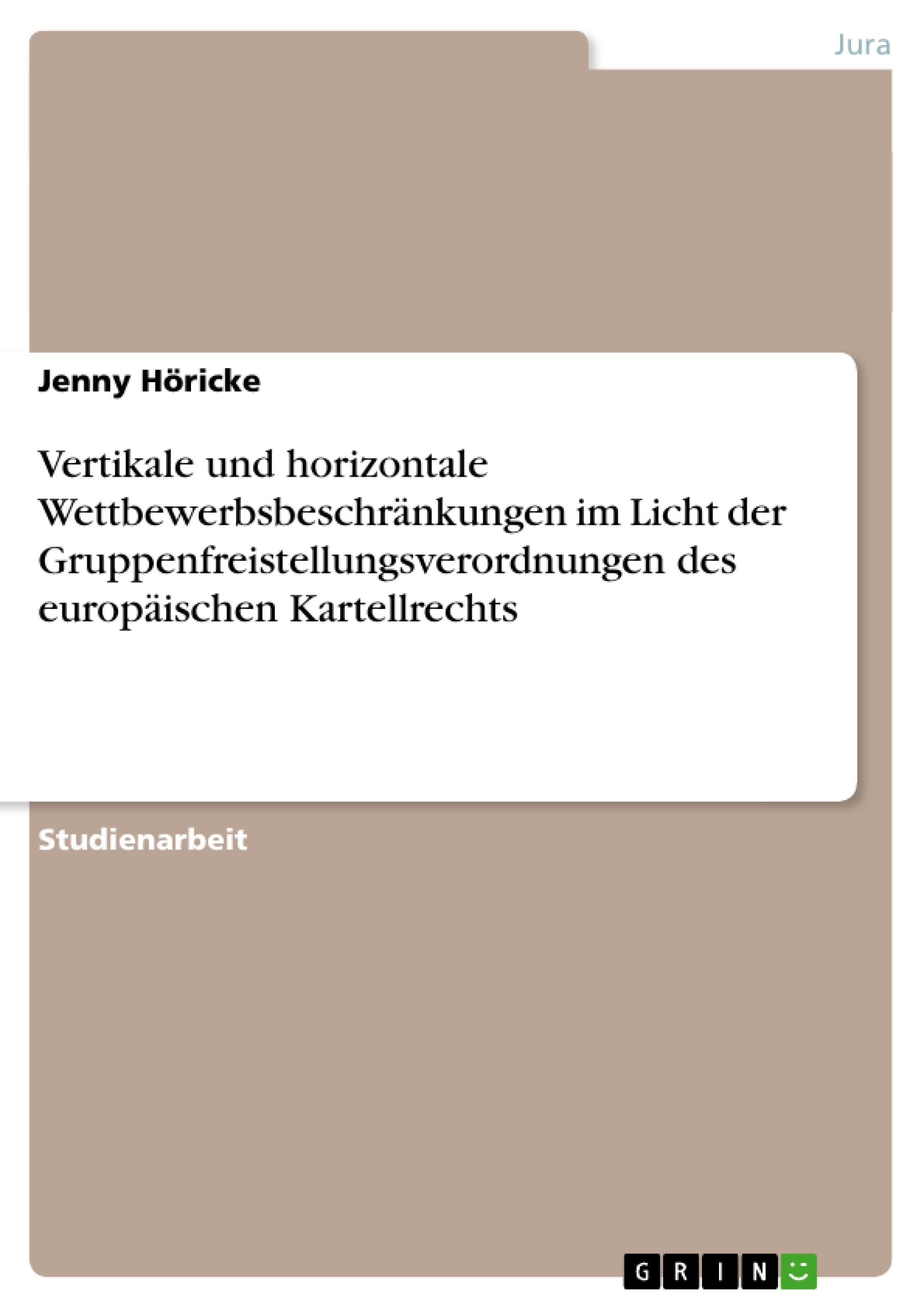Durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (im Folgenden: EG) haben
die Mitgliedsstaaten in ihren Grundsätzen festgelegt, dass es Aufgabe der Gemeinschaft ist,
ein System zu schaffen, welches den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes vor
Verfälschungen schützt und einen hohen Grad an Wettbewerbsfähigkeit fördern soll, vgl.
Art. 3 I lit. g EG und Art. 2 EG.
Wettbewerb entsteht in der Regel dort, wo Rechtssubjekte von ihrer Handlungsfreiheit im
Wirtschaftsverkehr Gebrauch machen1. Ein funktionsfähiger Wirtschaftsverkehr hängt hierbei
entscheidend von dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, Konkurrenz und
Privatautonomie ab. Wettbewerb ist somit ein komplexes System, welches durch die
vorhandene Wirtschaftsordnung und die gewährten wirtschaftlichen Freiheitsrechte
maßgeblich beeinflusst wird. Sobald ein fairer und ausgewogener Wettbewerb zwischen
Konkurrenten am europäischen oder nationalen Markt nicht mehr möglich ist, liegt eine
Wettbewerbsbeschränkung vor.
Das Thema dieser Arbeit setzt sich mit horizontalen und vertikalen
Wettbewerbsbeschränkungen unter Berücksichtigung der Gruppenfreistellungsverordnungen
(im Folgenden: GVO) der Europäischen Kommission auseinander. Hierfür werden die
grundlegenden europäischen Wettbewerbsregeln vorgestellt und ein Überblick über das
Kartellverbot des Art. 81 I EG gegeben, um anschließend auf die horizontalen und vertikalen
Wettbewerbsbeschränkungen und ihren Wirkungen am europäischen Binnenmarkt
einzugehen. Die Arbeit endet dann mit Ausführungen zu einzelnen ausgewählten GVO der
Europäischen Kommission (im Folgenden: Kommission).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Europäische Wettbewerbsregeln
- A. Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates
- B. Kartellverbot Art. 81 I EG
- 1. Adressaten
- 2. Tatbestandliche Handlung
- 3. Bezwecken oder Bewirken einer Wettbewerbsbeschränkung
- 4. Zusammenfassung
- C. Gruppenfreistellungsverordnung
- D. Leitlinien der Kommission
- E. Reaktion des deutschen Kartellrechts
- F. Fazit
- III. Wettbewerbsbeeinträchtigungen
- A. Horizontale Vereinbarungen
- B. Vertikale Vereinbarungen
- 1. Positive Wirkung von Vertikalvereinbarungen
- 2. Negative Wirkungen von Vertikalvereinbarungen
- 3. Beurteilung von Vertikalvereinbarungen
- C. Fazit
- IV. Freistellung durch eine GVO
- A. GVO für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
- 1. Vertikal-GVO
- 2. VO Nr. 1400/2002 über vertikale Vereinbarungen im Kfz-Sektor
- 3. GVO Nr. 772/2004 über Technologietransfer-Vereinbarungen
- B. GVO für horizontale Vereinbarungen
- 1. GVO Nr. 2658/2000 über Spezialisierungsvereinbarungen
- 2. GVO Nr. 2659/2000 über Vereinbarungen über FuE
- C. Fazit
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert horizontale und vertikale Wettbewerbsbeschränkungen im Kontext der Gruppenfreistellungsverordnungen (GVO) der Europäischen Kommission. Sie beleuchtet die grundlegenden europäischen Wettbewerbsregeln, insbesondere das Kartellverbot des Art. 81 I EG, und untersucht die Auswirkungen horizontaler und vertikaler Vereinbarungen auf den europäischen Binnenmarkt. Die Arbeit behandelt außerdem ausgewählte GVO der Europäischen Kommission.
- Europäische Wettbewerbsregeln und das Kartellverbot des Art. 81 I EG
- Horizontale und vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
- Wirkungen von Wettbewerbsbeschränkungen auf den europäischen Binnenmarkt
- Gruppenfreistellungsverordnungen (GVO) der Europäischen Kommission
- Bedeutung der GVO für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Wettbewerbsbeschränkungen ein und erläutert die Bedeutung eines funktionsfähigen Wettbewerbs für den europäischen Binnenmarkt. Sie stellt den Fokus der Arbeit auf horizontale und vertikale Wettbewerbsbeschränkungen im Kontext der Gruppenfreistellungsverordnungen (GVO) der Europäischen Kommission dar.
- II. Europäische Wettbewerbsregeln: Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden europäischen Wettbewerbsregeln, darunter das Kartellverbot des Art. 81 I EG, das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und die Zusammenschlusskontrolle. Es bietet außerdem einen Überblick über die relevanten deutschen Vorschriften, wie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
- III. Wettbewerbsbeeinträchtigungen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswirkungen horizontaler und vertikaler Vereinbarungen auf den Wettbewerb. Es untersucht sowohl die positiven als auch die negativen Folgen dieser Vereinbarungen für den europäischen Binnenmarkt.
- IV. Freistellung durch eine GVO: Dieses Kapitel analysiert die Freistellung von bestimmten Wettbewerbsbeschränkungen durch GVO. Es beleuchtet die wichtigsten GVO für vertikale und horizontale Vereinbarungen, darunter die Vertikal-GVO, die GVO Nr. 1400/2002 über vertikale Vereinbarungen im Kfz-Sektor und die GVO Nr. 772/2004 über Technologietransfer-Vereinbarungen. Außerdem werden die GVO Nr. 2658/2000 über Spezialisierungsvereinbarungen und die GVO Nr. 2659/2000 über Vereinbarungen über FuE behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: horizontale Wettbewerbsbeschränkungen, vertikale Wettbewerbsbeschränkungen, Gruppenfreistellungsverordnungen (GVO), europäisches Kartellrecht, Art. 81 I EG, europäischer Binnenmarkt, Wettbewerbsverzerrung, Handlungsfreiheit, Marktbeherrschung, FuE-Vereinbarungen, Technologietransfer, Spezialisierungsvereinbarungen, Kfz-Sektor, selektiver Vertrieb, Preisbindung, Gebietsvereinbarungen.
- Quote paper
- Jenny Höricke (Author), 2008, Vertikale und horizontale Wettbewerbsbeschränkungen im Licht der Gruppenfreistellungsverordnungen des europäischen Kartellrechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145242