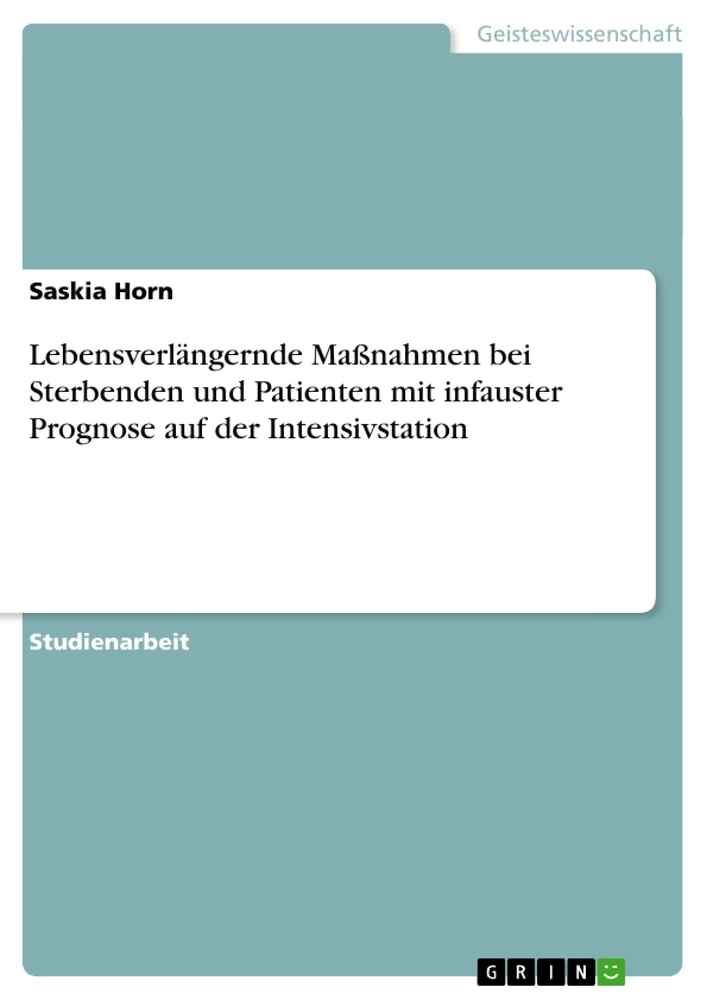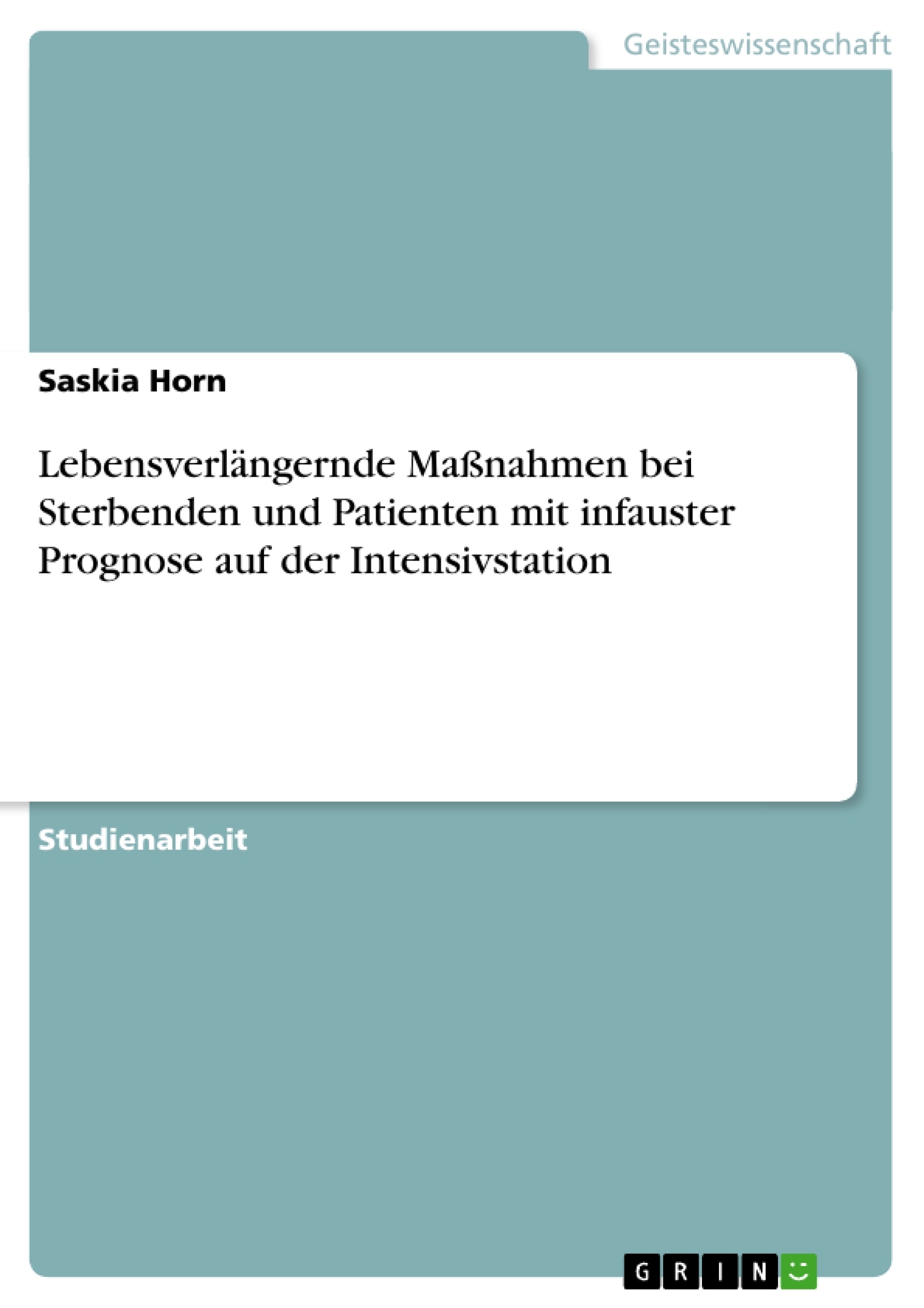Mit dem Ausbau der Intensivmedizin besitzen wir immer weitreichendere Möglichkeiten zur Behandlung von Schwerstkranken, Schwerstverletzten und Schwerstvergifteten.
Patienten mit lebensbedrohlichen Störungen vitaler Körperfunktionen befinden sich an der Grenze ihrer Existenzmöglichkeit und bedürfen daher einer fortlaufenden Überwachung, Pflege und Behandlung. Durch die Verfügbarkeit eines vielfältigen, für den Laien kaum vorstellbaren personellen und materiellen Aufwands lassen sich so Erfolge erzielen, an die man noch vor zwei Jahrzehnten kaum zu denken wagte. Die Lebenserwartung ist so in den letzten 120 Jahren um das Doppelte angestiegen.
Angesichts der Apparatemedizin haben jedoch viele Patienten Angst vor Verlängerung des Lebens um jeden Preis. Typische Fragen, die sich an dieser Stelle ergeben, sind etwa:
Sollte eine Lebensverlängerung mit allen Mitteln und Konsequenzen durchgeführt werden?
Und werden neben Prinzipien der medizinischen Wissenschaft Dimensionen wie Würde der Person, Selbstbestimmungsrecht, Gemeinwohl und Individualität überhaupt genügend Beachtung geschenkt?
Diese Fragen spiegeln sich in einer veränderten Einstellung der Menschen zum Tode wieder. War die klassische große Sorge eines jeden Menschen, unvorbereitet und überraschend zu sterben, so überwiegt bei vielen heute die Angst vor einem lange dauernden Leiden, das sinnlos scheint.
Ich möchte herausarbeiten, ob es ethisch vertretbar ist, in allen Fällen alle medizinisch- technischen Möglichkeiten auszuschöpfen und so das Leben eines Menschen zu erhalten. Gibt es Situationen, in denen man einen Menschen sterben lassen darf oder sogar muss?
Wann und unter welchen Umständen darf und soll der Mediziner die Behandlung etwa mit Operationen, intensivmedizinischen Maßnahmen oder Medikamenten einstellen oder beschränken, wenn ein Aufhalten des Sterbens nicht zu erwarten ist?
Es gibt kein Patentrezept zur Sicherung der Menschenrechte in der medizinischen Versorgung. Ziel dieser Arbeit soll sein, den Weg der Entscheidungsfindung für oder gegen passive Sterbehilfe unter ethischen Gesichtspunkten zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Historischer Wandel im Umgang mit schwerkranken Patienten
- 3. Die passive Sterbehilfe
- 3.1 Die infauste Prognose
- 3.2 Definition passive Sterbehilfe
- 3.3 Rechtliche Aspekte des ärztlichen Handelns in Zusammenhang mit lebensverlängernden Maßnahmen
- 3.4 Wirtschaftliche Aspekte
- 3.5 Problem der Abgrenzung zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe
- 4. Beispiel aus der Praxis
- 5. Die ethische Entscheidungssituation
- 5.1 Das moralische Dilemma
- 5.2 Die Entscheidung über Abbruch oder Weiterführung von lebenserhaltenden Maßnahmen
- 5.2.1 Der mutmaßliche Wille des Patienten ist bekannt
- 5.2.2 Der Wille des Patienten ist nicht bekannt
- 5.3 Die ethische Entscheidung des Arztes
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die ethischen Aspekte lebensverlängernder Maßnahmen bei Patienten mit infauster Prognose auf der Intensivstation. Der Fokus liegt auf der passiven Sterbehilfe und der Entscheidungsfindung im Kontext medizinischer Möglichkeiten, Patientenwille und moralischen Dilemmata. Die Arbeit beleuchtet den historischen Wandel im Umgang mit Sterbenden und analysiert die rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen.
- Ethische Bewertung lebensverlängernder Maßnahmen
- Der historische Wandel im Umgang mit Sterbenden
- Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der passiven Sterbehilfe
- Das moralische Dilemma der Entscheidungsfindung
- Der Patientenwille und seine Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit stellt die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit der Anwendung aller medizinisch-technischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung, insbesondere auf Intensivstationen. Sie thematisiert die Konflikte zwischen der Verlängerung des Lebens um jeden Preis und der Berücksichtigung von Würde, Selbstbestimmung und dem Wohlbefinden des Patienten. Die Angst vor einem sinnlosen, langen Leiden wird als wichtiger Aspekt der veränderten Einstellung zum Tod hervorgehoben. Die Arbeit konzentriert sich auf passive Sterbehilfe und die Frage, wann eine Therapie eingestellt werden sollte, um unnötiges Leiden zu vermeiden.
2. Historischer Wandel im Umgang mit schwerkranken Patienten: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Wandel in der Medizin und im Umgang mit Sterbenden. Es zeigt die Entwicklung von der Sichtweise des 17. Jahrhunderts, in der Lebensverlängerung ein längeres Leben in Gesundheit bedeutete, hin zur modernen Apparatemedizin mit ihren weitreichenden Möglichkeiten. Der Fokus liegt auf dem Fortschritt in der Intensivmedizin und der damit einhergehenden Steigerung der Erfolgsquote bei der Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen. Es werden historische Ansichten zum Thema Sterben und die Entwicklung der Intensivmedizin kontrastiert.
3. Die passive Sterbehilfe: Dieses Kapitel definiert die passive Sterbehilfe und den Begriff der "infausten Prognose". Es beleuchtet die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des ärztlichen Handelns im Zusammenhang mit lebensverlängernden Maßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe. Der Fokus liegt auf der Situation, in der trotz aller medizinischen Bemühungen kein Erfolg zu erwarten ist und die Frage, ob ein Therapieverzicht in solchen Fällen ethisch vertretbar ist. Das Kapitel betont die Bedeutung des Konsenses mehrerer Ärzte und Pflegender bei der Feststellung eines unumkehrbaren Sterbeprozesses.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Ethische Aspekte lebensverlängernder Maßnahmen
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die ethischen Aspekte lebensverlängernder Maßnahmen bei Patienten mit infauster Prognose auf der Intensivstation. Der Schwerpunkt liegt auf der passiven Sterbehilfe und der Entscheidungsfindung in Bezug auf medizinische Möglichkeiten, Patientenwillen und moralische Dilemmata. Die Arbeit beleuchtet den historischen Wandel im Umgang mit Sterbenden und analysiert die rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Ethische Bewertung lebensverlängernder Maßnahmen, den historischen Wandel im Umgang mit Sterbenden, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der passiven Sterbehilfe, das moralische Dilemma der Entscheidungsfindung, sowie den Patientenwillen und seine Bedeutung.
Was versteht die Hausarbeit unter passiver Sterbehilfe?
Die Hausarbeit definiert passive Sterbehilfe und den Begriff der "infausten Prognose". Sie beleuchtet die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des ärztlichen Handelns im Zusammenhang mit lebensverlängernden Maßnahmen und die Abgrenzung zu aktiver und indirekter Sterbehilfe. Der Fokus liegt auf Situationen, in denen trotz aller medizinischen Bemühungen kein Erfolg zu erwarten ist und der Frage, ob ein Therapieverzicht ethisch vertretbar ist. Die Bedeutung des Konsenses mehrerer Ärzte und Pflegender bei der Feststellung eines unumkehrbaren Sterbeprozesses wird betont.
Wie wird der historische Wandel im Umgang mit schwerkranken Patienten dargestellt?
Das Kapitel zum historischen Wandel beschreibt die Entwicklung von der Sichtweise des 17. Jahrhunderts (Lebensverlängerung bedeutete längeres Leben in Gesundheit) hin zur modernen Apparatemedizin. Es zeigt den Fortschritt in der Intensivmedizin und die damit einhergehende Steigerung der Erfolgsquote bei der Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen. Historische Ansichten zum Thema Sterben und die Entwicklung der Intensivmedizin werden kontrastiert.
Welche Rolle spielt der Patientenwille in der Entscheidungsfindung?
Der Patientenwille und seine Bedeutung sind ein zentraler Aspekt der Hausarbeit. Die Arbeit differenziert zwischen Situationen, in denen der mutmaßliche Wille des Patienten bekannt ist und solchen, in denen er nicht bekannt ist. Dies spielt eine entscheidende Rolle bei der ethischen Bewertung der Entscheidung über den Abbruch oder die Weiterführung lebenserhaltender Maßnahmen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst folgende Kapitel: Problemstellung, Historischer Wandel im Umgang mit schwerkranken Patienten, Die passive Sterbehilfe (inkl. Unterkapitel zu infauster Prognose, rechtlichen Aspekten, wirtschaftlichen Aspekten und Abgrenzung zu anderen Formen der Sterbehilfe), Beispiel aus der Praxis, Die ethische Entscheidungssituation (inkl. Unterkapitel zum moralischen Dilemma und der Entscheidungsfindung), und Fazit.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit?
Die Zusammenfassung der Schlussfolgerungen (Fazit) ist im bereitgestellten Text nicht enthalten. Weitere Informationen hierzu müssten der vollständigen Hausarbeit entnommen werden.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Die wirtschaftlichen Aspekte im Zusammenhang mit lebensverlängernden Maßnahmen und passiver Sterbehilfe werden in einem eigenen Unterkapitel behandelt. Genaueres hierzu ist im bereitgestellten Textfragment nicht aufgeführt, es muss der vollständigen Hausarbeit entnommen werden.
Welche rechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die rechtlichen Aspekte des ärztlichen Handelns im Zusammenhang mit lebensverlängernden Maßnahmen werden im Kapitel zur passiven Sterbehilfe behandelt. Konkrete Details sind im vorliegenden Textfragment nicht enthalten und müssen der vollständigen Hausarbeit entnommen werden.
- Quote paper
- Saskia Horn (Author), 2009, Lebensverlängernde Maßnahmen bei Sterbenden und Patienten mit infauster Prognose auf der Intensivstation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145155