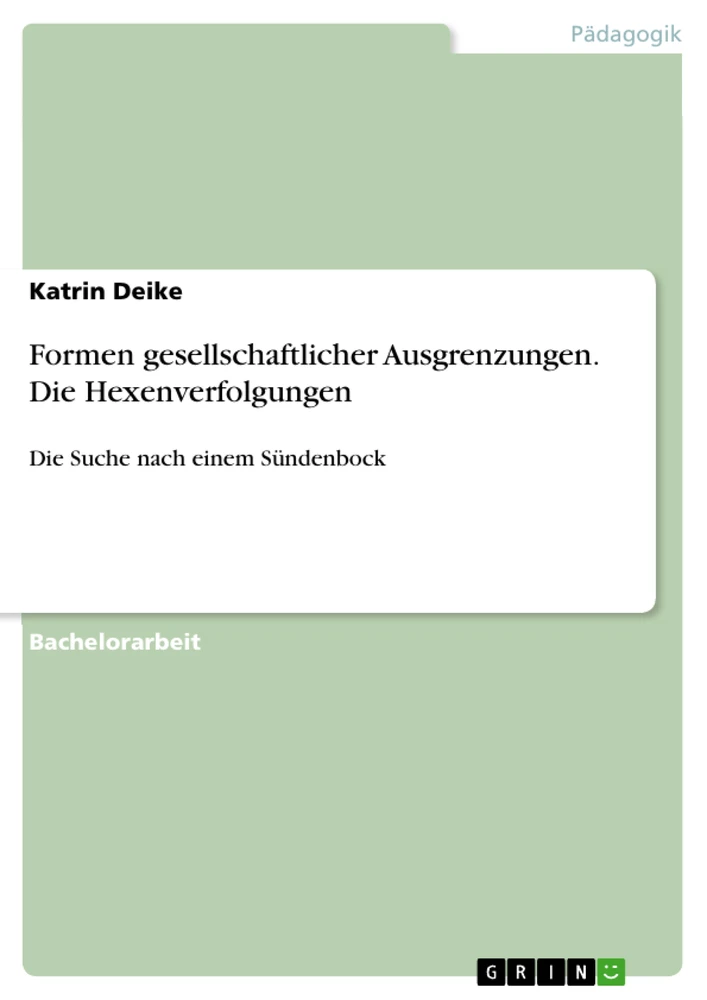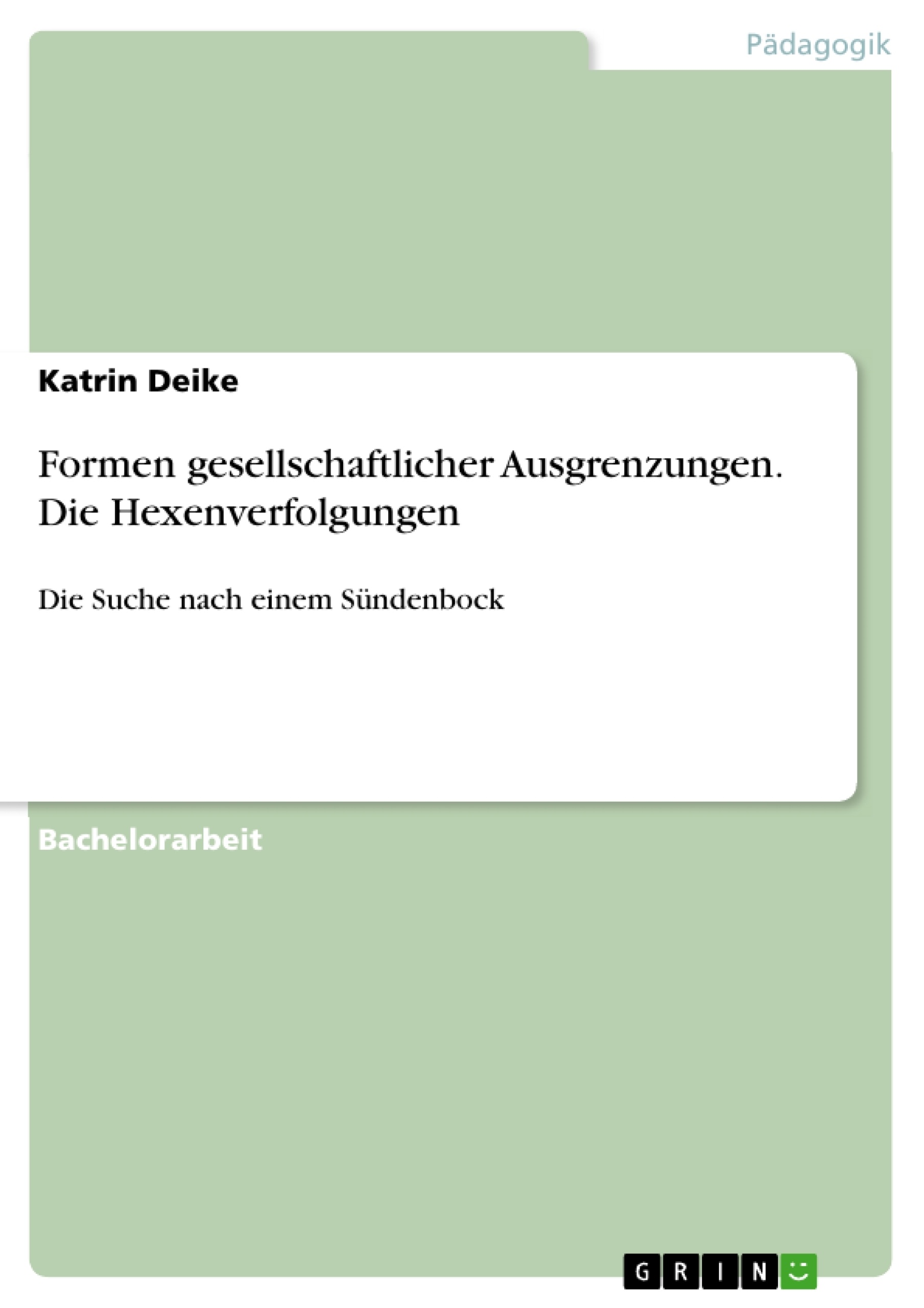Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, das Phänomen der Hexenverfolgungen zu erforschen. Zum einen liegt der Schwerpunkt auf dem inhaltlichen Aspekt, d.h. auf der gesellschaftlichen Ausgrenzung derer, die der Hexerei bzw. Zauberei angeklagt wurden. Zum anderen soll genauer analysiert werden, welche Möglichkeiten sich für den Einsatz im Geschichtsunterricht bieten, diese Thematik anschaulich darzustellen, d.h. wie sie den SuS methodisch vermittelt werden kann.
Die größte Herausforderung für eine Lehrkraft im Geschichtsunterricht ist es, die Schüler und Schülerinnen für eine Epoche oder ein Thema einer Epoche zu interessieren oder im besten Fall sogar zu begeistern. Ist das Interesse der SuS an einem Thema geweckt, kann davon ausgegangen werden, dass sie sich auch intensiv damit und seinen Fragestellungen auseinanderzusetzen, sodass die Lehrkraft das Lernziel erreichen wird.
Die folgenden Fragen stehen hierbei im Fokus der Arbeit:
- Aus welchen Gründen kommt es zu Anklagen wegen Hexerei/Zauberei?
- Wie stellt sich das Gesellschaftsbild im ausgehenden späten Mittelalter und der beginnenden Frühen Neuzeit dar, und welche Kriterien führen zur Ausgrenzung bestimmter Personengruppen?
- Wie ist die geschlechterspezifische Verteilung?
- Welche Formen und Verfahren in der Rechtsprechung lassen sich identifizieren?
- Welche Möglichkeiten bieten sich für die Lehrkräfte, die Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung mithilfe der Hexenprozesse den SuS näherzubringen?
Hierzu erfolgt zunächst eine historisch anthropologische Analyse der Gesellschaft und der Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit zur Erklärung des Phänomens, um abschließend die gestellten Fragen beantworten zu können.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich anschließend mit den theoretischen Anforderungen aus dem Kerncurriculum für die Sek. I sowie den didaktischen Ansprüchen an den Geschichtsunterricht. Ein exemplarischer Unterrichtsentwurf soll den zweiten Teil der Arbeit abschließen und zeigen, wie das Thema in der Praxis angewendet werden kann.
Ein Fazit beschließt die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Gesellschaft und Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit
- 2.1 Das Gerichtswesen in der Frühen Neuzeit
- 2.1.1 Wurden Frauen vor Gericht benachteiligt?
- 2.2 Der Glaube an Hexerei und Zauberei
- 2.3 Wie kam es zur Anklage wegen Hexerei/Zauberei?
- 2.3.1 Die gesellschaftliche Stellung der Frau zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert
- 2.3.2 Klima, Kriege, Reformation und Hungersnöte
- 2.3.3 Die Suche nach „Sündenböcken“
- 3 Die Hexenverfolgungen als eine Art gesellschaftlicher Ausgrenzung?
- 4 Vorgaben des Kerncurriculums in Niedersachsen
- 4.1 Zu erwerbende Schlüsselkompetenzen
- 5 Der Geschichtsunterricht
- 5.1 Das Fach Geschichte
- 5.2 Geschichtsdidaktik
- 5.3 Hexenverfolgungen im Geschichtsunterricht
- 5.4 Exemplarischer Unterrichtsentwurf
- 5.4.1 Bedingungen
- 5.4.1.1 Unterrichtszusammenhang
- 5.4.1.2 Lerngruppe
- 5.4.1.3 Entwicklungsaufgabe
- 5.4.2 Didaktische Überlegungen
- 5.4.2.1 Legitimation
- 5.4.2.2 Sachanalyse
- 5.4.2.3 Transformation
- 5.4.3 Methodische Analyse: Steuerungsverhalten, Phasierung, Sozialformen, Handlungsmuster
- 5.4.4 Ziele: Stundenziele, Teilziele, Kompetenzen
- 5.4.5 Anhang
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht das Phänomen der Hexenverfolgungen aus zwei Perspektiven. Zum einen wird die gesellschaftliche Ausgrenzung derer analysiert, die der Hexerei oder Zauberei angeklagt wurden. Zum anderen befasst sich die Arbeit mit der didaktischen Umsetzung des Themas im Geschichtsunterricht und erforscht die Möglichkeiten, diese Thematik anschaulich darzustellen und den Schülern methodisch zu vermitteln.
- Gesellschaftliche Ausgrenzung in der Frühen Neuzeit
- Anklagen wegen Hexerei und Zauberei
- Das Gerichtswesen und die Rolle der Frau im Mittelalter und der Frühen Neuzeit
- Geschlechterrollen und -verteilung in der Gesellschaft
- Didaktische Ansätze für den Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und die zentralen Fragen der Arbeit darlegt. Anschließend widmet sich Kapitel 2 der Gesellschaft und den Hexenverfolgungen in der Frühen Neuzeit. Es wird die gesellschaftliche Situation und das Gerichtswesen der Zeit beleuchtet, insbesondere die Rolle der Frau und die Frage nach einer möglichen Benachteiligung im Rechtswesen. Des Weiteren wird der Glaube an Hexerei und Zauberei sowie die Gründe für Anklagen gegen vermeintliche Hexen untersucht. Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, ob die Hexenverfolgungen als eine Form gesellschaftlicher Ausgrenzung betrachtet werden können. In Kapitel 4 werden die Vorgaben des niedersächsischen Kerncurriculums und die damit verbundenen Schlüsselkompetenzen vorgestellt. Kapitel 5 widmet sich dem Geschichtsunterricht und beleuchtet die Bedeutung des Faches sowie die Möglichkeiten zur didaktischen Umsetzung des Themas der Hexenverfolgungen. Ein exemplarischer Unterrichtsentwurf wird präsentiert, der verschiedene Aspekte des Themas behandelt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Hexenverfolgungen, gesellschaftliche Ausgrenzung, Frühe Neuzeit, Geschlechterrollen, Gerichtswesen, Glaube, Zauberei, Kerncurriculum, Geschichtsdidaktik, Unterrichtsentwurf.
- Quote paper
- Katrin Deike (Author), 2019, Formen gesellschaftlicher Ausgrenzungen. Die Hexenverfolgungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1450424