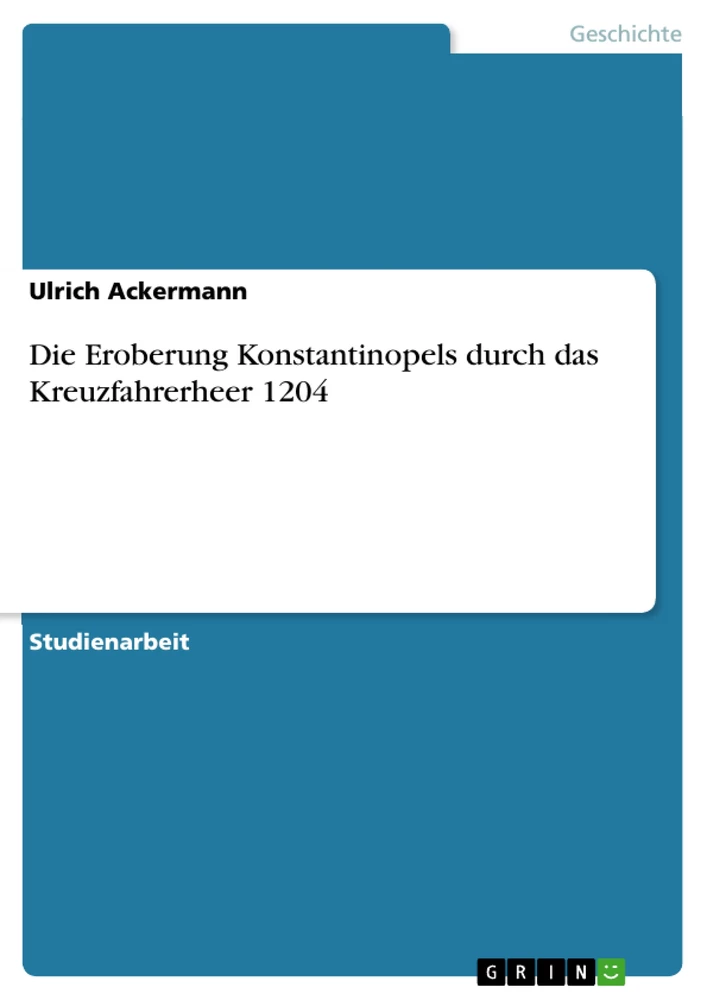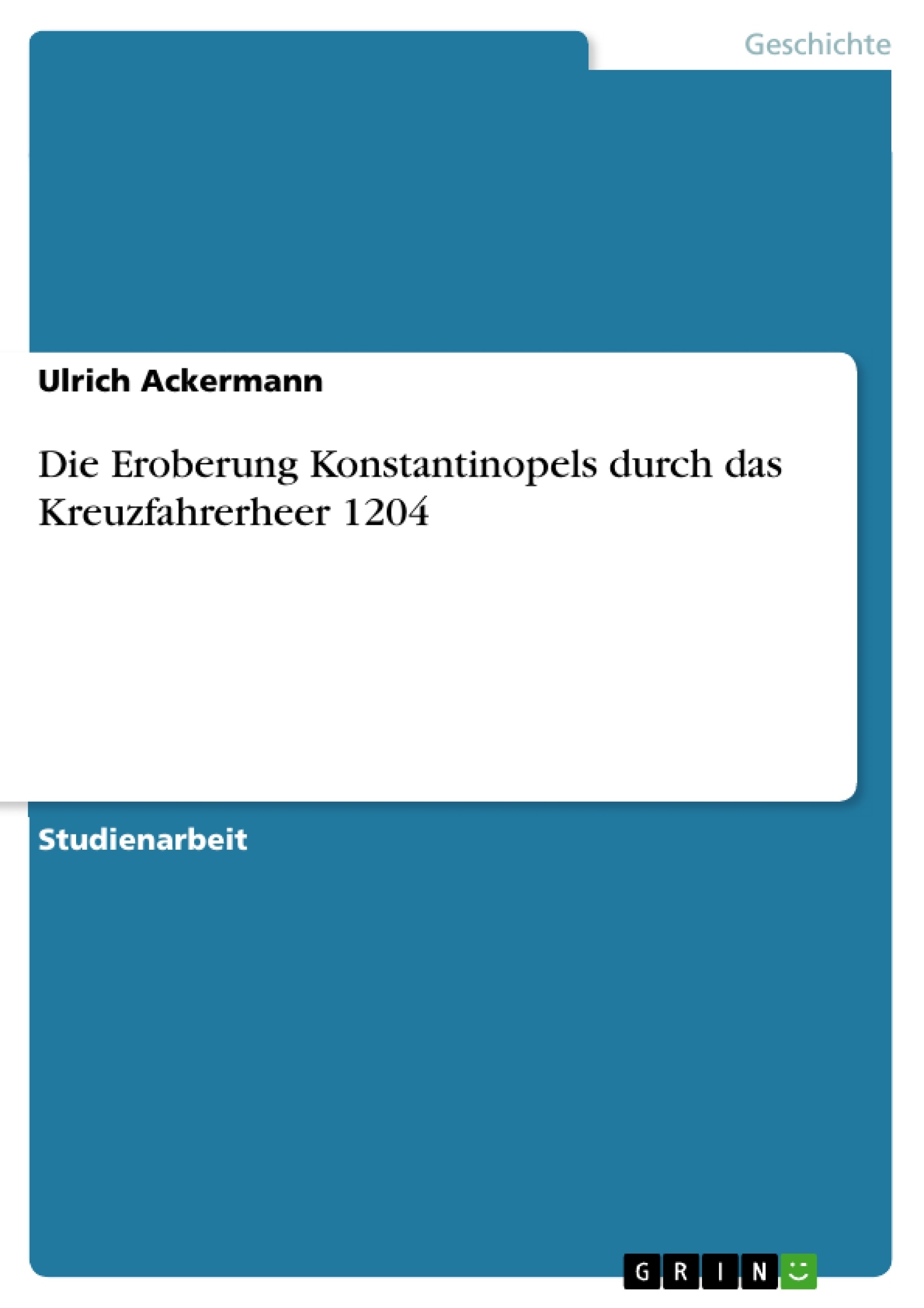„Wie verstreute Schafe trieben sie sie durch alle Straßen der Stadt; flohen sie doch in so großer Menge, daß ihnen selbst die geräumige Breite der Straße kaum zur Flucht zu genügen vermochte.“ Wer würde bei dieser Schilderung des Chronisten Gunther von Pairis denken, dass es sich, im Rahmen eines ‚Kreuzzuges’, um einen Übergriff von Christen auf Gleichgläubige handeln würde?
Über ein Treffen zwischen dem Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel und Papst Johannes Paul II. im Juli 2004 wird berichtet, dass das katholische Kirchenoberhaupt „die Plünderung Konstantinopels, bei der von Kreuzfahrern im April 1204 ‚Blut von Glaubensbrüdern’ vergossen“ wurde, erneut verurteilte.
Gerade mal 108 Jahre vor diesem Angriff forderte Papst Urban II., auf Bitten des damaligen byzantinischen Kaisers Alexius I. Comnenus, seine Untertanen dazu auf, den Glaubensbrüdern der Ostkirche im Kampf gegen die türkischen Heere, die bereits vor den Toren der kaiserlichen Stadt standen, Hilfe zu leisten.
Auch der vierte Kreuzzug, zu dem Papst Innozenz III. aufrief, hätte eigentlich nach Ägypten oder Palästina führen sollen, endete letztlich jedoch mit der Eroberung des christlichen byzantinischen Reiches und seiner Hauptstadt Konstantinopel sowie der Errichtung eines Lateinischen Kaiserreichs. Erstmalig seit 900 Jahren wurde die Stadt des Kaisers Konstantin von feindlichen Truppen gestürmt und besetzt, und das ausgerechnet von einem christlichen Heer!
Versteht man unter einem Kreuzzug einen Kriegszug, der von christlichen Kämpfern zur Befreiung des Heiligen Landes und speziell der Stadt Jerusalem unternommen wird, zur Beendigung dortiger nicht-christlicher, konkret muslimischer Herrschaft, so kann man vom vierten Kreuzzug ohne Zweifel von einer Abirrung sprechen. Das Kreuzfahrerheer gelangte nicht einmal annähernd in die Nähe seines offiziellen Zieles. Stattdessen „verwüsteten die christlichen Jerusalempilger in einer beispiellosen dreitägigen Plünderungsaktion die mit antikem und mittelalterlichem Kulturgut angefüllte Stadt“ und stellten das Blutbad von Jerusalem von 1099 noch in den Schatten. In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie es soweit kommen konnte, und welche Faktoren zu dieser Abkehr vom Ursprungsziel geführt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle des Papsttums unter Innozenz III.
- Handels- und machtpolitische Interessen Venedigs
- Das Wirken des Dogen Enrico Dandolo
- Die Orientpläne der Staufer
- Die Rolle Bonifaz von Montferrat
- Antigriechische Vorurteile im Westen
- Materielle Absichten, Beutegier und Neid
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hintergründe und Ursachen der Eroberung Konstantinopels durch das Kreuzfahrerheer im Jahr 1204. Sie beleuchtet die komplexen politischen, wirtschaftlichen und religiösen Faktoren, die zu diesem Ereignis führten.
- Die Rolle des Papsttums unter Innozenz III. und seine Einflussnahme auf die Kreuzzugsbewegung
- Die strategischen Interessen der Republik Venedig und die Rolle des Dogen Enrico Dandolo
- Die Orientpläne der Staufer und die Rolle von Bonifaz von Montferrat
- Die anti-byzantinischen Vorurteile im Westen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Byzantinischen Reiches
- Die Abkehr vom ursprünglichen Ziel des Kreuzzuges und die Folgen der Eroberung Konstantinopels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1204 ein und stellt die zentrale Frage nach den Ursachen dieses überraschenden Ereignisses. Es wird anhand historischer Quellen gezeigt, dass es sich nicht um einen Angriff auf „Gleichgläubige“ handelte, sondern um eine bewusste Abkehr vom ursprünglichen Ziel des Kreuzzuges.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Rolle des Papsttums unter Innozenz III. und seine Einflussnahme auf die Kreuzzugsbewegung. Innozenz III. wird als zentrale Figur im Kontext der Kreuzzüge des Mittelalters dargestellt, der die Kreuzzugsorganisation vollendete und die Kreuzzugsideologie auch gegen die christliche Konkurrenz der byzantinischen Kirche anwendete.
Das dritte Kapitel widmet sich den Handels- und machtpolitischen Interessen Venedigs und der Rolle des Dogen Enrico Dandolo. Es werden die strategischen Vorteile des Kreuzzuges für die Republik Venedig und die persönlichen Ambitionen von Enrico Dandolo dargestellt.
Das vierte Kapitel analysiert die Orientpläne der Staufer und die Rolle von Bonifaz von Montferrat. Es wird die Bedeutung der Staufer für die Kreuzzugsbewegung und die Rolle von Bonifaz von Montferrat als möglicher Verbündeter der Kreuzfahrer beleuchtet.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den anti-byzantinischen Vorurteilen im Westen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Byzantinischen Reiches. Es wird die These vertreten, dass die Vorurteile und die verbreitete Beutegier der Kreuzfahrer maßgeblich zu der Eroberung Konstantinopels beigetragen haben.
Schlüsselwörter
Papsttum, Innozenz III., Kreuzzug, Konstantinopel, Byzanz, Venedig, Enrico Dandolo, Staufer, Bonifaz von Montferrat, anti-byzantinische Vorurteile, Beutegier, Abkehr vom Ursprungsziel
- Quote paper
- Ulrich Ackermann (Author), 2004, Die Eroberung Konstantinopels durch das Kreuzfahrerheer 1204, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144969