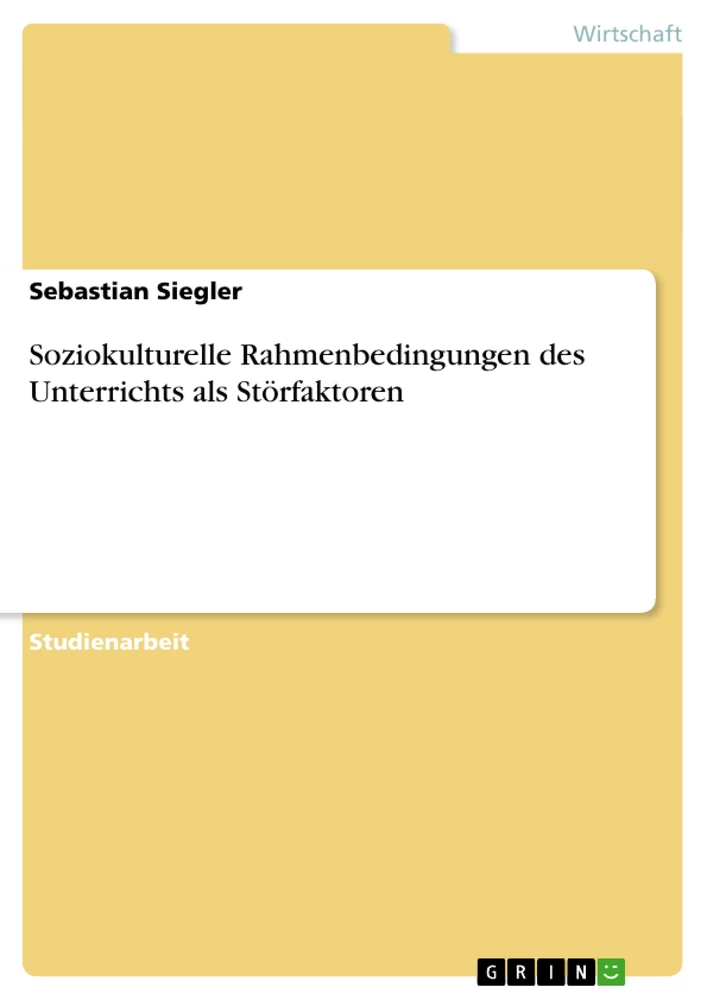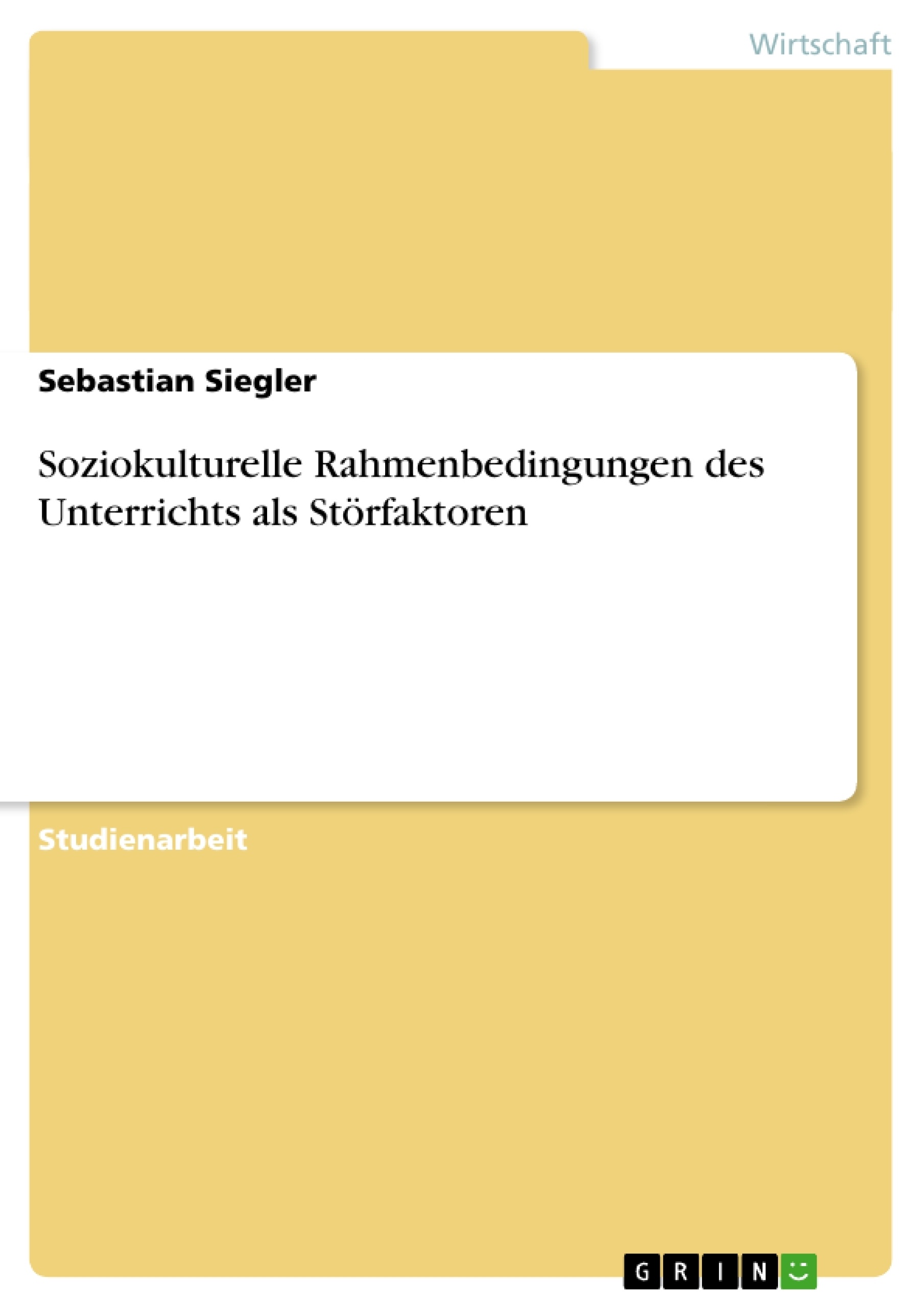Unterrichtsstörungen gehören schon immer zum Unterrichtsalltag an Schulen. Jedoch häufen sich in den letzten Jahren die Beschwerden von Lehrern über immer intensivere Beeinträchtigungen des Unterrichtsverlaufs durch Störungen. Die pädagogisch-psychologische Forschung setzt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema der Unterrichtsstörungen auseinander und hat empirische Ergebnisse hervorgebracht, die die Bedeutung dieses Themas unterstreichen. So ereignet sich alle 2,5 Minuten im Unterricht ein normunkonformes Verhalten1 und ein Drittel der Schüler tut sich nach Lehrereinschätzungen mit der Aufmerksamkeit auf den Unterrichts-inhalt schwer. Darüber hinaus greifen 5 bis 10 % der Schüler wiederkehrend Lehrer oder Schüler während des Unterrichts durch verbale oder auch körperliche Attacken an und stören damit den Unterricht. Im Erscheinungsbild von Unterrichtsstörungen dominieren derzeit folgende Fehlverhaltsweisen: „Verbale Aktivitäten (Schwätzen, Dreinreden, Schreien), motorische Unruhe (Schaukeln, Spielen, Umherlaufen), Aggression (insbesondere verbale Entgleisungen), geistige Abwesenheit (Tagträumen, Schlafen, stofffremde Tätigkeiten) und Verweigerung (keine Mitarbeit, keine Hausaufgaben)“.
Für die Unterrichtsstörungen gibt es zahlreiche Ursachen. Sie werden zumeist im Verhalten der Schüler und Lehrer, bei den Eltern und in der Schule gesucht. Die letzten zwei gehören zu den sozial-kulturelle Rahmenbedingungen des Unterrichts. Sie bilden den Gegenstand dieser Arbeit und werden im Folgenden näher analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung und Vorgehensweise
- 1.2. Sozial-kulturelle Rahmenbedingungen des Unterrichts
- 2. Schule als Institution
- 2.1. Unterschied zwischen schulischer Erfahrenswelt und Lebenswelt
- 2.2. Organisatorische Struktur der Schule
- 2.3. Leistungsbegriff in Schule und Gesellschaft
- 2.4. Schulklima
- 3. Sozialisation
- 3.1. Schichtbezogene Sozialisationsdefizite
- 3.2. Familiäre Strukturen
- 3.2.1. Grundlegungen
- 3.2.2. Scheidungen
- 3.2.3. Problemfamilien
- 3.3. Peer-Groups
- 4. Fazit und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert sozial-kulturelle Rahmenbedingungen des Unterrichts als Störfaktoren. Ziel ist es, den Einfluss von Schule als Institution und Sozialisationsprozessen auf das Auftreten von Unterrichtsstörungen zu untersuchen. Die Arbeit basiert auf bestehenden Forschungsergebnissen und beleuchtet verschiedene Aspekte, die zu Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen beitragen können.
- Der Einfluss der schulischen Organisation auf Schülerverhalten.
- Die Diskrepanz zwischen schulischer und außerschulischer Lebenswelt.
- Der Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Sozialisationsdefiziten.
- Die Rolle familiärer Strukturen und Peer-Groups bei der Entstehung von Unterrichtsstörungen.
- Die Bedeutung des Schulklimas für das Lernverhalten der Schüler.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Unterrichtsstörungen ein und beschreibt die steigende Anzahl an Beschwerden von Lehrern über zunehmende Beeinträchtigungen des Unterrichts. Sie nennt statistische Daten zu normwidrigem Verhalten im Unterricht und stellt verschiedene Formen von Unterrichtsstörungen vor. Der Fokus liegt auf den sozial-kulturellen Rahmenbedingungen als Ursachen für diese Störungen und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Schule als Institution und Sozialisationsprozesse als zentrale Aspekte beleuchtet. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, den Begriff der sozial-kulturellen Rahmenbedingungen zu erläutern und diese im Kontext von Unterrichtsstörungen zu analysieren.
2. Schule als Institution: Dieses Kapitel untersucht die Schule als Institution und ihren Einfluss auf das Auftreten von Unterrichtsstörungen. Es wird der Unterschied zwischen der schulischen Erfahrenswelt und der Lebenswelt der Schüler hervorgehoben, der zu Konflikten und mangelnder Verinnerlichung schulischer Regeln führen kann. Die Arbeit analysiert die organisatorische Struktur der Schule, die sich an Modellen der allgemeinen staatlichen Verwaltung orientiert und somit von den Bedürfnissen der Schüler abweichen kann. Die Diskrepanz zwischen der Struktur und den eigentlichen Aufgaben der Schule – der Vorbereitung der Schüler auf das gesellschaftliche Leben – wird als potentielle Ursache für Unterrichtsstörungen identifiziert. Der Einfluss von Faktoren wie Leistungsorientierung, Lehrerverhalten und Schülermitverantwortung wird diskutiert, wobei Bezug auf eine ausländische Längsschnittstudie genommen wird, die signifikante Unterschiede im Schülerverhalten zwischen verschiedenen Schulen aufzeigt.
3. Sozialisation: Das Kapitel widmet sich den Sozialisationsprozessen und deren Einfluss auf das Auftreten von Unterrichtsstörungen. Es werden schichtbezogene Sozialisationsdefizite, familiäre Strukturen und Peer-Groups als wichtige Faktoren untersucht. Die Bedeutung familiärer Faktoren wie Familiengröße, Einkommen, Erziehungsverhalten und Erziehungsklima für die Entwicklung des Kindes und dessen Verhalten in der Schule wird analysiert. Der Einfluss von Scheidungen und Problemfamilien auf das schulische Verhalten wird ebenso thematisiert wie die Rolle von Peer-Groups und deren Einfluss auf die Normen und Werte der Schüler. Der Text differenziert zwischen familiären und lebensbedingten sozio-kulturellen Faktoren.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, sozial-kulturelle Rahmenbedingungen, Schule als Institution, Sozialisation, familiäre Strukturen, Peer-Groups, Schulklima, Schichtzugehörigkeit, Lebenswelt, schulische Erfahrenswelt, Leistungsbegriff.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sozial-kulturelle Rahmenbedingungen des Unterrichts und Unterrichtsstörungen
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die sozial-kulturellen Rahmenbedingungen des Unterrichts als Störfaktoren. Sie untersucht den Einfluss von Schule als Institution und Sozialisationsprozessen auf das Auftreten von Unterrichtsstörungen.
Welche Aspekte werden im Einzelnen betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der schulischen Organisation auf das Schülerverhalten, die Diskrepanz zwischen schulischer und außerschulischer Lebenswelt, den Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Sozialisationsdefiziten, die Rolle familiärer Strukturen und Peer-Groups bei Unterrichtsstörungen, und die Bedeutung des Schulklimas für das Lernverhalten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Schule als Institution, zu Sozialisationsprozessen und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung und Vorgehensweise. Das Kapitel zur Schule als Institution analysiert die organisatorische Struktur, den Leistungsbegriff und das Schulklima. Das Kapitel zur Sozialisation untersucht schichtbezogene Sozialisationsdefizite, familiäre Strukturen (inkl. Scheidungen und Problemfamilien) und Peer-Groups. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Schlussfolgerungen.
Welche konkreten familiären Strukturen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Einfluss verschiedener familiärer Faktoren wie Familiengröße, Einkommen, Erziehungsverhalten und Erziehungsklima auf die Entwicklung des Kindes und dessen Verhalten in der Schule. Der Einfluss von Scheidungen und Problemfamilien auf das schulische Verhalten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielen Peer-Groups?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Peer-Groups und deren Einfluss auf die Normen und Werte der Schüler und somit auf ihr Verhalten im Unterricht.
Wie wird der Unterschied zwischen schulischer und außerschulischer Lebenswelt behandelt?
Die Arbeit hebt den Unterschied zwischen der schulischen Erfahrenswelt und der Lebenswelt der Schüler hervor und analysiert, wie diese Diskrepanz zu Konflikten und mangelnder Verinnerlichung schulischer Regeln führen kann.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Fazit zusammengefasst und leiten sich aus der Analyse der Schule als Institution und der Sozialisationsprozesse ab. Die Arbeit zeigt auf, wie verschiedene Faktoren zusammenwirken und zu Unterrichtsstörungen beitragen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unterrichtsstörungen, sozial-kulturelle Rahmenbedingungen, Schule als Institution, Sozialisation, familiäre Strukturen, Peer-Groups, Schulklima, Schichtzugehörigkeit, Lebenswelt, schulische Erfahrenswelt, Leistungsbegriff.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf bestehenden Forschungsergebnissen und beleuchtet verschiedene Aspekte, die zu Disziplinproblemen und Unterrichtsstörungen beitragen können. Es wird Bezug auf eine ausländische Längsschnittstudie genommen, die signifikante Unterschiede im Schülerverhalten zwischen verschiedenen Schulen aufzeigt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für die akademische Nutzung bestimmt, um die Thematik der Unterrichtsstörungen und deren sozial-kulturelle Hintergründe zu analysieren.
- Quote paper
- Diplom-Handelslehrer Sebastian Siegler (Author), 2007, Soziokulturelle Rahmenbedingungen des Unterrichts als Störfaktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144902