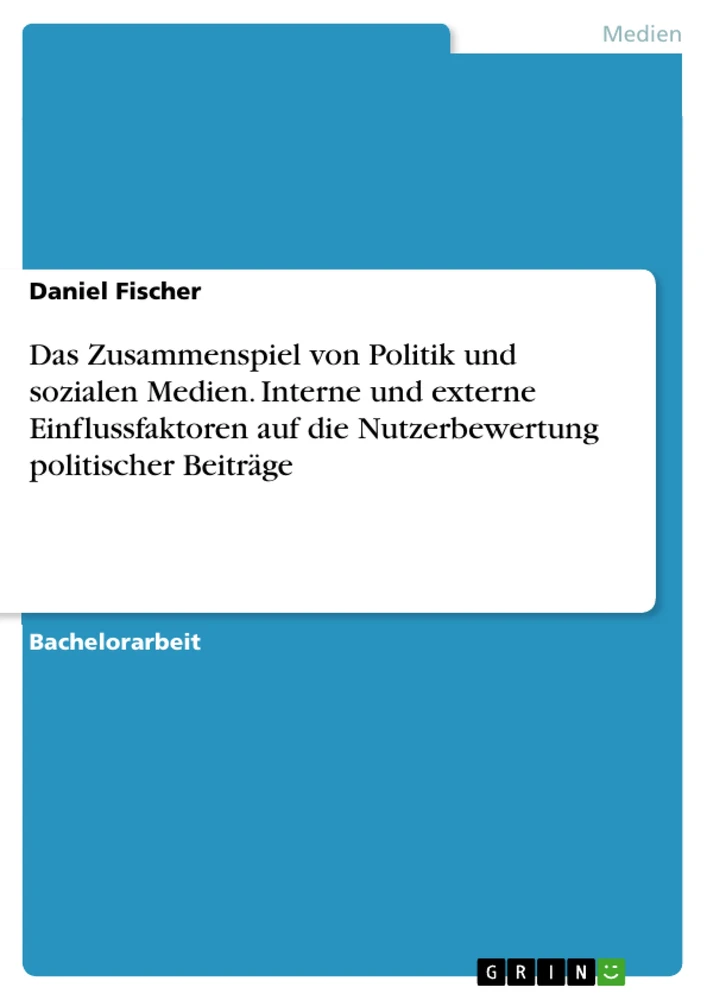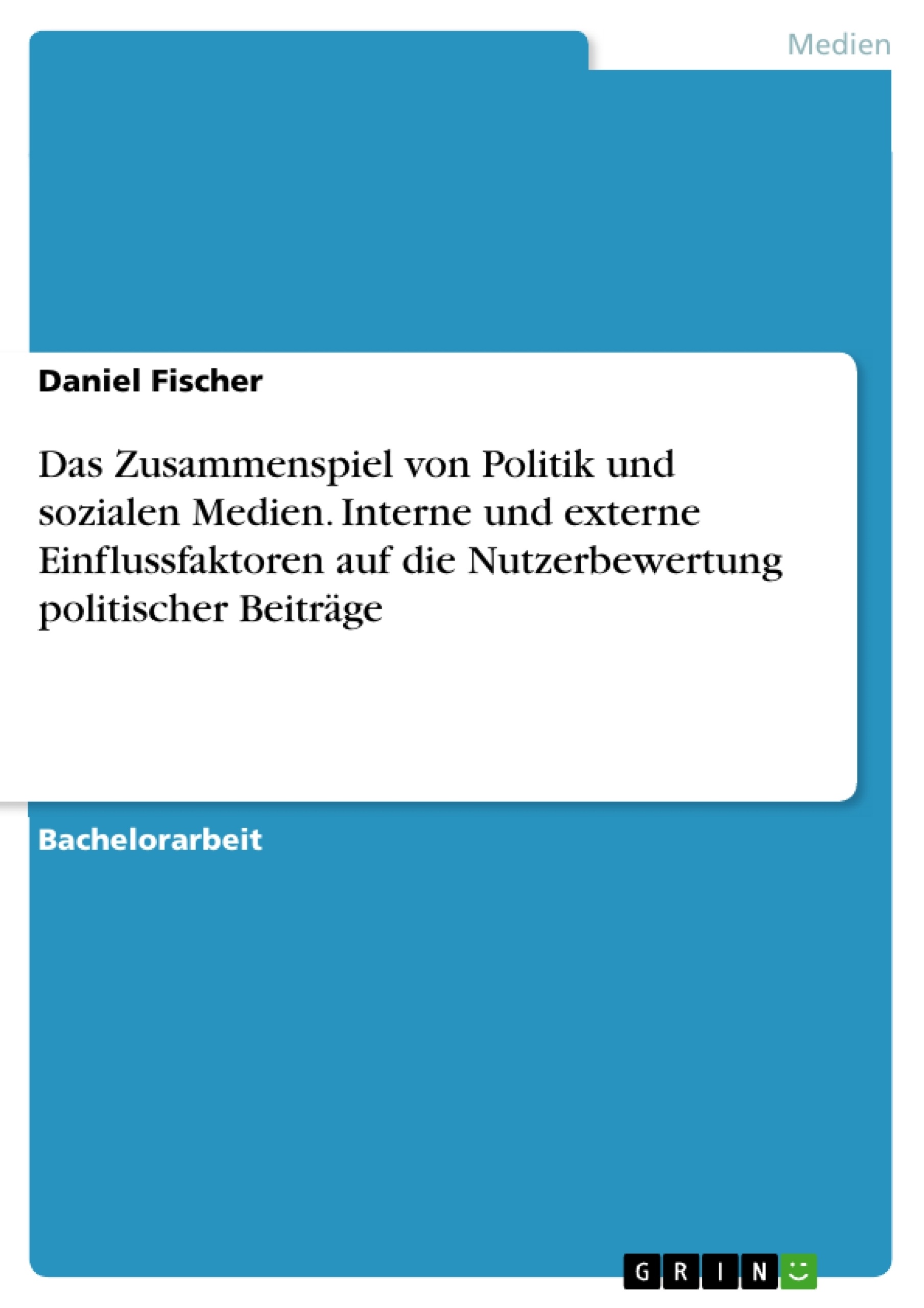In einer Ära, in der digitale Plattformen die Art und Weise verändern, wie Menschen kommunizieren, Informationen konsumieren und Meinungen bilden, ist es von entscheidender Bedeutung, das Zusammenspiel von Politik und sozialen Medien zu verstehen. Ein Phänomen, das diese Veränderung deutlich illustriert, ist die zunehmende Präsenz politischer Akteure auf TikTok, einer der am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen weltweit. Hier finden politische Diskussionen und Debatten in Form kurzer, prägnanter Videos statt, die ein breites Publikum erreichen und direkte Interaktionen zwischen Politikern und Bürgern ermöglichen.
Dieser Paradigmenwechsel wirft jedoch auch wichtige Fragen auf: Welchen Einfluss haben diese neuen Medien auf die Meinungsbildung und politische Kommunikation? Wie bewerten Nutzer politische Beiträge auf Plattformen wie TikTok, und welche Faktoren beeinflussen diese Bewertungen?
In dieser Arbeit wird diesen Fragen auf den Grund gegangen. Dabei steht die Untersuchung des Zusammenspiels interner und externer Einflussfaktoren zur Nutzerbewertung politischer Beiträge im Fokus. Beginnend mit einem Überblick über die theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) wird beleuchtet, welche Rolle soziale Medien in der Meinungsbildung und politischen Kommunikation spielen und wie sie sich von klassischen Medien unterscheiden.
Anschließend werden in Kapitel 3 die Einflussfaktoren auf die Nutzerbewertung von politischen Beiträgen detailliert betrachtet. Dabei werden sowohl interne Faktoren wie formale und inhaltliche Charakteristika der Beiträge als auch externe Faktoren wie demografische Merkmale der Nutzer und algorithmische Einflüsse analysiert.
Die Hypothese, dass die Nutzerbewertung politischer Inhalte auf Social Media sowohl von internen als auch von externen Faktoren beeinflusst wird, bildet das Leitmotiv dieser Arbeit. Diese Hypothese wird auf Basis einer tiefgreifenden Literaturrecherche überprüft und kritisch reflektiert.
Durch die Analyse und Zusammenführung relevanter Forschungsergebnisse soll ein umfassendes Verständnis für das Zusammenspiel von Politik und sozialen Medien geschaffen werden. Dabei wird besonders auf die Perspektive der Nutzer geachtet, um deren Meinungsbildungsprozesse besser zu verstehen und mögliche Implikationen für die politische Kommunikation zu identifizieren.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Politik auf TikTok
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Soziale Medien in der Meinungsbildung
2.2 Soziale Medien in der politischen Kommunikation
2.3 Klassische und soziale Medien im Vergleich
3 Einflussfaktoren zur Nutzerbewertung politischer Beiträge
3.1 Interne Einflussfaktoren
3.1.1 Formale Charakteristika
3.1.1.1 Beitragstyp Bild & Video
3.1.1.2 Beitragstyp Text
3.1.1.3 Nutzerinteraktion & Dialogbereitschaft
3.1.2 Inhaltliche Charakteristika
3.1.2.1 Themenwahl & Agenda-Setting
3.1.2.2 Emotionalität & Framing
3.1.2.3 Authentizität & Charisma
3.2 Externe Einflussfaktoren
3.2.1 Demografie der Nutzer
3.2.2 Algorithmen, Bots und Filterblasen
4 Diskussion
5 Limitationen & Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
AfD
Alternative für Deutschland
Bzw.
Beziehungsweise
Ca.
Zirka
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
FDP
Freie Demokratische Partei
FPÖ
Freiheitliche Partei Österreichs
Ggf.
Gegebenenfalls
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Vs.
Versus
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Durchschnittliche Nutzungsdauer von sozialen Medien pro Werktag nach Alters- g gruppen in Deutschland im Jahr 2019
Abbildung 2: Verwendung von Emotionen in den Facebook-Beiträgen deutscher Parteien
Abbildung 3: Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl nach Altersgruppen und Anteil der 14- bis 29-jährigen Nutzer sozialer Medien
1 Einleitung
1.1 Politik auf TikTok
„Die Grünen sind der größte Stimmungskiller in der Nation, die sind gegen alles. Luftballonverbot, Autowaschverbot, Verbrennerverbot, Fleischverbot, Fischverbot [...] Ich verstehe das alles nicht, wir wehren uns klar dagegen.“ Mit diesen Worten antwortete Markus Söder auf die Frage „Was gedenken Sie, gegen die grüne Verbotspolitik zu tun?“ eines Nutzers im Rahmen eines Q&A-Videos der CSU auf TikTok. Der Clip vom 15.03.2023 hat über 600.00 Aufrufe und mehr als 2800 Kommentare auf der chinesischen Kurzvideo-Plattform zu verzeichnen (Söder, 2023). Die Reaktionen der Nutzer1 in den Kommentaren fallen gemischt aus: Einerseits wird die Haltung des bayerischen Ministerpräsidenten befürwortet, andere prangern Söder eine Doppelmoral aufgrund der restriktiven Corona-Maßnahmen aus den vergangen Jahren an.
Im Kontext dieses Beispiels wird deutlich, dass politische Vertreter die Reichweite und Interaktionspotenziale neuer sozialer Medien immer intensiver nutzen, um ihre Agenda mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen. Mit über 1,7 Mrd. aktiven Nutzern weltweit zählt TikTok zu den am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen (Buchholz, 2022) und eröffnet dadurch politischen Parteien und ihren Botschaftern ein neuartiges Spektrum an Möglichkeiten, um mit ihrer jungen Wählerschaft in Kontakt zu treten.
Ein Beispiel für den Erfolg von TikTok im politischen Kontext ist die FDP im Bundestagswahlkampf 2021, die durch ihre Präsenz auf der Plattform Sichtbarkeit und Reichweite generieren konnte (Hügelmann, 2023, S.86). Obwohl die Nutzung von TikTok allein nicht als monokausale Erklärung für den Wahlerfolg der Liberalen unter jungen Wählern herangezogen werden kann, zeigt es dennoch die Bedeutung von Social Media und insbesondere TikTok bei der Beeinflussung der Wahrnehmung junger Menschen im Wahlkampf (ebd.). Denn „die Besonderheiten des Empfehlungsalgorithmus, eine hohe Nutzerzentrierung und die globale Aussteuerung relevanter Inhalte unabhängig der Account-Größe des Urhebers machen TikTok zum Social Media Game-Changer“ (ebd.).
Angesichts der zunehmenden Relevanz TikToks und anderer sozialer Medien in der politischen Landschaft, wie durch die erwähnten Beispiele verdeutlicht, soll Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit das Zusammenspiel interner und externer Einflussfaktoren zur Nutzerbewertung von Politikern auf Social Media sein.
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung
Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet demnach: Inwiefern trägt das Zusammenspiel aus internen und externen Einflussfaktoren zur Beitragsbewertung politischer Posts auf sozialen Medien bei? Der Begriff politische Posts bezieht sich ausschließlich auf die Beiträge einzelner Politiker und die offiziellen Kanäle von Parteien, jedoch nicht auf Beiträge von Zeitungs- und Nachrichtenkanälen oder Influencern, die politische Themen behandeln.
Zur Beantwortung der Forschungsfrage soll in Kapitel 2 ein grundsätzliches Verständnis dafür vermittelt werden, welche Rolle soziale Medien in der Meinungsbildung (Abschnitt 2.1) und in der politischen Kommunikation (Abschnitt 2.2) spielen und welche markanten Unterschiede sich in diesem Zusammenhang zu klassischen Medien abstrahieren lassen.
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, aktuelle Forschungserkenntnisse betreffend der externen und internen Einflussfaktoren auf die Nutzerbewertung politischer Beiträge hin zu sammeln, segmentieren und zu vergleichen. Hierzu wird in Abschnitt 3.1 zunächst eine umfassende Analyse der internen Einflussfaktoren durchgeführt. Sowohl formale Charakteristika wie die Beitragstypen Bild, Video & Text und die Interaktionsbereitschaft, als auch inhaltliche Charakteristika wie Themenwahl, Framing, Authentizität und Charisma werden eingehend beleuchtet. Demgegenüber stehen die in Abschnitt 3.2 dargelegten externen Einflussfaktoren, dazu zählen demografische Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und geografische Gegebenheiten, sowie die Auswirkungen von Algorithmen, Bots und Filterblasen.
In Anbetracht der Forschungsfrage und der Zielsetzung lautet die Hypothese demnach: Die Nutzerbewertung politischer Inhalte auf Social Media wird sowohl von internen als auch von externen Faktoren beeinflusst. Der Überprüfung dieser Hypothese liegt eine tiefgreifende Literaturrecherche zugrunde. Um relevante, einschlägige sowie aktuelle Literatur ausfindig zu machen, wird vor allem auf Fachzeitschriften und Sammelbände deutsch- und englischsprachiger Verlagsdatenbanken zurückgegriffen. Die entsprechenden Werke werden anschließend unter Berücksichtigung der Forschungsfrage einer kritischen Prüfung unterzogen und die essenziellen Erkenntnisse und Thesen extrahiert. Damit ein kohärentes Verständnis für die Nutzerperspektive entwickelt werden kann, wird ein besonderes Augenmerk auf die aktuellen Erkenntnisse der Mediennutzungsforschung und Rezeptionsforschung im Zusammenhang mit sozialen Medien gelegt.
2. Theoretische Fundierung
2.1 Soziale Medien in der Meinungsbildung
Mit der voranschreitenden Digitalisierung haben sich soziale Medien zu einem integralen Bestandteil des privaten und öffentlichen Lebens etabliert. Carr & Hayes (2015) definieren soziale Medien als „internetbasierte, entkoppelte und dauerhafte Kanäle der massenpersönlichen Kommunikation, die Wahrnehmung von Interaktionen zwischen Nutzern ermöglichen und ihren Wert primär aus nutzergenerierten Inhalten schöpfen“ (S. 49). Diese Definition hebt drei Schlüsselmerkmale sozialer Medien hervor: Social Media Plattformen werden über das Internet gehostet und sind somit weltweit zugänglich; sie ermöglichen Nutzern das Erstellen und Teilen eigens generierter Inhalte wie Texte, Bilder und Videos; und durch Funktionen wie Likes, Shares und Kommentare können Nutzer ihre Meinungen zu bestimmten Themen ausdrücken und mit anderen Nutzern in einen Dialog treten (ebd.). Aufgrund ihrer enormen Reichweite und der Möglichkeit, Inhalte viral zu verbreiten, haben soziale Medien somit eine einzigartige Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung übernommen.
Eine grundlegende Theorie zur öffentlichen Meinungsbildung ist das von Lazarsfeld und Katz entwickelte Modell des zweistufigen Kommunikationsflusses. Laut diesem Modell agiert eine kleine Minderheit von „Meinungsführern“ als Informations- und Einflussvermittler zwischen den Massenmedien und der Mehrheit der Gesellschaft (Watts & Dodds, 2007, S. 441). Dies steht im Widerspruch zum früheren Ein-Stufen-Modell, das Individuen als passiv beeinflusst durch die Medien betrachtete (ebd.). Praktisch alle Medienfunktionen, die in der Literatur aus einer normativen Perspektive diskutiert werden - wie Informationsvermittlung, Kritik, Kontrolle und Integration - basieren auf der grundsätzlichen Annahme, dass die Medien die Schwerpunkte der öffentlichen Meinungsbildung beeinflussen (Bulkow & Schweiger, 2013, S. 171). Öffentliche Diskurse können demnach nur unter der Voraussetzung stattfinden, dass ein Mechanismus existiert, der bestimmt, welche gesellschaftlichen Themen und Probleme diskussions- und lösungswürdig sind (ebd.).
Der öffentliche Diskurs und damit einhergehend die politische Meinungsbildung haben sich in den letzten Jahren zunehmend über Social-Media-Plattformen ausgeweitet. Die Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien macht Zufriedenheitstrends mit politischen Parteien erkennbar und trägt zur Identifikation kontroverser Themen bei (Ziehe & Sporleder, 2020, S. 160). Die aktuelle Studienlage zeigt, dass die Gesellschaft in relevanten politischen Fragen nahezu gleichmäßig gespalten ist. Eine gezielte externe Informationsflut kann daher sehr effektiv sein, um das öffentliche Meinungsbild zu beeinflussen, da selbst geringfügige Meinungsschwankungen (1% -bis 2%) einen entscheidenden Einfluss auf ein Wahlergebnis haben können (Gündüc, 2019, S. 12). Beobachten ließ sich dieser Effekt beispielsweise beim schottischen Referendum 2014, der US-Präsident- schaftswahl 2016 oder der Brexit-Abstimmung 2016. Konkurrieren beide Parteien gleich stark, sind die Ergebnisse unberechenbar. Wenn jedoch eine Partei die technischen Möglichkeiten und die sozialen Medien stärker nutzt als ihre Konkurrenz, kann sie leicht die Oberhand über den erforderlichen kleinen Prozentsatz der unentschlossenen Wähler gewinnen (ebd.). Laut Xiong & Liu (2014) entwickeln und verbreiten sich Informationen auf sozialen Medien schneller als in der echten Gesellschaft, was Meinungsbildungsprozesse komplexer macht (S. 2).
Als eine der wichtigsten Plattformen für öffentliche Meinungsbildung und politische Kommunikation hat sich der Kurznachrichtendienst Twitter etabliert. Dabei sind neben den menschlichen Nutzern bestimmte Computerprogramme von Interesse, bekannt als „Social bots“ bzw. „Political bots“, die im Verdacht stehen, politische Kommunikationsprozesse zu beeinflussen (Muhle, 2020, S. 46). Wenn diese Programme tatsächlich erfolgreich funktionieren, wird die Notwendigkeit deutlich, Political Bots und ihre Aktivitäten zu erkennen, um Social Media Nutzer, Politiker und die Öffentlichkeit zu informieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu entwickeln (ebd.).
Darüber hinaus spielen Echokammern und Filterblasen eine entscheidende Rolle im Meinungsbildungsprozess auf Social Media. Algorithmisch neigen soziale Medien dazu, Nutzeransichten zu reproduzieren, um kognitive Dissonanzen zu minimieren und eine positive Nutzererfahrung zu fördern. Dieser selektive Mechanismus führt zu einer verstärkten Partizipation, da Nutzer für ihre Ansichten Bestätigung erfahren (Verständig, 2020, S. 35). Es gibt inzwischen es eine Reihe von Forschungsarbeiten, die sich mit der Existenz, Wirkung und dem Einfluss von Filterblasen und Echokammern auf die individuelle Wahrnehmung befassen (ebd., S. 36). Allerdings ist es laut einiger Arbeiten, aufgrund der unterschiedlichen und dynamischen Medienformen, sehr komplex, Filterblasen zu erfassen, da sich dieses Konzept nicht nur aus einer rein technischen Perspektive heraus erklären lässt (ebd.).
Der digitale Einfluss auf politische Meinungsbildungsprozesse über Social-Media-Ka- näle ist auch an der politischen Öffentlichkeit nicht vorbeigegangen und hat maßgeblichen Einfluss auf kommunikationsstrategische Prozesse von Parteien und politischen Akteuren.
2.2 Soziale Medien in der politischen Kommunikation
In verschiedenen Kontexten des politischen Lebens, ob in Wahlkampfzeiten oder Routinephasen, in demokratischen oder autoritären Systemen, auf lokaler und globaler Ebene, weist eine Vielzahl von Phänomenen auf einen tiefgreifenden strukturellen Wandel in der politischen Kommunikation hin. Dieser Wandel wird häufig mit der Ausbreitung des Internets begründet: Die dynamische Entwicklung der Online-Medien entwickelt sich fortdauernd, insbesondere durch Social-Web-Angebote und Smartphone Apps (Dohle, Jand- ura & Vowe, 2014, S. 414). Dadurch entstehen Innovationsmöglichkeiten, die auch für politische Zwecke genutzt werden, was traditionelle Formen der politischen Kommunikation vor neue Herausforderungen stellt (ebd.). Dieser Wandel in der politischen Kommunikation entspricht nicht zuletzt den zentralen Forderungen von Habermas‘ Modell der deliberativen Öffentlichkeit. Habermas geht davon aus, dass eine zentrale Eigenschaft demokratischer Öffentlichkeiten die herrschaftsfreie und intensive Teilhabe möglichst vieler Bürger, unter gleichberechtigten Teilnahmebedingungen, am politischen Diskurs ist (Emmer & Wolling, 2010, S. 37). Auf dieser Grundlage ist Öffentlichkeit ein Kommunikationssystem des Informations- und Meinungsaustausches, welches den Grundbaustein öffentlicher Meinungsbildung darstellt (ebd.).
„Politische Kommunikation“ bezieht sich grundlegend auf jegliche Interaktion, die auf kollektiv verbindliche Entscheidungen abzielt (Dohle et al. 2014, S. 415). Der Begriff begründet sich auf dem theoretischen Ansatz der „kommunikativen Konstruktion von Po- litik“und basiert auf drei Grundvoraussetzungen: Politik wird zum einen durch Kommunikation konstruiert, was konkret durch die öffentliche Kommunikation politischer Akteure in verschiedenen medialen Ausprägungen sichtbar wird. Zweitens verändert sich die Art und Weise der kommunikativen Konstruktion von Politik laufend in mehrdimensionalen Prozessen. Und drittens lässt sich diese Konstruktion durch methodisch kontrollierte Beobachtungen auf Mikro-, Meso- und Makroebene rekonstruieren, wodurch empirisch überprüfbare Aussagesysteme entwickelt werden können (ebd.). Politische Kommunikation weist, je nach Akteur und Institution, unterschiedliche Formen und Ausprägungen auf. Parteien, Politiker, Verbände und weitere Interessensgruppen machen sich strategische Werkzeuge wie die politische Werbung und politische Öffentlichkeitsarbeit zunutze (Oswald & Johann, 2021, S. 2f). Weitere Formen sind die politische Berichterstattung von Journalisten, sowie die interpersonale politische Kommunikation innerhalb der Bevölkerung. All diese Formen existieren nicht isoliert voneinander, sondern stehen in einem sich gegenseitig beeinflussendem Abhängigkeitsverhältnis zueinander (ebd.). Grundlage einer funktionierenden Demokratie ist die politische Partizipation der Bürger. Mit sozialen Medien bieten sich neue direkte Beteiligungsmöglichkeiten in politischen Belangen, da Bürger sich online politisch engagieren und informieren können, was sich positiv auf die Wählerschaft, das politische Interesse und die allgemeinte Zufriedenheit auswirken kann (Friedrichsen, 2014, S. 234). Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter spielen daher nicht mehr nur im privaten und unternehmerischen Rahmen eine wichtige Rolle, sondern dank verschiedener Online-Tools zur Wissensvermittlung und Informationsverbreitung auch im politischen Kontext (ebd.). In einer Studie des Pew Research Centers wurden amerikanische Facebook- und Twitter-Nutzer zur Wahrnehmung, Beeinflussbarkeit und Diskussionskultur politischer Themen auf Social Media befragt. Die Ergebnisse der Umfrage legen jedoch nahe, dass eine Mehrheit der Nutzer gemischte Ansichten über den Umgangston auf sozialen Medien haben. Sie empfinden Online-Diskussionen als respektloser, weniger lösungsorientiert und impulsiver als in anderen Umgebungen (Duggan & Smith, 2016, S. 21ff).
Durch soziale Medien wird dem Nutzer die Möglichkeit geboten, „Prosumer“ zu sein, also gleichzeitig Produzent als auch Konsument von Inhalten (Toor, 2020, S. 71). Zugänglichkeit und ein hohes Interaktivitätspotenzial machen Social Media somit zu einem wertvollen Instrument der politischen Kommunikation (ebd.). Neben Politikern haben darüber hinaus politische Aktivistengruppen, die in den Mainstream-Medien kaum Gehör gefunden haben, sich die Vorzüge sozialer Medien zunutze gemacht, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Das kann sich auf Politiker und das von ihnen vertretene System auch negativ auswirken. Prominentes Beispiel dafür ist der Arabische Frühling 2011, der unter anderem durch Meinungsäußerungen auf sozialen Medien begünstigt wurde, was zur Absetzung mehrerer Staatsregierungen führte (ebd.). Die Förderung von Bürgerbeteiligung und Transparenz sind grundsätzlich sinnvolle und notwendige Prinzipien für eine legitimierte Demokratie. Allerdings führt das auch dazu, dass die Erwartungen gegenüber politischen und anderen betroffenen staatlichen Institutionen bezüglich Flexibilität, Agilität und Reaktionsschnelligkeit nicht immer der realen Sachlage entsprechen (Metz, 2019, S. 51). Unter diesem Druck ist es dann fast unmöglich, besonnene und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Daher muss die bürgerliche Teilnahme im Internet für eine qualitativ hochwertige Diskussionskultur in angemessenem Ausmaß geschehen (ebd.)
2.3 Klassische und soziale Medien im Vergleich
Der digitale Medienwandel bezieht sich nicht nur auf die Entwicklung einzelner Medienformen, sondern steht in einer speziellen Beziehung zum gesamtgesellschaftlichen digitalen Wandel. Mit dem Internet ist ein neuer Medientyp entstanden, der neben der Digitalisierung selbst weitere Transformationsfaktoren wie Vernetzung, Konvergenz, Erfassung und Intermedialität2 sowie klassische Medienformate universell vereint (Alm, 2022, S. 4). Klassische Medien verstehen sich als traditionelle massenmediale Instrumente, durch die Informationen an Menschen verschiedener Standorte vermittelt werden und sich grundsätzlich durch eine weniger technologieintensive und langsamere Art auszeichnen (Jiang, 2022). Der Begriff umfasst einerseits Printmedien, wie Zeitungen, Magazine und Bücher und andererseits Rundfunkmedien, bestehend aus Radio und Fernsehen (ebd.).
Der Fernsehkonsum in der deutschen Bevölkerung variiert je nach Altersgruppe stark, wobei Menschen über 65 Jahren mehr als 350 Minuten pro Tag fernsehen, während Jugendliche von 14 bis 19 Jahren nur durchschnittlich 30 Minuten täglich fernsehen (ARD, 2023). Nichtsdestotrotz ist in den Jahren 2020 bis 2022 ein Rückgang der Fernsehnutzungsdauer in allen Altersgruppen feststellbar, inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit 2001 (ebd.). Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei der Gesamtauflage deutscher Tageszeitungen: gemessen am 2. Quartal 2022 ist die Rate auf 11,7 Millionen verkaufte Exemplare gesunken, verglichen mit dem 2. Quartal 1991 hat sich die Gesamtauflage nahezu halbiert (BDZV, 2022). Das schlägt sich auch auf die Umsätze der Branche aus, die im Jahr 2021 bei 6,9 Mrd. Euro lagen und laut Prognose weiter sinken werden (ebd.). In Bezug auf Reichweite liegen Online-Zeitungen mit 56,7% inzwischen vor den Printausgaben, die eine Reichweite von 54,1% aufweisen (ZMG, 2022).
Die tägliche Nutzungsdauer von sozialen Medien hat weltweit von 2012 bis 2018 zugenommen, von durchschnittlich 90 Minuten pro Tag auf 138 Minuten (GWI, 2018). Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland mit 89 Minuten weit hinten im Ranking der 16- bis 64-jährigen Nutzer (We Are Social, Hootsuite & DataReportal, 2022). Der generationelle Unterschied bei der Fernsehnutzungsdauer dreht sich bei Social Media um: Wie aus der folgenden Grafik ersichtlich wird, liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer von sozialen Medien der 14- bis 24-Jährigen an Werktagen bei 129 Minuten, während sie bei den 55- bis 69-Jährigen bei etwa 75 Minuten liegt (BDVW, 2019).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Durchschnittliche Nutzungsdauer von sozialen Medien pro Werktag nach Altersgruppen in Deutschland im Jahr 2019 (BDVW, 2019)
Technologische Fortschritte im Zusammenhang mit dem Aufstieg des Internets haben eine Transformation des Medienumfelds bewirkt: Der Zugang zu zahlreichen, vielfältigen und vor allem kostenlosen Informationen auf verschiedenen Endgeräten ermöglicht neue Formen der Partizipation. Nachrichteninteressierte Personen nutzen aktiv die Interaktionsmöglichkeiten sozialer Medien, um Nachrichten zu erhalten, zu teilen und zu kommentieren, wobei mehr Nutzer eine zwanglose und passive Nutzung bevorzugen (Al- Quran, 2022, S. 148). Heutzutage sind nicht mehr allein die Journalisten der Print- und Rundfunkmedien die Gatekeeper3, die darüber entscheiden, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Als Folgeeffekt der gestiegenen Nutzung digitaler Plattformen, konkurrieren etablierte Medienunternehmen mit alternativen Nachrichtenportalen, die sich nicht dem Mainstream zuordnen lassen, um die Kontrolle über die öffentliche Agenda (Wallace, 2018. S. 275). Dezentralisierte Gatekeeper, in Form von Algorithmen, ermöglichen es nicht-journalistischen Akteuren, eine alternative soziale Realität zu kreieren, insbesondere wenn der traditionelle Journalismus bestimmte Nachrichten ignoriert. Konsequenzen dieser Entwicklung sind beispielsweise ein allgemein gestiegenes Misstrauen gegenüber dem Journalismus als auch staatliche Beschränkungen auf Social-Me- dia-Plattformen (ebd., S. 289).
Menczer & Hills (2020) argumentieren außerdem, dass soziale Medien die durch Echokammern und Bots bedingte Verbreitung von Falschmeldungen und Manipulation zwar eindämmen, aber es besteht Unschlüssigkeit darüber, was letztendlich als falsch oder manipulativ gilt (S. 61). „Free communication is not free“ (ebd.).
Mit sinkenden Informationskosten nimmt gleichzeitig der Wert von Information ab (ebd.). Damit eine Grundlage für eine gesunde Informationskultur geschaffen wird, muss ein besseres Verständnis dafür entwickelt werden, wo die Schwachstellen des menschlichen Geistes liegen und wie die Wirtschaftlichkeit von Informationen dazu beitragen kann, Nutzer vor Irreführung zu schützen (ebd.). Schlussendlich bringen sowohl klassische als auch soziale Medien ihre Vor- und Nachteile mit sich. Statt sie als koexistierende, voneinander isolierte Medien zu sehen, sollten sie als sich ergänzende und harmonisierende Medienformen betrachtet werden (Al-Quran, 2022, S. 157). Durch die Kombination ihrer jeweiligen Stärken können Zielgruppen wachsen und dazu mit einer höheren Frequenz erreicht werden. Mit einer verstärkten Verknüpfung beider Medientypen lassen sich die jeweiligen Schwächen mildern und überwinden (ebd.).
3 Einflussfaktoren zur Nutzerbewertung politischer Beiträge
Nachdem im Theorieteil der tiefgehende Einfluss sozialer Medien im Vergleich zum Nutzungsverhalten klassischen Medien hinsichtlich öffentlicher Meinungsbildung und der veränderten politischen Kommunikationskultur aufgegriffen wurde, erfolgt nun die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Faktoren, die die Nutzerbewertung politischer Beiträge auf Social Media beeinflussen. Diese Faktoren existieren nicht isoliert voneinander, sondern stehen in einem Interdependenzverhältnis zueinander und können sich gegenseitig verstärken oder abschwächen. Daher ist Ziel der literarischen Analyse, ein umfassendes Bild dieser Dynamiken zu visualisieren, um die Mechanismen hinter den Nutzerbewertungen verständlich zu machen. Zur detaillierten Untersuchung der jeweiligen Einflussfaktoren wird auf die Erkenntnisse einschlägiger Fachliteratur zurückgegriffen.
3.1 Interne Einflussfaktoren
Die internen Einflussfaktoren beziehen sich auf jene Faktoren, die unabhängig von subjektivem Nutzerverhalten und Nutzertyp auftreten. Im Vordergrund stehen also Merkmale, die politische Absender verschiedener Strömungen aus kommunikationsstrategischen Gründen anwenden, um Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse der Rezipienten maßgeblich zu beeinflussen. Sie werden zunächst aus Sicht der formalen Charakteristika heraus beleuchtet, also medial-visuelle und textuelle Aspekte sowie politische Nutzerinteraktion und Dialogbereitschaft. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den inhaltlichen Charakteristika wie Themenwahl, Emotionalität & Framing, sowie Authentizität und Charisma der politischen Inszenierung auf sozialen Medien.
3.1.1 Formale Charakteristika
Die formalen Charakteristika beziehen sich primär auf die Effekte der strukturellen Elemente eines Social-Media-Beitrags in Form des gewählten Medientyps der politischen Akteure und ihrer Interaktionsbereitschaft mit den Nutzern. Der inhaltliche Kontext wird dabei nur oberflächlich aufgegriffen.
3.1.2 a Beitragstyp Bild & Video
Um die Auswirkungen politischer Posts auf die Nutzerwahrnehmung und -bewertung im Kontext von Bild und Video als Beitragstypen nachvollziehen zu können, sollte zunächst ein Blick auf die möglichen Medienformate der wichtigsten sozialen Netzwerke geworfen werden.
YouTube und TikTok sind in erster Linie Videoplattformen. Facebook und Twitter erlauben Text-, Bild-, und Videobeiträge, wobei sich Twitter-Content vorrangig auf textbasierte Kurznachrichten verlagert. Instagram hingegen unterstürzt lediglich das Bild- und Videoformat (Ross, 2023). Den politischen Parteien und ihren Vertretern steht somit eine Reihe von Kanälen zur strategischen Kommunikation mit den Bürgern zur Verfügung.
Eine Medienformatanalyse der Facebook-Seiten der Parteien und Spitzenkandidaten zur Europawahl 2019 hat die Häufigkeit von Fotos und Videos im digitalen Wahlkampf untersucht. Die LINKE setzte am häufigsten auf Videos (61,4% aller Posts), gefolgt von CDU (46,1%) und den Grünen (44,2%), die anderen Parteien lagen allesamt bei Werten über 20% (Fuchs, Holnburger, Brodnig & Hammer, 2019, S. 27f). Der meistverwendete Beitragstyp war hingegen das Foto, allein bei der CSU lag der Wert bei 73%, auch SPD, FDP und Die PARTEI hatten hier einen anteiligen Wert von über 60% (ebd.). Andere Medienformate spielten nur eine geringfügige Rolle, lediglich Die PARTEI, Die LINKE und AfD setzten noch dazu auf Beiträge mit Links (5% bis 18% aller Posts) (ebd.). Bei den Facebook-Seiten der Spitzenkandidaten dominierten ebenfalls Fotos (27% bis 69% aller Posts), gefolgt von Videos (18% bis 43%) (ebd., S. 28).
Um die Wirkung der gewählten Medienformate auf die Nutzerinteraktion nachvollziehen zu können, ist ein Blick auf die Nutzerresonanz nötig. Shahbaznezhad, Dolan & Rashidirad (2022) untersuchten die Wirksamkeit von Facebook- und Instagram-Content hinsichtlich der Nutzerinteraktionen anhand eines Datensatzes von 1.038 Posts, 1.336.741 Likes und 95.996 Kommentaren (S. 47). Die Ergebnisse zeigen, dass die Wirksamkeit von rationalen, emotionalen und transaktionalen Inhalten auf sozialen Medien stark mit dem gewählten Medienformat (Foto vs. Video) und der Social-Media-Plattform (Facebook vs. Instagram) zusammenhängt (ebd., S. 62). Entscheidet man sich für das Foto als entsprechendes Format bei rationalem Content, so kommt es zu deutlich mehr “Gefällt mir“-Angaben als zu Kommentaren. Andererseits regt das Video-Format bei emotionalem Inhalt die Nutzer zu einer deutlich aktiveren Beteiligung in den Kommentaren an (ebd.).
In einer weiteren Studie wurde in zwei Experimenten die Wahrnehmung visueller politischer Inhalte bei jungen Menschen analysiert. Zum einen wurde die Aufmerksamkeitsspanne und das Erinnerungsvermögens zu politischen Inhalten untersucht und zum anderen die Reaktionen auf politische Videoinhalte unterschiedlicher Genres (Eremenko, Chentsova & Kuzmenko, 2021, S.1). Die Messungen weisen darauf hin, dass politische Videoinhalte eine höhere Interaktionsrate aufweisen als Foto- und Grafikinhalte (ebd., S. 5). Videoreportagen über interaktive Ereignisse, Memes und Fotos von politischen Ereignissen haben bei den Jugendlichen das größte Interesse auf sich gezogen (ebd.).
Der Politikwissenschaftler Robert Bleiker betont, dass durch den Umgang politischer Bilder in der digitalen Ära aktuell eine Revolution der visuellen Kommunikation durchlaufen wird, da die Trennung zwischen Sendern und Empfängern bzw. Produzenten und Konsumenten von Bildern zunehmend versiegt (Bernhardt & Liebhart, 2020, S. 121). Beeinflusst wird diese Entwicklung durch die virale und potenziell globale Verbreitung von Bildern online sowie die demokratische Zugänglichkeit zur Herstellung und Bildbearbeitung durch Smartphones (ebd.). Diese Auffassung teilen auch Müller & Geise und ergänzen, dass Bilder ihren ursprünglichen Bedeutungszusammenhängen entnommen werden und damit neue Bildkontexte in der Produktion und Rezeption geschaffen werden (ebd.).
3.1.3 b Beitragstyp Text
Der Umgang mit jedem Medium erfordert bei Rezipienten und Produzenten sog. „Kulturtechniken“, also Grundlagenkompetenzen wie Lesen, Sprechen und Schreiben bis hin zur „Viewing Literacy“, um beispielsweise Filme mit ihren Zeichen, Bildern und Tönen nachvollziehen zu können (Klemm, 2018, S. 9). Im Kontext sozialer Medien gilt diese Regel ebenfalls, wobei sich die Nutzer den Kommunikationsformen und deren zugrundeliegenden „Logiken“ anpassen müssen (ebd.). Da Facebook-Posts im Gegensatz zu Twitter-Posts keiner Zeichenbegrenzung unterliegen, können sie sich neben ihrer umfangreicheren Länge auch in der Natur ihres Dialogs unterscheiden. Begünstigt durch die häufig auftretenden Diskussionen in den Kommentaren sind Facebook-Posts zumeist argumentativer, dialogischer und persistenter als die kurzen, vorübergehenden Tweets (ebd., S. 24). Um kommunikative Risiken zu minimieren, muss einerseits eine durchdachte Argumentationsstrategie vorliegen sowie ein Verständnis der kommunikationsstrukturellen Unterschiede beider Plattformen (ebd.).
Im Kontext dieser Differenzen variieren die Kommunikationsstrategien je nach Partei. Die rechtspopulistische FPÖ präsentiert sich rhetorisch auf Facebook beispielsweise bürgernah und kumpelhaft: Die Community wird mit „Liebe Freunde“ angesprochen und geduzt, häufig werden Emojis eingesetzt (Fuchs et al., 2019, S. 45). Diese strategischen Elemente dienen vorrangig zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls (ebd.). Wie effektiv diese Strategie bei der Stammwählerschaft gefruchtet hat, scheint sich in Folge des IbizaSkandals gezeigt zu haben. Selbst nach Veröffentlichung des Videos haben viele Parteianhänger der FPÖ ihre fortwährende Unterstützung mit dem Hashtag #jetzterstrecht bekundet (ebd.).
Die politische Sprache auf Twitter hingegen ist zwar geprägt durch Heterogenität und Vielfalt, zeigt allerdings kaum neue Narrative auf im Vergleich zur Kommunikation aus der Offline-Welt (García-Orosa & López, 2019, S. 107). Aufgrund der begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Kurznachrichtendient machen sich Politiker diese Limitationen zunutze, indem sie mit einer einzigartigen sprachlichen Identität die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen (ebd., S. 119). Zu den typografischen Merkmalen dieser Identität zählen ein eigenes Vokabular, Hashtags, Symbole, Links, Syntax sowie das bewusste Verwenden oder Weglassen bestimmter Elemente (ebd.). Ebenjene Merkmale werden an das soziale Netzwerk angepasst und gezielt ausgewählt, um eine eindeutige Autorschaft des Absenders unabhängig vom Inhalt zu gewährleisten. Solche individualisierten Strategien kreieren die linguistische Identität von Twitter (ebd., S. 118).
Sicherlich sind 140 Zeichen oft ausreichend, um prägnante Meinungsäußerungen zu Donald Trump, Hillary Clinton oder zum Brexit kundzutun. Fraglich ist allerdings, wie angemessen komplexe Themen in dieser Kürze behandelt werden können, beispielsweise über die Folgen des Brexits. Unterhaltsamkeit und rhetorisches Geschick sind grundsätzlich gerne gesehen bei Politikern und können durchaus ihre Sachkompetenz bereichern, sollten sie allerdings nicht ersetzen (Metz, 2019, S.47f). Politische Akteure verlieren dabei oft das Gespür für einen geeigneten Ton und mögliche Nutzerreaktionen auf ihre Tweets (ebd., S. 48). Grünen-Politikerin Renate Künast beispielsweise erntete heftige Kritik auf ihren Tweet „[...] Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden???? [...]“ (Künast, 2016), als ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling nach einem islamistisch motivierten Angriff vier Menschen in einem Regionalzug schwer verletzt hatte und im anschließenden Gefecht mit der Polizei tödlich getroffen wurde. Künast wurde Täter-Opfer-Umkehr und unberechtigte Kritik an der Polizei seitens der Community vorgeworfen (ebd., S. 47). Später räumte sie ein, dass Tweets offenbar viel zu kurz seien, um auf solche gewalttätigen Attacken angemessen zu reagieren (ebd.).
Bei der Betrachtung, ob Politiker nun auf eine textzentrierte oder bildzentrierte Kommunikationsstrategie setzen, darf eine grundsätzliche Prämisse nicht außer Acht gelassen werden: Politische Akteure nutzen die Möglichkeiten sozialer Medien primär zum Zwecke der professionellen Selbstrepräsentation (Donges, 2022, S. 221). Mehrere empirische Studien haben ergeben, dass vor allem private und emotionale Einblicke in Form von Bildern dabei deutlich mehr Resonanz erzeugen als politische Textbotschaften (ebd.). Die Instagram-Kanäle der Parteien setzen deshalb primär auf eine Kombination aus Text- und Bild-Content, während Politiker als Einzelpersonen vor allem durch Bilder und die Formulierung individueller Botschaften ihr Profil schmücken. Somit ergänzen sich die Kommunikationsstrategien der Parteien und Politiker als Selbstvermittler wechselseitig und können den Journalismus als Fremdvermittler dabei effektiv umgehen (ebd.).
3.1.1 c Nutzerinteraktion & Dialogbereitschaft
Über den Beitragstyp hinaus, den politische Akteure in Form von Text, Bild oder Video auf Social Media verbreiten, spielt weiterhin die Dialogbereitschaft und die parasoziale Interaktion im Kommentarbereich eine nicht zu vernachlässigende Rolle in der Nutzerbewertung. Die Kommentarfunktion gilt auf Social Media als die Kommunikationsschnittstelle, durch die Plattformen den Nutzern Anschlusskommunikation ermöglichen, um auf veröffentlichte Inhalte reagieren zu können (Schmidt & Taddicken, 2017, S. 22). In diesem Zusammenhang ist es wichtig auf die partizipative Ungleichheit in sozialen Netzwerken hinzuweisen: Die große Mehrheit der Nutzer (90%) sind passive Beobachter, die lesen und beobachten, sich aber nicht aktiv beteiligen (Nielsen, 2006). Etwa 9% der Nutzer beteiligen sich gelegentlich und lediglich eine sehr kleine Minderheit (1%) trägt zu einem unverhältnismäßig hohem Anteil an Content und Aktivität in Form von Posts und Kommentaren bei (ebd.). Die Nutzerbereitschaft, auf bereits veröffentlichte Nutzerkommentare selektiv zu reagieren, wird bedingt durch konkrete Diskussionsfaktoren, die sich aus der Nachrichtenwerttheorie ableiten lassen: Provokationen, Fragen, Zusatzwissen und Themenabweichung lösen in der Regel eine feedbackgenerierende Wirkung aus (Ziegele, Breiner & Quiring, 2015, S. 253). Fragen, die den Nutzer zum Nachdenken anregen, sowie Provokationen, die ihn in seinen persönlichen Überzeugungen touchieren, steigern seine kognitive Beteiligung. Beiträge anderer, die den Nutzer empören und somit ggf. negative Emotionen auslösen, deuten auf eine verstärkt affektive Beteiligung hin (ebd.).
Interaktion im Online-Kontext erlaubt es politischen Akteuren mit Bürgern in einen direkten, dialogischen Austausch zu treten. Trotz der erleichternden Möglichkeiten, die das Web 2.0 bietet, deuten empirische Ergebnisse darauf hin, dass Politiker mehrheitlich nach wie vor auf einen unidirektionalen Kommunikationsstil in sozialen Medien setzen, ähnlich wie in den klassischen Massenmedien (Steppat & Castro Herrero, 2021). Zu diesem Schluss kommt auch Emmer (2017), solche Phänomene zeigen sich neben Deutschland auch in der Schweiz und in Australien (S. 64). In der in 3.1.1.1 und 3.1.1.2 erwähnten Studie zum Social-Media-Wahlkampf der Europawahl 2019, wurden 365.016 Facebook- Kommentare und 10.077 Tweets unter anderem in Bezug auf die Dialogfähigkeit der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten ausgewertet (Fuchs et al., 2019, S. 41). Die AfD erhielt dabei die meisten Nutzerkommentare, was zwar auf eine sehr aktive Community hindeutet, allerdings reagierten Spitzenkandidat Meuthen und seine Partei mit einer Antwortquote von lediglich 0,1% nur sehr selten auf Kommentare (ebd. S. 22). Ein ähnlich geringes Interesse an Dialog wiesen auch CDU und Die PARTEI auf. FDP, SPD und Grüne reagierten hingegen am häufigsten auf Nutzerkommentare, wobei die FDP mit einer Antwortquote von 10% bei über 15.000 Kommentaren das effektivste Community-Management aufwies (ebd.). Von den Spitzenkandidaten hatte einzig Özlem Demirel von der Linkspartei eine verhältnismäßig hohe Antwortquote (14,3% bei 797 Nutzerkommentaren), die anderen Kandidaten bewegten sich in einem überschaubaren Bereich von 0,0% bis 2,3%. Die meisten Kandidaten haben das Dialogpotenzial sozialer Medien kaum erfasst und nur schwach ausgeschöpft (ebd., S. 22).
Um die Rolle der Interaktionsdynamik zwischen Nutzer und Politiker zu verstehen, ist eine Systematisierung der einzelnen Interaktionstypen hilfreich. Im Rahmen einer norwegischen Umfragestudie wurden Interaktionen zwischen Nutzern und politischen Akteuren auf Social Media, speziell Facebook und Twitter, untersucht (Kalsnes, Larsson, Enli, 2017). Dabei wurden drei Nutzerpraktiken identifiziert, die als „connected af- fordances“ bezeichnet wurden: „Acknowledging“ bedeutet das „Gefällt mir“ klicken bzw. favorisieren von Beiträgen; „Redistribution“ bezieht sich auf die Verbreitung von Content über die Teilen-Funktion auf Facebook bzw. die Retweet Funktion auf Twitter; Zuletzt sind mit „Interaction“ die Interaktionsmöglichkeiten über Kommentare, Erwähnungen und Chats gemeint (ebd.). Die häufigste Interaktionsform ist das „Acknow- ledging“ (Liken/Favorisieren), welche von 37,7%, der Bürger und 28,2% der Politiker aktiv genutzt wird. Allerdings wurde diese Form als „Clicktivismus“ kritisiert, da die politische Teilnahme hier nur sehr begrenzt ist (ebd.). Die „Redistribution“ (Teilen/Retweet) wird seltener genutzt, mit 12,2% der Befragten, die politische Beiträge auf Social Media teilen und 12,3%, die „Shares“ von Politikern erhalten haben (ebd.). Überraschenderweise gaben mehr Befragte an (22,4%), mit Politikern über Kommentare (Facebook) und Erwähnungen (Twitter) zu interagieren (ebd.). Insbesondere auf Twitter scheint ein erhöhtes Interaktionspotenzial von politischen Akteuren vorhanden zu sein, da Bürger auf Facebook eher dazu geneigt sind, Politikern lediglich passiv zu „folgen“ (ebd.).
3.1.2 Inhaltliche Charakteristika
Sowohl die Wahl des Beitragsmediums als auch die verschiedenen Kommunikations- und Diskussionskulturen auf Facebook und Twitter scheinen demnach mit der parteipolitischen Online-Interaktion, der Nutzerbewertung und -wahrnehmung zusammenzuwirken. Darüber hinaus soll im Folgenden die andere Seite der externen Einflussfaktoren beleuchtet werden: Die inhaltlichen Charakteristika. Im Kontext politischer Kommunikation wird analysiert, inwiefern inhaltliche Schwerpunktsetzung, Emotionalisierung und Inszenierung eines Themas bzw. eines politischen Akteurs eine Einflussnahme auf die Nutzerbewertung bewirkt.
3.1.3 a Themenwahl & Agenda-Setting
Im Agenda-Setting-Konzept werden zwei Seiten eines Themas beleuchtet: die Relevanz, die einem Thema von medialer Seite beigemessen wird (Media Agenda) und die Relevanz, die das Publikum einem Thema zuspricht (Public Agenda). Erfasst wird sie über repräsentative Befragungen oder die Auswertung öffentlicher Meinungsäußerungen auf sozialen Netzwerken (Bulkow & Schweiger, 2013, S. 174f). Daneben gibt es noch die politische Agenda, sie hat in diesem Fall eine Sonderstellung, da das politische System durch seine Entscheidungsmacht die Umwelt der anderen Akteure beeinflusst (Schmid- Petri, 2012, S. 43f). Die indirekte Wechselwirkung zwischen politischer und Publikumsagenda wird durch die Medien oder sog. „real-world-factors“, also gesamtgesellschaftliche Gegebenheiten, beeinflusst (ebd.).
Agenda Setting zielt im politischen Kontext darauf ab, bewusst thematische Schwerpunkte in der öffentlichen Wahrnehmung zur eigenen Profilierung festzulegen (Wiebach, 2021, S. 298f). Problematisch ist dabei der Einsatz von Social Bots im Sinne einer koordinierten Verbreitung von Falschinformationen und vermeintlich relevanter Themen auf sozialen Medien. Sowohl politische Akteure als auch die Medien stehen dabei in der Kritik, Social Media Trends oft unkritisch widerzuspiegeln, was zu einer manipulierten Medienrealität und politischen Wirklichkeit führen kann (ebd., S. 299). Dieses Phänomen wird auch als „Informationskrieg“ bezeichnet (ebd.). Mit dem Ziel, die eigene Agenda umzusetzen, versuchen politische Akteure in ihrem kommunikativen Handeln die freie Zustimmung der Rezipienten durch argumentative Mittel zu erlangen (Thummes, 2019, S. 186).
Die traditionelle Medienagenda, die Social-Media-Agenda der Parteien und die SocialMedia-Agenda von Politikern beeinflussen sich zwar gegenseitig, jedoch wird keine der Agenden von den anderen übermäßig beeinflusst (Gilardi, Gessler, Kubli & Müller, 2021, S. 41). Untersucht wurde das anhand der Themen Umwelt, Geschlechtergleichheit, Europa und Immigration. Einzige Ausnahme besteht beim Thema Umwelt, wo die SocialMedia-Agenda der Parteien die Medienagenda stärker vorgibt als umgekehrt (ebd.). In einer 2015 veröffentlichten Studie ließ sich wechselseitiges Agenda-Setting in Abhängigkeit der Themenwahl zwischen Twitter-Posts politischer Kandidaten und amerikanischen Top-Zeitungen nachweisen (Gleich, 2019, S. 134). Auch eine weitere Analyse des intermedialen Agenda-Settings im Online-Kontext am Beispiel der Berichterstattung rund um den NSA-Abhörskandal zeigte Einflüsse von Social Media auf die Online-Berichterstattung traditioneller Medien, wie Spiegel online oder SZ online (ebd.).
Interessant ist in diesem Kontext weiterhin eine Wortanalyse über die europapolitische Schwerpunktsetzung in der Social-Media-Kommunikation deutscher Parteien und Spitzenkandidaten zur Europawahl 2019. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass SPD und FDP ihre Forderungen über Facebook und Twitter besser vermitteln konnten als die anderen Parteien. Insbesondere die Grünen setzten thematisch auf Schlagwörter aus der Klima- und Umweltpolitik (Fuchs et al., 2019, S. 28ff). In der Parteikommunikation auf Facebook haben CDU, SPD und FDP das Thema Europa intensiv mit ihren jeweiligen Forderungen verbunden, bei den anderen Parteien ergab sich ein undurchsichtigeres Bild. Typische Buzzwords waren bei der AfD „Deutschland“, bei der CSU „Sicherheit und Frieden“ und bei der SPD „Soziales und Frieden“ (ebd., S. 34ff). Eine weitere Auswertung der Twitter-Nutzung republikanischer und demokratischer Gouverneure in den USA ergab, dass demokratische Gouverneure deutlich mehr Wörter und weitreichendere, diversere Hashtags nutzten als republikanische Gouverneure. Jedoch war das durchschnittliche Volumen an Tweets bei Vertretern beider Parteien ähnlich (Yang, Chen, Maity & Ferrera, 2016, S. 337).
Darüber hinaus haben Forschende aus der Schweiz und den Niederlanden in einer Studie anhand von Twitter-Profilen fiktiver Politiker untersucht, inwiefern die befragten 4300 Personen aus Deutschland und der Schweiz verschiedene politische Kommunikationsstrategien wahrnehmen (Giger, Bailer, Sutter, Turner-Zwinkels, 2021, S. 3). Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten Tweets stärker wertschätzten, je konkreter der politische Inhalt war (ebd., S. 8). Posts über das Privatleben der politischen Person schreckten dabei eher ab. Dieser policy-orientierte Stil scheint sich auf Twitter unter Politikern allerdings nur schwach durchgesetzt zu haben (ebd.). Diese Befunde stehen in Kontrast zu den in 3.1.1.2 beschriebenen Erkenntnissen über hohe Nutzerresonanz auf privat-emotionalen Bild-Content. In den USA hingegen ist die persönliche Fokussierung auf einzelne Politiker deutlich präsenter (ebd.).
3.1.2b Emotionalität & Framing
Framing definiert sich als die spezifische Hervorhebung und Problemdefinition wahrgenommener Aspekte der Realität, mit dem Ziel, eine moralische Bewertung oder Handlungsempfehlung des beschriebenen Themas zu fördern (Schemer, 2013, S. 157). Unterscheiden lässt sich Framing in zweierlei Hinsicht: Zum einen episodisches Framing, was die dramatische mediale Darstellung bestimmter Fallbeispiele beinhaltet und zum anderen thematisches Framing, was sich auf sachliche, faktenbasierte Hintergrundberichte bezieht. Rezipienten führen bei episodischem Framing politische Probleme eher auf individuelle Ursachen zurück, während bei thematischem Framing tendenziell stärker der Gesamtkontext mit gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekten berücksichtigt wird (ebd., S. 157f). Interessant ist demnach die Betrachtung der angewandten Frames von Parteien und Politikern aus verschiedenen Lagern.
Degen & Olgemöller (2023) überprüften, inwiefern radikale Parteien stärkere Tendenzen zur Nutzung emotionaler Kommunikationselemente aufwiesen (S. 47f). Die Analyse basierte auf der Auswertung der Emotionen Wut, Zorn, Angst, Enthusiasmus und Humor, die in den Facebook-Beiträgen verschiedener Parteien vermittelt wurden. Die Befunde, visualisiert in der folgenden Abbildung, legen nahe, dass insbesondere die radikalere Parteien eine Präferenz für Wut und Zorn aufzeigen, positive Emotionen kommen selten zum Vorschein. Die moderaten Parteien tendieren hingegen zu einer sachorientierten und emotionsreduzierten Kommunikationsstrategie (ebd.).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Verwendung von Emotionen in den Facebook-Beiträgen deutscher Parteien (Degen & Olgemöller, 2023, S. 48)
Die AfD setzt in ihrer Wahlkampfkommunikation besonders auf die „Fear“-Mechanis- men, also eine angstbetonte Strategie. Beispielhaft dafür sind Facebook-Posts, in denen die AfD die Wahlversprechen anderer Parteien in rot (negativ) und die eigenen Programmpunkte in grün (positiv) einfärbt. Dieser Ansatz korrespondiert mit dem Konzept des „Loss Aversion Bias“, wonach Menschen Verluste stärker gewichten als Gewinne, was zu unterschiedlichen Wahrnehmungen des gleichen Arguments führen kann (Johann & Dombrowski, 2023, S. 154f). Solche Framing-Effekte können das Wahlverhalten maßgeblich beeinflussen, insbesondere das Zurückgreifen auf Verlust-Frames. Wahlmobilisierung funktioniert dann effektiver, wenn potenzielle Verluste, wie beispielweise erhöhte Arbeitslosigkeit, stärker bei einer Nichtteilnahme an der Wahl hervorgehoben werden als positive Aspekte (ebd.).
Welche zentrale Rolle Emotionen in Bezug auf die Verbreitung parteipolitischer Inhalte auf Social Media spielen, zeigt eine Auswertung der Emoji-Reaktionen auf Facebook- Beiträge deutscher Parteien und Spitzenkandidaten (Fuchs et al., 2019, S. 23ff). Die AfD ruft bei Nutzern gezielt negative Reaktionen hervor, wie beispielsweise das „Angry“- Emoji, bei anderen Parteien überwiegen positive Reaktionen wie „Love“ oder „Haha“. Die in den Nutzerkommentaren verwendeten Emojis spiegeln eine ähnliche Tendenz wider, wobei das Emoji mit den lachenden Tränen am häufigsten zum Einsatz kommt (ebd.). Neben dem blauen Herzen in der Kommentarsektion der AfD, dem grünen Herz bei den Grünen, dominiert auf den Facebook-Seiten aller Spitzenkandidaten unter anderem der Daumen nach oben (ebd.). Die Twitter-Kommunikation zeigt ebenfalls die Verwendung verschiedener Emojis, die von Partei zu Partei variieren, beispielsweise die Europaflagge bei Manfred Weber (CDU) und Katarina Baley (SPD) oder das Sonnenblumen-Emoji bei den Grünen. Die gleichen Emojis aus den Facebook-Kommentaren finden sich mit geringfügigen Abweichungen auch auf Instagram und YouTube wieder, wobei die Insta- gram-Kommentare einen positiveren Ton aufweisen als auf YouTube (ebd.). Dies scheint auch eine der Hauptgründe dafür zu sein, warum viele politische Akteure für ihre Kommunikation auf Instagram zurückgreifen, da die Plattform als eine Art „Wohlfühl-Netzwerk“ fungiert (ebd.).
3.1.2.c Authentizität & Charisma
Die Online-Präsenz von Politikern kann zwar als Spiegelbild der politischen Persönlichkeit und Stimme betrachtet werden, allerdings adaptieren Politiker neue Kommunikationstechnologien primär aus strategischen Gründen (Gaden & Dumitrica, 2014, S. 11f). Meist werden diese Profile jedoch von PR-Managern verwaltet, was einen persönlichen Anstrich vermissen lässt und eine große Lücke zum direkten Diskurs mit den Bürgern hinterlässt (ebd.). Junge Menschen in Deutschland beurteilen die Online-Kommunikation von Politikern häufig als unauthentisch. Unabhängig davon ob offline oder online vermittelt, Politiksprache wird mehrheitlich als fremd empfunden (Hügelmann, 2023, S. 91). Das erweitert die Kluft zwischen jungen Bürgern und Politikern (ebd.).
Gutes politisches Management versteht die Wählerschaft als Konsequenz eines guten Charakters. In der modernen politischen Öffentlichkeit werden dabei zwei Tendenzen sichtbar: die Präsidialisierung von Macht, also Machtkonzentration auf politische Führer, und verstärktes Interesse am Privatleben der Politiker, ähnlich zu Prominenten aus dem Sport- und Entertainmentbereich (Gaden & Dumitrica, 2014, S. 12). Amerikanische Wähler streben dabei nach authentischen Politikern in Social-Media-Wahlkampagnen. Politische Authentizität in den USA ist allgemein ein zentraler Aspekt einer Wahlkampfkultur, in der versucht wird, das authentifizierte Image des politischen Gegners auseinanderbrechen zu lassen (Grow, & Ward, 2013, S. 2). Politiker, die auf Facebook Bilder aus ihrem Privatleben posten, Informationen zur eigenen Ausbildung und Leadership-Erfahrung preisgeben und auf Nutzerkommentare eingehen, einschließlich Kritik, werden von Nutzern als authentisch wahrgenommen (ebd., S. 9). Eine Befragungsstudie von Hellweg (2011) ergab, dass signifikante Zusammenhänge zwischen der Vertrauenswürdigkeit, der Wählbarkeit und der Persönlichkeit eines Politikers über sein Social-Media-Profil bestehen (S. 22). Eigenschaften, die von den Befragten besonders hervorgehoben wurden, waren Professionalität, persönliche Ausstrahlung, Zugänglichkeit, Offenheit und Vertrauenswürdigkeit (ebd., S. 29f).
Um den Anspruch auf Authentizität überzeugend darzustellen, setzen einige politische Größen dabei auf charismatische Inszenierung (Kissas, 2020, S. 268). Charismatische Führungspersönlichkeiten bauen emotionale Verbindungen zu ihren Anhängern über das Gefühl einer gemeinsamen Identität und Zweckbestimmung im Kampf gegen die
Gefahren eines Volkes auf (ebd., S. 271). Die Dimensionen von Charisma lassen sich über vier archetypische Figuren definieren: Den Vater, als Autoritätssymbol und Zentralisierung von Macht; den Helden, als das Ideal des Erfolgs mit individueller Ermächtigung; den Retter, als Löser dringlicher Probleme; und den König, als Führungsfigur mit besonderen Qualitäten (Steyrer, 1998, S. 823f). Eine Analyse der Tweets von Donald Trump und Jeremy Corbyn zeigte, dass sich Trump durch einen nationalistisch-exkludi- erenden Stil auszeichnet und Corbyn durch einen sozialistisch-egalitären Stil (Kissas, 2019, S. 279). Beide Politiker eint, dass sie die Wurzel der Probleme im Establishment sehen und sich selbst als die Retter des Volkes darstellen (ebd.). Twitter als fruchtbarer Boden der politischen Selbstinszenierung wird oft dafür kritisiert, Politikern zu viel Raum zur Kommunikation über sich selbst zu geben, anstatt zur Direktkommunikation mit den Wählern angeleitet zu sein (ebd., S. 272).
3.2 Externe Einflussfaktoren
Die externen Einflussfaktoren konzentrieren sich auf jene Elemente der Nutzerbewertung politischer Posts, die unabhängig von der politischen Kommunikation ausgehen. Der Fokus liegt dabei zum einen auf demografisch-individuellen Faktoren bezüglich Alter, Geschlecht, Medienkompetenz und geografische Gegebenheiten. Im zweiten Teil wird auf die Einflüsse von Algorithmen, Bots und Filterblasen der Social-Media-Plattformen eingegangen.
3.2.1 Demografie der Nutzer
Twitter-Profile und politische Blogs sind nur ein Teil eines riesigen Angebotsspektrums zur Selbstinszenierung und Meinungsäußerung politischer Akteure. Allerdings wird diese ausgedehnte Kommunikatorrolle in der Bevölkerung nur schwach wahrgenommen; Gründe dafür sind soziodemographische Faktoren und Einstellungsmerkmale (Dohle et al., 2014, S. 424). Dazu gehören individuelle Aspekte wie Alter, Geschlecht und Wohnort. Ebenjene Faktoren, die für politische Ansprachen traditionell von Interesse sind, sind infolge der Digitalisierung um ein Vielfaches erweitert worden (Donges, 2022, S. 218). Präzise Mikrodaten können, je nach Höhe der Auflösung, inzwischen vorhersagen, welche politische Orientierung ein Mensch hat (ebd.).
Wie in Abschnitt 2.3 bereits angeführt, gibt es signifikante Unterschiede in der Nutzung klassischer Medien versus Online-Medien zwischen den älteren und jüngeren Altersgruppen. Eine Studie von Holt, Shehata, Strömbäck & Ljungberg (2013) kam zu dem Schluss, dass sich ebenso die Nutzung von Medien für politische Zwecke unterscheidet, wobei jüngere Gruppen häufiger soziale Medien nutzen und ältere Gruppen mehr Aufmerksamkeit auf Fernsehnachrichten, Zeitungen und Radio richteten (S. 30f). Bemerkenswert ist, dass sowohl die Aufmerksamkeit für politische Inhalte in traditionellen als auch auf sozialen Medien positive Auswirkungen auf das politische Interesse und die politische Teilnahme in der Offline-Welt haben (ebd.). Letzten Endes kann Social Media somit als Kompensator für generationelle Unterschiede in der politischen Beteiligung betrachtet werden (ebd., S. 20). Trotz der These, dass Social-Media-Nut- zung die politische Beteiligung offline fördert, erscheint ein bestimmtes Phänomen paradox: Die Wahlbeteiligung innerhalb der jungen Bevölkerung ist trotz des rasanten Anstiegs sozialer Medien weiterhin signifikant geringer als unter der älteren Bevölkerungsschicht (Matthes, 2022, S. 11).
Abb. in Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl nach Altersgruppen und Anteil der 14- bis 29-jährigen Nutzer sozialer Medien (Matthes, 2022, S. 11)
Eine Reihe von Faktoren könnte dafür verantwortlich sein, möglich auch der sogenannte „Vampir“-Effekt: Eine hohe Intensität an unterhaltsamen, nicht-politischen Inhalte auf sozialen Medien lenken junge Menschen letzten Endes zu stark ab, wenn sie gleichzeitig politischem Content ausgesetzt sind (ebd., S. 18).
Junge Nutzer neigen stärker dazu, Links und eigene Gedanken zu politischen Themen auf Social Media zu teilen, entsprechenden Gruppen und Kandidaten zu folgen und politische Inhalte anderer zu liken und zu teilen (Rainie, Smith, Schlozman, Brady & Verba, S. 2, 2012). Da traditionelle Medien in der direkten Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern mittels sozialer Medien umgangen werden können, ist speziell die Präsentationsform eines politischen Akteurs online ein relevanter Schlüsselaspekt: besonders bei der jungen Generation kommen Politiker gut an, die sich eher von ihrer Seite als „ganz normale“ Person aus der Mitte der Gesellschaft präsentieren, entgegen ihrer Seite als „offizielle“ politische Persönlichkeit (Marquart, Ohme & Möller, 2020, S. 196f).
Neben dem Alter ist möglicherweise auch das Geschlecht der Nutzer ein interessantes Augenmerk. Laut einer Befragung unter deutschen Internet-Usern nutzen 75% der Frauen Social Media, während der Anteil unter den befragten Männern bei 77% liegt (Faktenkontor, 2021). Eine größere Lücke zeigt sich in der Geschlechterverteilung im politischen Leben, die Sitzverteilung im 20. Deutschen Bundestag beispielsweise weist einen Männeranteil von 64,95% und einen Frauenanteil von 35,05% auf (Deutscher Bundestag, 2023). Unter den Nutzern scheint es kein markantes „Gender Gap“ zu geben, was die politische Interaktion auf Social Media betrifft. Sowohl Männer als auch Frauen sind in vielerlei Hinsicht auf Augenhöhe in politischen Online-Aktivitäten involviert, beispielsweise das Kommentieren und Reagieren auf politische Beiträge (Bode, 2020). Frauen posten zwar seltener politische Beiträge und tendieren schneller dazu, bei politischen Meinungsverschiedenheiten Kontakte aus der Freundesliste zu entfernen, jedoch scheinen die geschlechtsspezifischen Unterschiede im politischen Verhalten auf sozialen Medien weitaus geringer zu sein als bisher angenommen (ebd.). Im Rahmen einer israelischen Studie wurden die Likes, Shares und Kommentare politischer Beiträge während der Wahlkampfzeit gemessen und auf die Nutzerbewertung hinsichtlich des Geschlechts der politischen Kandidaten geprüft (Yarchi & Samuel-Azran, 2018, S. 985). Bei den Beiträgen von Politikerinnen tritt ein höhere Nutzerinteraktion auf im Vergleich zu den männlichen Kandidaten (ebd., S. 981). Diese Ergebnisse sind kohärent mit vergangenen Studien, die gezeigt haben, dass Frauen allgemein verstärkter Rückmeldungen auf SocialMedia-Posts erhalten (ebd.).
Weiterhin lassen sich die Medienkompetenz und das Bildungsniveau von Nutzern als denkbare Faktoren in Betracht ziehen. Medienkompetenz bezeichnet gemeinhin die Fähigkeit eines Individuums, auf alle Kommunikationsformen zuzugreifen, diese zu analysieren, zu bewerten, zu erstellen und darauf zu reagieren (Kahne & Boyer, 2019, S. 212f). Das sollte auf eine Art und Weise geschehen, in der das Individuum selbst und sein reales und virtuelles soziales Umfeld davon profitiert (Hipeli & Süss, 2013, S. 203). Die Nutzung angebotener Medieninformationen führt mit einer erhöhten Medienkompetenz, in Kombination mit mehr Vorwissen und einer selektiveren Informationsauswahl, allgemein zu einer optimaleren Ausgangslage für Höhergebildete (Zillien, 2013, S. 497). Die traditionell auf Rundfunk- und Printmedien ausgelegte Medienkompetenz der Bürger stößt dabei an ihre Grenzen, da die Kluft zwischen erforderlicher und vorhandener Medienkompetenz, vor allem in Bezug auf Medienwissen und der Beurteilung von digitalen Medieninhalten, zunehmend wächst (Schweiger, 2017, S. 108). Besonders betroffen sind dabei die Älteren „Digital Immigrants“ hinsichtlich ihrer Nutzungsfähigkeiten im Umgang mit neuen Medien, allerdings lassen sich generationenübergreifend auch bei den Jüngeren Schwierigkeiten in der Beurteilung von Nachrichtenqualität und -glaubwürdigkeit feststellen (ebd., 108f). Diejenigen Bürger, die in sozialen Medien mit politischem Content interagieren, sind zumeist selbst politisch interessiert und aktiv, besitzen die notwendigen digitalen Kompetenzen und haben einen Hochschulabschluss (Kahne & Boyer, 2019, S. 220). Merkmale einer gesellschaftlichen Besserstellung, also ein hohes Bildungsniveau, hohes Einkommen, männliches Geschlecht und niedriges Alter, scheinen dazu die individuelle Redebereitschaft positiv zu beeinflussen (Neubaum, Cargnino & Berthele, S. 118). Politisches Interesse, persönliche Relevanz und Selbstsicherheit hinsichtlich der eigenen Meinung sind ergänzende positive Faktoren, während sich soziale Befangenheit und die Tendenz zur Selbstzensur negativ auswirken (ebd.). Letztendlich ist der Zusammenhang zwischen Bildung und politischer Partizipation, also damit auch der Nutzerbewertung politischer Posts auf Social Media, trotzdem schwierig nachzuweisen. Studien dazu zeigen widersprüchliche Ergebnisse auf, da sich Bildung in Kombination mit politischer Beteiligung nicht klar von Faktoren wie familiärer Voraussetzungen und sozialem Status abgrenzen lässt (Jakobs & Schwab, 2023, S. 7f).
Zuletzt liegen noch partizipative Unterschiede in Abhängigkeit von geografischen Gegebenheiten im Fokus. Das Gefälle zwischen urbanen und ländlichen Gegenden, bezogen auf den Zugang zu bestimmten Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern sowie politische Veranstaltungen, wurde bereits in der Vergangenheit zwar registriert, aber als verfassungsmäßig unbedenklich eingestuft (Heise, 2015, S. 337). Es wird erwartet, dass sich der mündige Staatsbürger mit neuen Technologien auseinandersetzt. Ein Ausbau der digitalen Partizipationsmöglichkeiten setzt allerdings in objektiver Hinsicht einen leistungsfähigen Internetzugang voraus und in subjektiver Hinsicht die Fähigkeit, diesen entsprechend nutzen zu können (ebd.). Neben der Kluft zwischen Stadt und Land sind daneben noch Diskrepanzen zwischen Ost- und Westdeutschland sichtbar. Eine 2017 ausgewertete Mediennutzungsanalyse zu politischer Teilnahme hat gezeigt, dass die Beteiligungsquote durch das Liken politischer Posts im Osten inzwischen stärker ist als im Westen (35% versus 27%), im Kommentieren und Teilen sind die Westdeutschen minimal aktiver (Maier, S. 310ff). Signifikante Unterschiede zeigen sich darin, dass Nutzer in
Westdeutschland deutlich gewillter sind, Politiker direkt zu kontaktieren. (ebd., S. 322). Dazu ist das Vertrauen in Parteien in den neuen Bundeländern allgemein schwächer ausgeprägt (Jakobs & Schwab, 2023, S. 24). Nichtsdestotrotz sind in vielerlei Hinsicht nur geringfügige Unterschiede zwischen beiden Landesteilen erkennbar (Maier, S. 340).
3.2.2 Algorithmen, Bots und Filterblasen
Welchen machtvollen Einfluss Algorithmen haben, wird unter anderem in Form der Filterfunktionen großer Datenkonzerne wie Google oder Facebook sichtbar, da mithilfe manipulativer Wahrnehmungseinschränkungen der Meinungsbildungsprozess beeinflusst wird (Thimm & Bürger, 2015, S. 288). Die Konzeption und Anwendung von Social Bots und deren Algorithmen unterliegen dabei stets den Weltbildern und Überzeugungen der Nutzer und der Entwickler (Verständig, 2020, S. 37). Da Algorithmen und Bots kein eigenes Bewusstsein haben, kann die Unvorhersehbarkeit ihrer Ergebnisse nicht ausschließlich auf menschliche Ausdrucksabsichten zurückgeführt werden (Richter, 2022, S. 138).
Zusätzlich steuern Facebook- und YouTube-Algorithmen dazu bei, dass politische Werbung von Parteien nur an bestimmte Personen mit entsprechend angenommenen Interessen ausgespielt wird (Jaursch, 2023, S. 265). User-Targeting dieser Form ist sicherlich sinnvoll für Parteien, kann jedoch eine zunehmende Segmentierung der Wählerschaft und somit eine verkleinerte Zielgruppe bewirken (ebd.). Auch eine quantitative Datenanalyse mit 386 Studenten von Claud & Kadil (2023) kommt zu dem Schluss, dass Social-Media- Algorithmen Einfluss auf die politischen Ansichten der Befragten haben (S. 1). Die plattformübergreifende, wiederholte Anzeige zusammenhängender Inhalte auf TikTok, Facebook, Twitter und YouTube hat einen nachweislichen Effekt auf die politische Nutzerperspektive (ebd.). Die AfD schafft es, mithilfe des Facebook-Algorithmus ihre Beiträge einem besonders empfänglichem Publikum zu präsentieren, das durch zahlreiche Likes, Shares und Kommentare eine hohe Nutzeraktivität aufweist (Degen & Olgemöller, 2023, S.53). Trotz ähnlich populistischer Kommunikationsmuster gelingt kleineren Randparteien die Hürde zu einer vergleichbaren Reichweite nicht (ebd.).
Nur etwa 48% der Interaktionen im Internet stammen von echten Menschen, während die übrigen 52% von Bots generiert werden (Oswald, 2018, S. 27). Die Arten von Bots reichen dabei von simplen, automatisierten Alltagsprogrammen bis hin zu menschlichen Imitationsbots, Hacker- und Spam-Bots (ebd.). Insbesondere zu Wahlkampfzeiten machen Bots einen nicht zu unterschätzenden Teil des Social-Media-Contents aus: In den USA stammten währenddessen ca. 25% aller geteilten Tweets von Bots, in Deutschland lag dieser Wert noch unter 10% (ebd.). Im Rahmen einer Sentiment-Analyse zur US- Präsidentschaftswahl 2016 wurde die Stimmung unter Trump- und Clinton-Anhängern auf Twitter in Abhängigkeit von menschlichen bzw. bot-generierten Tweets untersucht. Dafür wurde unter Verwendung der Twitter Search API mittels bestimmter Hashtags und Schlüsselwörter über 20 Millionen Tweets ausgewertet, von denen voraussichtlich 3,8 Millionen von Bots generiert wurden (Bessi & Ferrera, 2016). Eine beträchtliche Anzahl positiver Trump-Tweets impliziert den Eindruck natürlicher Unterstützung, allerdings stammten diese in übermäßigen Mengen von Bots. Die Tweets zugunsten von Clinton wiesen eine ausgewogenere Verteilung positiver und negativer Tweets auf, was für eine authentischere Stimmungsverteilung unter den Anhängern spricht (ebd). Die Forschenden heben dabei hervor, dass die Präsenz von Social Bots in politischen Online-Diskussionen zur zunehmenden Polarisierung des politischen Diskurses und zur ungefilterten Verbreitung von Fehlinformationen beitragen (ebd.). Eine Analyse der Tweets großer Parteien in Spanien, Kanada, Japan, den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich hat einen konsistenten Trend in sechs der sieben Länder nachgewiesen, in denen rechtsgerichtete Tweets signifikant stärker ausgespielt wurden im Vergleich zu linksgerichteten Tweets (Huszar, Ktena, O’Brien, Belli, Schlaikjer & Hardt, 2021, S. 4ff).). Einzig in Deutschland konnte keine Signifikanz festgestellt werden (ebd.). Big Data und Algorithmen sind zumindest teilweise verantwortlich für den gespaltenen politischen Diskurs vieler Demokratien (Cho, Ahmed, Hilbert, Liu & Luu, 2020, S. 16f). Algorithmische Empfehlungen, die auf personalisierten Nutzerverhaltensdaten basieren, haben das Potenzial dazu, Nutzer in ihren politischen Überzeugungen zu festigen und radikale Meinungen zu fördern (ebd.).
Der Diskussion über Social Bots und Algorithmen liegt darüber hinaus das Thema Filterblasen nicht fern. Filterblasen bzw. Echo-Kammern sind Darstellungen in einem ideologischen Spektrum, in denen bestimmte Ansichten kontinuierlich wiederholt und bestätigt werden (Oswald, 2018, S. 19). Möller (2021) hebt hervor, dass eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Annahmen und den empirischen Nachweisen von Filterblasen in ihrer tatsächlichen Erscheinungsform existiert (S. 96). Menschen streben sowohl offline als auch online nach Bestätigung der eigenen Überzeugungen (ebd.). Algorithmische Filtersysteme fördern allerdings grundsätzlich politische Meinungsvielfalt, politisch Radikale, die sich online mit Gleichgesinnten vernetzen wollen, sind davon ausgenommen (ebd.). Der diskursive Fokus auf Filterblasen und Echokammern lenkt zu stark davon ab, wie Intermediäre und Plattformen Informationswirtschaftlichkeit prägen (ebd.). Problematisch sind nicht die Echokammern selbst, sondern die mit dem Internet begünstigten Vernetzungsmöglichkeiten für politisch Extreme. Die Hemmschwelle, ihre Meinungen auch außerhalb ihrer Echokammer zu äußern, sinkt dadurch stetig, was zu einer Überrepräsentation radikaler Meinungen und einem verzerrten Meinungsklima im gesamtgesellschaftlichen politischen Diskurs führen kann (Magin, Geiss, Jürgens & Stark, 2019, S. 112). Auch Personen, die das Internet nicht als politische Informationsquelle nutzen, können von Medienberichten über Hate-Speech in Online-Diskussionen beeinflusst werden und die augenscheinliche Radikalisierung des politischen Diskurses aufgreifen (ebd.).
4 Diskussion
Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass politische Akteure sich verschiedene Social-Media-Strategien zunutze machen, um die Aufmerksamkeit der Nutzerschaft zu gewinnen. Entscheidend ist dabei unter anderem die Wahl des Medienformats und die Verwendung der Interaktionsmöglichkeiten. Insbesondere mit dem Einsatz von Videos und Bildern werden hohe Interaktionsraten generiert, vor allem bei der auf sozialen Medien jungen Anhängerschaft. In diesem Kontext kommt es auch auf die kommunikationsstrategische Abstimmung zwischen den Politiker-Profilen und den Partei-Kanälen an. Um sich Social-Media-Plattformen als politischen Kommunikationskanal zu Nutze zu machen, sind spezifische Kompetenzen über die Differenzen der Sprachkulturen und Interaktionslogiken einzelner Plattformen erforderlich. Facebook-Posts gelten dabei als argumentativer und dialogischer als Tweets, während die politische Sprache auf Twitter in Anbetracht der begrenzten Äußerungsmöglichkeiten durch mehr Heterogenität geprägt ist. Hierbei lässt sich feststellen, dass die Dialogbereitschaft und ein weitreichendes Interaktionsspektrum zwischen Nutzern und Politikern zwar vorhanden ist, aber das mögliche Interaktionspotenzial aufgrund der Passivität der Nutzermehrheit nicht ausgereizt wird. Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass politische Akteure Gefahr laufen, unkritisch Social-Media-Trends widerzuspiegeln, was zu einer verzerrten politischen Wirklichkeit führen kann, da die über Social Media vermittelte politische Agenda die traditionelle Medienagenda maßgeblich beeinflusst. Radikalere Parteien neigen außerdem dazu, in ihrer Online-Kommunikation negative Emotionen und Verlust-Frames zu nutzen, während moderatere Parteien eine sachorientierte Strategie bevorzugen. Außerdem spiegeln Be- wertungs-Emojis die emotionale Reaktion der Nutzer auf politische Inhalte wider.
Weiterhin wird die Online-Präsenz von Politikern oft von PR-Managern verwaltet, was zu einem Mangel an persönlichem Austausch mit den Bürgern führt. Junge Menschen in Deutschland empfinden deshalb die Online-Kommunikation von Politikern häufig als unauthentisch. Die Vertrauenswürdigkeit, Wählbarkeit und Persönlichkeit eines Politikers können über sein Social-Media-Profil beeinflusst werden. Einige Politiker setzen dabei auf charismatische Inszenierung, um den Anspruch auf Authentizität zu unterstreichen. Die ausgedehnte Kommunikationsrolle politischer Akteure wird in der Bevölkerung oft schwach wahrgenommen, was sich auf soziodemographische Faktoren und Einstellungen zurückzuführen lässt.
Die Nutzung von klassischen Medien und Online-Medien unterscheidet sich intergenera- tionell, wobei jüngere Menschen deutlich häufiger soziale Medien nutzen. Die politische Interaktion auf Social Media kann zwar politische Beteiligung kompensieren, aber die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen bleibt im Vergleich zur älteren Bevölkerung trotzdem gering. Geschlechtsspezifische Unterschiede im politischen Verhalten auf sozialen Medien sind geringer als erwartet, bezogen auf Reaktivität erhalten weibliche Politiker allerdings stärkere Resonanz. Verstärkte Medienkompetenz, politisches Interesse und die individuelle Redebereitschaft gehen zwar positiv mit erhöhter Nutzeraktivität auf politischen Content einher, wobei festzuhalten ist, dass das Bildungsniveau bezogen auf politische Partizipation sich nicht eindeutig von anderen Faktoren abstrahieren lässt. Es gibt zwar Unterschiede in den politischen Partizipationsmöglichkeiten zwischen urbanen und ländlichen Gegenden sowie Nutzungsdifferenzen zwischen Ost- und Westdeutschland, wobei diese Unterschiede marginal sind.
Überdies ermöglichen Facebook- und YouTube-Algorithmen eine gezielte Ausrichtung politischer Werbung auf bestimmte Zielgruppen, was zu einer zunehmenden Aufspaltung der Wählerschaft führen kann. Algorithmische Empfehlungen und Filterblasen tragen dazu bei, dass Nutzer in ihren politischen Überzeugungen bestärkt werden und darüber hinaus radikale Meinungen gefördert werden. Personen, die das Internet nicht als politische Informationsquelle nutzen, können dennoch von Medienberichten über polarisierende Hassrede beeinflusst werden. Echokammern selbst stellen dabei nicht zwingend das Grundproblem dar, sondern die Möglichkeit für politisch Extreme, sich online zu vernetzen und radikale Meinungen zu verstärken. Die Hemmschwelle, diese Meinungen auch außerhalb der Filterblase zu äußern, kann dementsprechend sinken, was zu einer Überrepräsentation radikaler Meinungen und einem verzerrten Meinungsklima im gesamtgesellschaftlichen politischen Diskurs führen kann.
5 Limitationen & Ausblick
Bezogen auf die Forschungsfrage wurde ersichtlich, dass sowohl die benannten internen als auch externen Faktoren einen maßgeblichen Einfluss auf die Nutzerbewertung politischer Posts auf sozialen Medien nehmen; ausgenommen der demografischen Aspekte Geschlecht und geografische Gegebenheiten, hier scheint es kaum nachweisliche Einflüsse zu geben. Die letztendliche Wirkung der analysierten Charakteristika ist im Kontext ihres Ausmaßes und ihrer Systematik jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar und zuordenbar. Es muss dringend betont werden, dass das Bewertungsverhalten zu politischen Beiträge auf sozialen Medien einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Bedingungen hervorgeht. Es lässt sich dabei nicht eindeutig feststellen, in welchen Größenordnungen sich die herausgestellten Faktoren gegenseitig beeinflussen. Im Zuge der Literaturanalyse wurde nach Möglichkeit auf die neuesten Forschungsergebnisse der gegebenen Studienlage zurückgegriffen. Eine eigene Operationalisierung ist infolge des fehlenden empirischen Praxisbezugs nicht vorhanden. Da keine eigenen Daten erhoben wurden, ist eine empirische Bestätigung kausaler Zusammenhänge demzufolge nicht vorhanden, die Ergebnisse beruhen auf der Auswertung und Interpretation der Literatur. Demnach sind auch keine neuen Erkenntnisse an sich gewonnen worden; die Befunde des bestehenden Forschungsstands wurden miteinander verglichen und systematisiert. Die Trennschärfe zwischen wissenschaftlichen Befunden aus der strategischen Kommunikationsforschung und der Mediennutzungsforschung ließ sich dabei ebenfalls nicht eindeutig herauskristallisieren. Da soziale Medien ein sehr schnelllebiges und dynamisches Forschungsfeld sind, ist eine aktuelle Gültigkeit der Erkenntnisse nicht zwingend gegeben. Um ein präziseres Verständnis für die jeweiligen Faktoren und ihre wechselseitigen Wirkungsmechanismen zu entwickeln, sind weitere Studien in der Mediennutzungsforschung und der Rezeptionsforschung nötig. Geeignet wären vor allem experimentelle Studien, um anhand konkreter manipulierbarer Variablen Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu untersuchen.
Literaturverzeichnis
Alm, N. (2022). Makromediale Transformationen. In Alm, N., Murschetz, P.C., Weder, F., Friedrichsen, M. (Hrsg.), Die Digitale Transformation der Medien (S. 3-21). Springer Gabler.
Al-Quran, M. (2022). Traditional media versus social media: challenges and opportunities. Technium 4 (10), 145-160.
ARD. (2023, 2. Mai ). Fernsehkonsum: Tägliche Sehdauer der Deutschen in Minuten nach Altersgruppen in den Jahren 2021 und 2022 [Graph]. In Statista. Zugriff am 28. Juni 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2913/umfrage/fern- sehkonsum-der-deutschen-in-minuten-nach-altersgruppen/
BDVW. (2019, 17. Oktober). Durchschnittliche Nutzungsdauer von sozialen Medien pro Werktag nach Altersgruppen in Deutschland im Jahr 2019 [Graph]. In Statista. Zugriff am 28. Juni 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/stu- die/1060757/umfrage/durchschnittliche-nutzungsdauer-von-social-media-pro- werktag-nach-altersgruppen-in-deutschland/
BDZV. (2022, 8. August). Entwicklung der verkauften Auflage der Tageszeitungen in Deutschland im jeweils 2. Quartal ausgewählter Jahre von 1991 bis 2022 (in Millionen Exemplaren) [Graph]. In Statista. Zugriff am 28. Juni 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72084/umfrage/verkaufte-auflage- von-tageszeitungen-in-deutschland/
Bernhardt, P., Liebhart, K. (2020). Wie Bilder Wahlkampf machen. Mandelbaum.
Bessi, A., Ferrara, E., (2016). Social bots distort the 2016 U.S. Presidential election online discussion. First Monday, 21(11). https://doi.org/10.5210/fm.v21i11.7090
Bode, L. (2020). Political Gender Gap? Not on Social Media. Gender Policy Report. https://genderpolicyreport.umn.edu/political-gender-gap-not-on-social-media/
Buchholz, K. (2022, 7. Oktober). The Rapid Rise of TikTok [Graph]. In Statista. Zugriff am 17. Juni 2023, von https://www.statista.com/chart/28412/social-media-users- by-network-amo/
Bulkow, K. & Schweiger, W. (2013). Agenda Setting - zwischen gesellschaftlichem Phänomen und individuellem Prozess. In Schweiger, W., Fahr, A. (Hrsg.), Handbuch Medienwirkungsforschung, (S. 171-190). Springer VS.
Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1), 46-65. Routledge.
Cho, J., Ahmed, S., Hilbert, M., Liu, B., & Luu, J. (2020). Do Search Algorithms Endanger Democracy? An Experimental Investigation of Algorithm Effects on Political Polarization. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 64(2), 1-23.
Claud, F., & Kadil, A. R. G. L. (2023). Effects of Social Media Algorithms on the Political Views of the Students. 8th International "Baskent" Congresses on Physical, Social and Health Sciences. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4349833
Degen, M., & Olgemöller, M. (2023). Populistische Kommunikation auf Facebook - Social-Media-Postings radikaler und moderater Parteien im Corona-Wahlkampf. In Fuchs, M., Motzkau, M. (Hrsg.), Digitale Wahlkämpfe, (S. 39-55). Springer VS.
Deutscher Bundestag. (2023, 17. April). Anteil der Frauen im 20. Deutschen Bundestag nach Fraktionen im Jahr 2023. [Graph]. In Statista. Zugriff am 24. Juli 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1063172/umfrage/frauenanteil-im- bundestag-nach-fraktionen-in-deutschland/
Dohle, M., Jandura, O., & Vowe, G. (2014). Politische Kommunikation in der OnlineWelt. Dimensionen des strukturellen Wandels politischer Kommunikation. Zeitschrift Für Politik, 61(4), 414-436. Nomos.
Donges, P. (2022). Digitalisierung der politischen Kommunikation. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 74, 209-230.
Duggan, M., & Smith, A. (2016). The Political Environment on Social Media. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2016/10/25/the-political-en- vironment-on-social-media/
Emmer, M. (2017). Soziale Medien in der politischen Kommunikation. In Schmidt, J.- H., & Taddicken, M. (Hrsg.), Handbuch Soziale Medien, (S. 57-80). Springer VS.
Emmer, M., & Wolling, J. (2010). Online-Kommunikation und politische Öffentlichkeit.
In Schweiger, W., & Beck, K. (Hrsg.). Handbuch Online-Kommunikation, (S. 3658). Verlag für Sozialwissenschaften.
Eremenko, Y., Chentsova, A., & Kuzmenko, A. (2021). Research of visual political communication perception by youth: psychophysiological approach. SHS Web of Conferences, 94, 03002. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219403002
Faktenkontor. (2021, 24. Juni). Anteil der befragten Internetnutzer, die Social Media nutzen, nach Geschlecht in Deutschland im Jahr 2020/21 [Graph]. In Statista. Zugriff am 24. Juli 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1031476/um- frage/nutzung-von-social-media-in-deutschland-nach-geschlecht/
Friedrichsen, M. (2014). Einsatz von Social Media im politischen Umfeld - Partizipationsgedanke in der Politik 2.0. In Friedrichsen M. & Kohn, R. (Hrsg.), Digitale Politikvermittlung, (S. 233-266). Springer VS.
Fuchs, M., Holnburger, J., Brodnig, I., Hammer, L. (2019). Wie funktioniert Social-Me- dia-Wahlkampf?. Friedrich-Ebert-Stiftung.
Gaden, G., & Dumitrica, D. (2014). The ‘real deal’: Strategic authenticity, politics and social media. First Monday, 20(1). https://doi.org/10.5210/fm.v20i1.4985
García-Orosa, B., & López, X. (2019). Language in social networks as a communication strategy: public administration, political parties and civil society. Communication & Society, 32(1), 107-125.
Giger, N., Bailer, S., Sutter, A., & Turner-Zwinkels, T. (2021). Policy or person? What voters want from their representatives on Twitter. Electoral Studies, 74, 102401, 19.
Gilardi, F., Gessler, T., Kubli, M., & Müller, S. (2021). Social Media and Political Agenda Setting. Political Communication, 39(1), 40-56.
Gleich, U. (2019). Agenda Setting in der digitalen Medienwelt. In Media Perspektiven 3/2019, 126-140.
Grow, G., & Ward, J. (2013). The role of authenticity in electoral social media campaigns. First Monday, 18(4). https://doi.org/10.5210/fm.v18i4.4269
Gündüç, S. (2019). The Effect of Social Media on Shaping Individuals Opinion Formation. Complex Networks and Their Applications 8 (2), 376-386. Springer VS.
GWI. (2018, 8. November). Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer von sozialen Medien weltweit in den Jahren 2012 bis 2018 (in Minuten) [Graph]. In Statista. Zugriff am 28. Juni 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/475072/um- frage/taegliche-nutzungdauer-von-sozialen-medien/
Heise, N. (2015). Volkssouveränität und Shitstorm - neue Formen der politischen Willensbildung und verfassungsrechtlicher Rahmen. In Friedrichsen, M., Kohn, R. (Hrsg.), Digitale Politikvermittlung, (S. 323-345). Springer VS.
Hellweg, A. (2011). Social Media Sites of Politicians Influence Their Perception by Constituents. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 2(1), 22-36.
Hipeli, E., Süss, D. (2013). Werther, Soap Stars und Ego-Shooter-Helden: Das Einflusspotenzial medialer Vorbilder. In Schweiger, W., Fahr, A. (Hrsg.), Handbuch Medienwirkungsforschung, (S. 191-205). Springer VS.
Holt, K., Shehata, A., Strömbäck, J., & Ljungberg, E. (2013). Age and the effects of news media attention and social media use on political interest and participation: Do social media function as leveller?. European Journal of Communication, 28(1), 1934.
Hügelmann, B. (2023). Wie junge Menschen Wahlkampf führen. In Fuchs, M., Motzkau, M. (Hrsg.), Digitale Wahlkämpfe, (S. 85-100). Springer VS.
Huszar, F., Ktena, S. I., O’Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2021). Algorithmic amplification of politics on Twitter. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(1), 1-9.
Jakobs, S., Schwab, V. (2023). Partizipation und Parteimitgliedschaft. In Jakobs, S., Schwab, V. (Hrsg.), Mitgliederwerbung in und für Parteien, (S. 6-60). Springer VS.
Jaursch, J. (2023). Fairness im digitalen Wahlkampf: Was Selbstverpflichtungen von Parteien bringen können. In Fuchs, M., Motzkau, M. (Hrsg.), Digitale Wahlkämpfe, (S. 257-274). Springer VS
Jiang, Y. (2022). The Transition and Countermeasures of Traditional Media After Being Impacted by the Advent of Digital Media. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 664. 10.2991/assehr.k.220504.405
Johann, M., & Dombrowski, J. (2023). Nudging in der politischen Online-Kommunikation - Wie die Politik Wahlentscheidungen beeinflusst. In Fuchs, M., Motzkau, M. (Hrsg.), Digitale Wahlkämpfe, (S. 145-162). Springer VS.
Kahne, J., Bowyer, B. (2019) Can media literacy education increase digital engagement in politics?. Learning, Media and Technology, 44(2), 211-224.
Kalsnes, B., Larsson, A. O., & Enli, G. S. (2017). The social media logic of political interaction: Exploring citizens’ and politicians’ relationship on Facebook and Twitter. First Monday, 22(2). https://doi.org/10.5210/fm.v22i2.6348
Kissas, A. (2019). Performative and ideological populism: The case of charismatic leaders on Twitter. Discourse & Society, 31(3), 268-284.
Klemm, M. (2018). Bloggen, Twittern, Posten und Co. Grundzüge einer >Social-Media- Rhetorik<. Rhetorik 36(1), 5-30.
Künast, R. [@renatekuenast]. (2016, 19. Juli). Tragisch und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden???? Fragen! #Würzburg @SZ [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/RenateKuenast/sta- tus/755165764060078081
Magin, M., Geiss, S., Jürgens, P., & Stark, B. (2019). Schweigespirale oder Echokammer? Zum Einfluss sozialer Medien auf die Artikulationsbereitschaft in der Migrationsdebatte. In Weber, P., Mangold, F., Hofer, M., Koch, T. (Hrsg.), Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit, (S. 93-114). Nomos.
Maier, J. (2017). Mediennutzung und politische Partizipation in Ostdeutschland. In Holtmann, E. (Hrsg.), Die Umdeutung der Demokratie: Politische Partizipation in Ost- und Westdeutschland, (S. 291-343). Campus Verlag.
Marquart, F., Ohme, J., & Möller, J. (2020). Following Politicians on Social Media: Effects for Political Information, Peer Communication, and Youth Engagement. Media and Communication, 8(2), 196-207.
Matthes, J. (2022). Social Media and the Political Engagement of Young Adults: Between Mobilization and Distraction. Online Media and Global Communication, 1(1), 622.
Menczer, F., & Hills, T. (2020). Information Overload Helps Fake News Spread, and Social Media Knows It. Scientific American, 323(6), 56-61 .
Metz, D. (2019). Kommunikation in Zeiten des ,Sofortismus‘ - Was der digitale Wandel für Politik, Medien und Gesellschaft bedeutet. In Schlie, U. (Hrsg.), Modernes Regierungshandeln im Zeitalter der Globalisierung, (S. 35-54). Nomos.
Möller, J. (2021). Filter bubbles and digital echo chambers. In Tumber, H., Waisbord, S. (Hrsg.), The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism, (S. 92100). Routledge.
Muhle, F. (2020). Alles Bots?. In Breidenbach, S., Klimczak, P., Petersen, C. (Hrsg.), Soziale Medien, (S. 45-70). Springer Vieweg.
Neubaum, G., Cargnino, M., Berthele, D. (2019). „Das hält unsere Beziehung schon aus“. In Weber, P., Mangold, F., Hofer, M., Koch, T. (Hrsg.), Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit, (S. 115-134). Nomos.
Nielsen, J. (2006). Participation Inequality: The 90-9-1 Rule for Social Features. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/
Oswald, M. & Johann, M. (2021). Strategische Politische Kommunikation als ein interdisziplinäres Forschungsfeld. In Oswald, M., Johann, M. (Hrsg.), Strategische Politische Kommunikation im digitalen Wandel, (S. 1-7). Springer VS.
Oswald, M. (2021). Strategische Politische Kommunikation im digitalen Wandel - ein disruptives Zeitalter?. In Oswald, M., Johann, M. (Hrsg.), Strategische Politische Kommunikation im digitalen Wandel, (S. 7-34). Springer VS.
Rainie, L., Smith, A., Schlozman, K.L., Brady, H., & Verba, S. (2012 ). Social Media and Political Engagement. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/inter- net/2012/10/19/social-media-and-political-engagement/
Rajewsky, I. O. (2005). Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediary. Intermediates / Intermediary, (6), 43-64. https://doi.org/10.7202/1005505ar
Richter, C. (2022). Soziale Medien und Digitale Technologien. In Böhnke, N., Richter, C., Schröder, C., Ide, M., Allert, H. (Hrsg.), Spuren digitaler Artikulationen: Interdisziplinäre Annäherungen an Soziale Medien als kultureller Bildungsraum, (S. 171-224). transcript Verlag.
Ross, M. (2023, 7. Juli). MEDIA ATTACHMENT GUIDE. Social Media Management. https://social-media-management-help.brandwatch.com/hc/en-us/artic- les/4491448747293-Media-Attachments-Guide
Schemer, C. (2013). Priming, Framing, Stereotype. In Schweiger, W., & Fahr, A. (Hrsg.), Handbuch Medienwirkungsforschung (S. 153-170). Springer VS.
Schmid-Petri, H. (2012). Das Framing von Issues in Medien und Politik. Springer VS.
Schmidt, J.-H., & Taddicken, M. (2017). Soziale Medien: Funktionen, Praktiken, Formationen. In Schmidt, J.-H., & Taddicken, M. (Hrsg.), Handbuch Soziale Medien, (S. 23-37). Springer VS.
Schweiger, W. (2017). Informieren und Informiertheit online. In Der (des)informierte Bürger im Netz, (S. 69-112). Springer.
Shahbaznezhad, H., Dolan, R., & Rashidirad, M. (2022). The Role of Social Media Content Format and Platform in Users’ Engagement Behavior. Journal of Interactive Marketing, 53(1), 47-65.
Söder, M. [@csuauftiktok]. (2023, 15. März). Antwort auf @xyz... [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@csuauftiktok/video/7210805800636386565
Steppat, D., & Castro Herrero, L. (2021). Interaction (Election Campaigning Communication). DOCA - Database of Variables for Content Analysis, 1(4). https://doi.org/10.34778/4f
Steyrer, J. (1998). Charisma and the Archetypes of Leadership. Organization Studies, 19(5), 807-828.
Thimm, C., Bürger, T. (2015). Digitale Partizipation im politischen Konflikt - „Wutbürger“ online. In Friedrichsen, M., Kohn, R. (Hrsg.), Digitale Politikvermittlung, (S. 285-305). Springer VS.
Thummes, K. (2019). Meinungen über öffentliche Meinungsmacht. In Weber, P., Mangold, F., Hofer, M., Koch, T. (Hrsg.), Meinungsbildung in der Netzöffentlichkeit, (S. 175-193). Nomos.
Toor, S. I. (2020). Social Media as a Mediator in Political Communication: A Literature Review to Explore its Effects on Users. Global Political Review, V(II), 69-76.
Verständig, D. (2020). Soziale Medien zwischen Disruption und Synthese. In: Breidenbach, S., Klimczak, P., Petersen, C. (Hrsg.), Soziale Medien (S. 25-44). Springer Vieweg, Wiesbaden.
Wallace, Julian (2018). Modelling contemporary gatekeeping: the rise of individuals, algorithms and platforms in digital news dissemination . Digital Journalism 6(3), 274293.
Watts, D. & Dodds, P. (2007). Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. In Journal of Consumer Research, 34(4), 441-458. https://doi.org/10.1086/518527
We Are Social, & Hootsuite, & DataReportal. (2022, 26. Januar). Ranking der Länder mit höchster durchschnittlicher Nutzungsdauer von Social Networks weltweit im Jahr 2021 (in Minuten pro Tag) [Graph]. In Statista. Zugriff am 28. Juni 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160137/umfrage/verweildauer-auf- social-networks-pro-tag-nach-laendern/
Wiebach, N. (2021). Social Bots -wie Algorithmen Meinungen beeinflussen. In Stumpp, S., Michelis, D., Schildhauer, T. (Hrsg.), Social Media Handbuch, (S. 289-308). Nomos.
Xiong, F., & Liu, Y. (2014). Opinion formation on social media: An empirical approach. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 24(1), 013130. https://doi.org/10.1063/1.4866011
Yang, X., Chen, B.-C., Maity, M., & Ferrara, E. (2016). Social Politics: Agenda Setting and Political Communication on Social Media. In International Conference on Social Informatics, (S. 330-344). Springer.
Yarchi, M., & Samuel-Azran, T. (2018). Women politicians are more engaging: male versus female politicians’ ability to generate users’ engagement on social media during an election campaign. Information, Communication & Society, 21(7), 978995.
Ziegele, M., Breiner, T., Quiring, O. (2015). Nutzerkommentare oder Nachrichteninhalte - Was stimuliert Anschlusskommunikation auf Nachrichtenportalen?. In Hahn, O., Hohlfeld, R., Knieper, T. (Hrsg.), Digitale Öffentlichkeit(en), (S. 249-266). Herbert von Halem.
Ziehe, S., Sporleder, C. (2020). Politisches Gezwitscher in Text und Bild. In: Breidenbach, S., Klimczak, P., Petersen, C. (Hrsg.), Soziale Medien (S.159-176). Springer Vieweg.
Zillien, N. (2013). Wissenskluftforschung. In Schweiger, W., Fahr, A. (Hrsg.), Handbuch Medienwirkungsforschung, (S. 495-512). Springer VS.
ZMG. (2022, 18. Oktober). best for planning (b4p): Print- und Onlinereichweite der Zeitungen in Deutschland im Jahr 2022 [Graph]. In Statista. Zugriff am 28. Juni 2023, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/242876/umfrage/print-und-online- reichweite-der-zeitungen-in-deutschland/
[...]
1 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bachelorarbeit das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich allerdings auf alle Geschlechter.
2 Intermedialität dient als ein generischer Begriff für all jene Phänomene, die auf irgendeine Weise grenzüberschreitend zwischen verschiedenen Medien wirken (Rajewsky, 2005, S. 46).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die sich mit dem Thema Politik auf TikTok und sozialen Medien befasst. Es analysiert, wie interne und externe Einflussfaktoren die Bewertung politischer Beiträge durch Nutzer beeinflussen.
Was sind die Hauptthemen, die in diesem Dokument behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen: die Rolle sozialer Medien in der Meinungsbildung und politischen Kommunikation, interne Einflussfaktoren wie formale und inhaltliche Charakteristika von Beiträgen, externe Einflussfaktoren wie Demografie und Algorithmen, und ein Vergleich zwischen klassischen und sozialen Medien.
Welche formalen Charakteristika von politischen Beiträgen werden analysiert?
Die Analyse formaler Charakteristika konzentriert sich auf Beitragstypen wie Bilder, Videos und Texte, sowie auf Nutzerinteraktion und Dialogbereitschaft.
Welche inhaltlichen Charakteristika werden im Dokument untersucht?
Die inhaltlichen Charakteristika, die untersucht werden, beinhalten Themenwahl und Agenda-Setting, Emotionalität und Framing, sowie Authentizität und Charisma.
Welche externen Einflussfaktoren werden betrachtet?
Die externen Einflussfaktoren, die analysiert werden, umfassen die Demografie der Nutzer (Alter, Geschlecht, Bildungsniveau) sowie die Auswirkungen von Algorithmen, Bots und Filterblasen.
Wie vergleicht das Dokument klassische und soziale Medien?
Das Dokument vergleicht klassische Medien (Zeitungen, Radio, Fernsehen) mit sozialen Medien hinsichtlich Nutzungsdauer, Reichweite und der Rolle als Gatekeeper von Informationen. Es werden auch Vor- und Nachteile beider Medientypen diskutiert.
Welche Forschungsfrage wird in der Einleitung formuliert?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern trägt das Zusammenspiel aus internen und externen Einflussfaktoren zur Beitragsbewertung politischer Posts auf sozialen Medien bei?
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese lautet: Die Nutzerbewertung politischer Inhalte auf Social Media wird sowohl von internen als auch von externen Faktoren beeinflusst.
Welche Parteien werden im Text erwähnt?
Im Text werden verschiedene Parteien genannt, darunter AfD, CDU, CSU, FDP, FPÖ, SPD, Die Grünen und Die LINKE.
Was sind Social Bots und welche Rolle spielen Sie?
Social Bots sind Computerprogramme, die politische Kommunikationsprozesse beeinflussen können. Sie können zur Verbreitung von Falschinformationen und zur Manipulation der öffentlichen Meinung beitragen.
Was sind Filterblasen und Echokammern?
Filterblasen und Echokammern sind Umgebungen in sozialen Medien, in denen Nutzer hauptsächlich Informationen und Meinungen sehen, die ihre eigenen Ansichten bestätigen. Dies kann zu einer Verstärkung bestehender Überzeugungen und einer geringeren Exposition gegenüber gegensätzlichen Perspektiven führen.
Welche Rolle spielen Emojis in der politischen Kommunikation?
Emojis spielen eine Rolle in der politischen Kommunikation, da sie die emotionale Reaktion der Nutzer auf politische Inhalte widerspiegeln und von Parteien strategisch eingesetzt werden können.
Was sind die Limitationen der Studie?
Zu den Limitationen der Arbeit gehört, dass keine eigenen Daten erhoben wurden, wodurch eine empirische Bestätigung kausaler Zusammenhänge fehlt. Außerdem ist das Bewertungsverhalten zu politischen Beiträgen auf sozialen Medien einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Bedingungen untergeordnet, wodurch nicht eindeutig festzustellen ist, in welchem Ausmaß sich die Faktoren gegenseitig beeinflussen.
- Quote paper
- Daniel Fischer (Author), 2023, Das Zusammenspiel von Politik und sozialen Medien. Interne und externe Einflussfaktoren auf die Nutzerbewertung politischer Beiträge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1448896