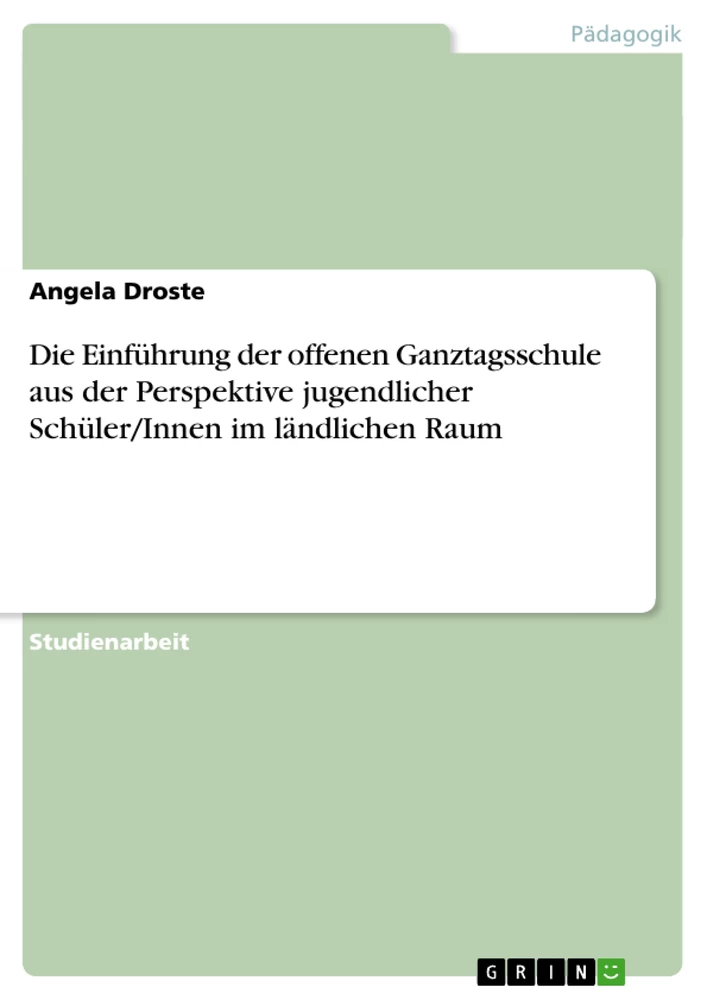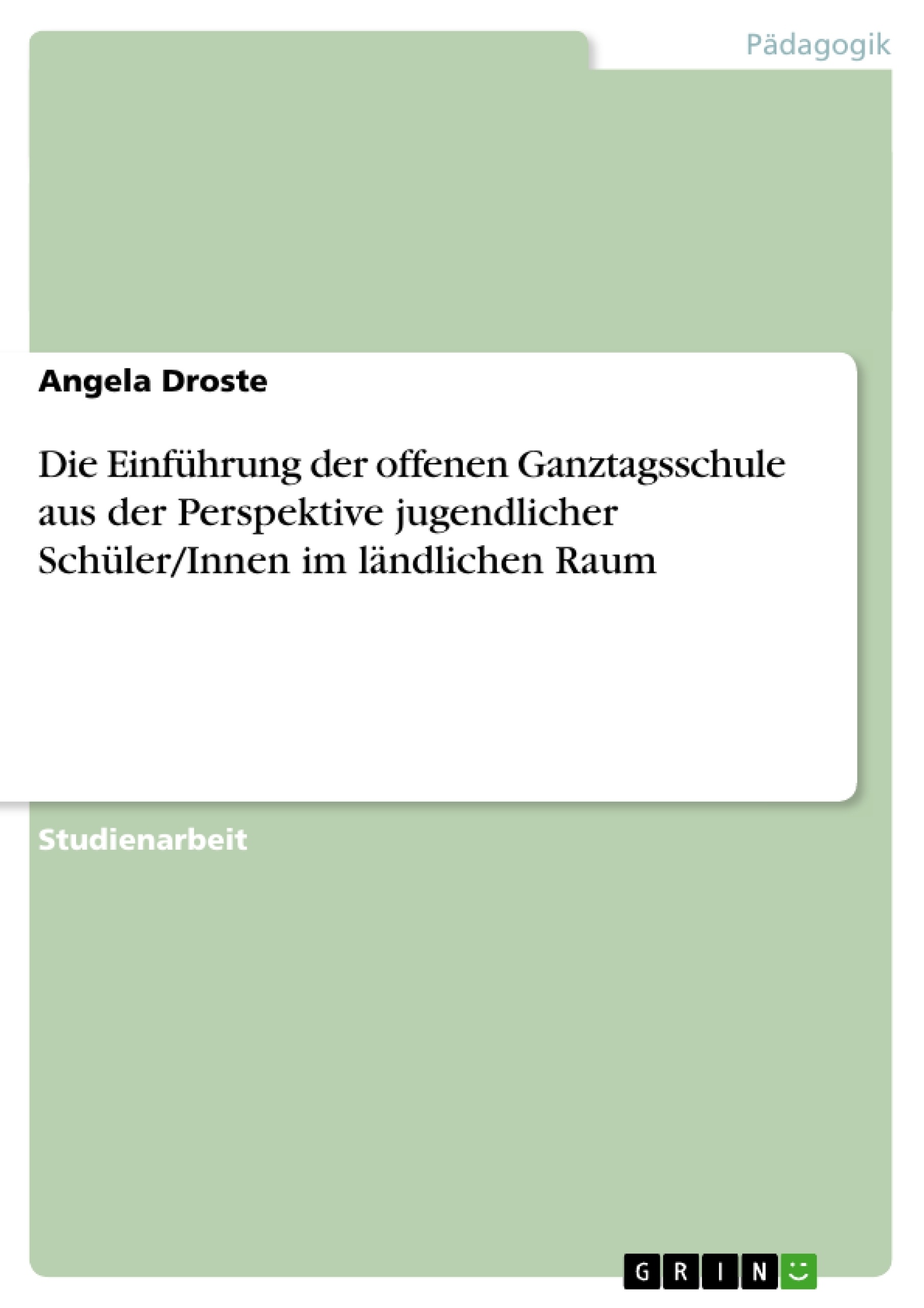In den vergangenen Jahren erlebte der Ausbau der Ganztagsschulen in Deutschland einen starken Auftrieb. Aufgrund des schlechten Abschneidens bei internationalen Vergleichstests, wie zum Beispiel der PISA-Studie, wurde viel über Reformen im deutschen Schulwesen nachgedacht. Eine dieser Reformen beinhaltet den Ausbau der Ganztagsschulen; bisher galt die Halbtagsschule als Regelschule. Von der Einführung ganztägiger Betreuungssysteme erhofft man sich eine bessere Bildung der Schüler/Innen . Sie soll die Möglichkeit einer individuelleren Förderung jedes Einzelnen bieten sowie für eine sinnvollere Freizeitbeschäftigung der Schüler sorgen (Appel & Rutz 2004:22 ff.). Kinder und Jugendliche leben heutzutage in veränderten Bedingungen auf. Die Berufstätigkeit von Frauen hat stark zugenommen; oft sind beide Elternteile berufstätig und immer öfter wachsen Kinder in einer Familie mit nur einem Elternteil auf. Aufgrund dieser Veränderungen ist auch der Wunsch nach ganztägiger Betreuung stark gewachsen. Zusätzlich hat sich das Wohnumfeld von Kindern und Jugendlichen verändert und bietet nur noch im geringeren Maße Raum für Erfahrungen (Appel & Rutz 2004:24 ff.). Dorf- und Nachbarschaftsbeziehungen spielen eine immer geringer werdende Rolle; es ist eine zunehmende Anonymisierung innerhalb des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen spürbar. Die Ganztagsschule bietet dagegen eine gute Möglichkeit, den Rückgang sozialer Kontaktmöglichkeiten zwischen Gleichaltrigen aufzufangen (Appel & Rutz 2004:25). Nachdem in den letzten Jahren viele neue Ganztagsschulen eingerichtet wurden, liegen auch die ersten Studien hierüber vor.
Die vorliegende qualitative Studie soll die Einführung der offenen Ganztagsschule aus der Sicht betroffener Jugendlicher im ländlich strukturierten Raum darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Vorüberlegungen
- 2.1 Ausgangssituation und Stand der Forschung
- 2.2 Forschungsfrage und Hypothesen
- 3. Begriffserklärung „Offene Ganztagsschule“
- 4. Methoden
- 4.1 Qualitative Forschung
- 4.2 Leitfadengestützte Interviews
- 4.3 Analyse von Leitfadeninterviews
- 5. Datenerhebung
- 5.1 Fallauswahl
- 5.2 Vorbereitung des Interviews
- 5.3 Durchführung des Interviews
- 5.4 Reflexion der Datenerhebung
- 5.5 Transkription
- 6. Auswertung
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese qualitative Studie befasst sich mit der Einführung der offenen Ganztagsschule aus der Sicht von Jugendlichen im ländlichen Raum. Die Arbeit untersucht, wie die Ganztagsschule von Jugendlichen im ländlichen Raum wahrgenommen wird und welche Auswirkungen sie auf ihre Bildungs- und Freizeitsituation hat.
- Die Akzeptanz der offenen Ganztagsschule bei Jugendlichen im ländlichen Raum
- Die Auswirkungen der offenen Ganztagsschule auf die Bildungs- und Freizeitsituation der Jugendlichen
- Die Bedeutung der Ganztagsschule im Kontext der Freizeitangebote und der Bildungslandschaft im ländlichen Raum
- Die Rolle der Ganztagsschule in der Entwicklung sozialer Kontakte und der Integration von Jugendlichen im ländlichen Raum
- Die Perspektive der Jugendlichen auf die Organisation und die Qualität der Angebote der offenen Ganztagsschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die aktuelle Situation des Ganztagschulwesens in Deutschland und stellt die Relevanz der Studie vor. Kapitel 2 beschreibt die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es die Ausgangssituation der Jugendlichen im ländlichen Raum und den Stand der Forschung zum Thema Ganztagsschule beleuchtet. Kapitel 3 erläutert den Begriff „Offene Ganztagsschule“ und definiert die in der Studie verwendeten Schlüsselbegriffe. Kapitel 4 stellt die Methoden der Datenerhebung und -auswertung vor, während Kapitel 5 die konkreten Schritte der Datenerhebung und die Reflexion dieses Prozesses beschreibt. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Auswertung und analysiert die Daten aus der Perspektive der teilnehmenden Jugendlichen. Das Fazit in Kapitel 7 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Offene Ganztagsschule, ländlicher Raum, Jugendliche, Akzeptanz, Bildungs- und Freizeitsituation, qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Datenerhebung, Auswertung, Integration, soziale Kontakte, Freizeitangebote, Bildungslandschaft, Entwicklung, Organisation, Qualität.
- Citar trabajo
- Angela Droste (Autor), 2008, Die Einführung der offenen Ganztagsschule aus der Perspektive jugendlicher Schüler/Innen im ländlichen Raum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144817