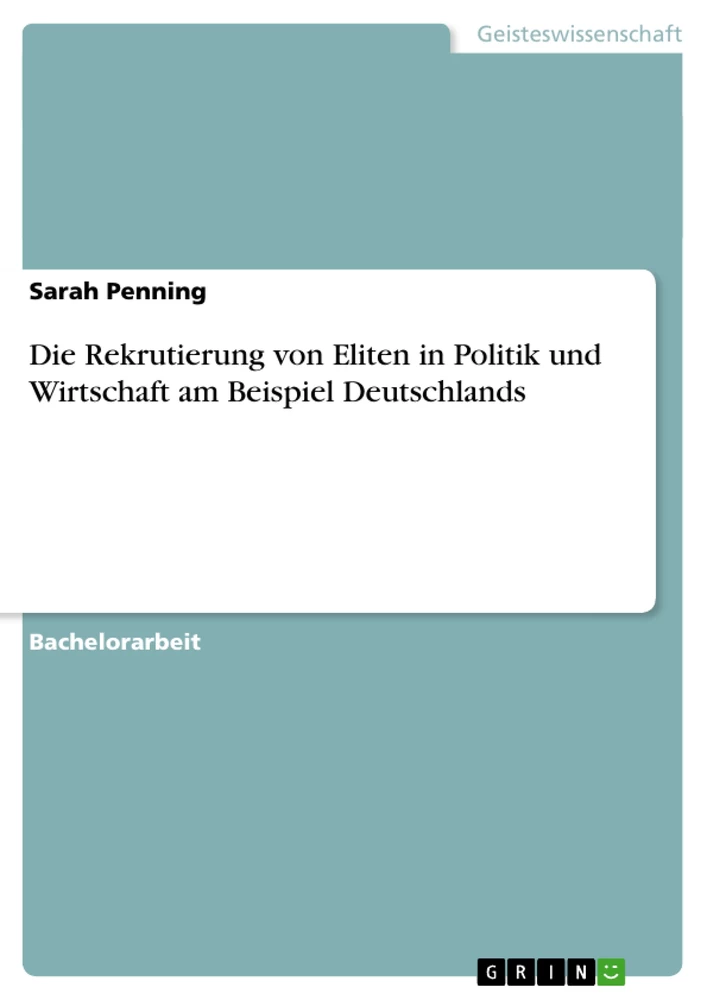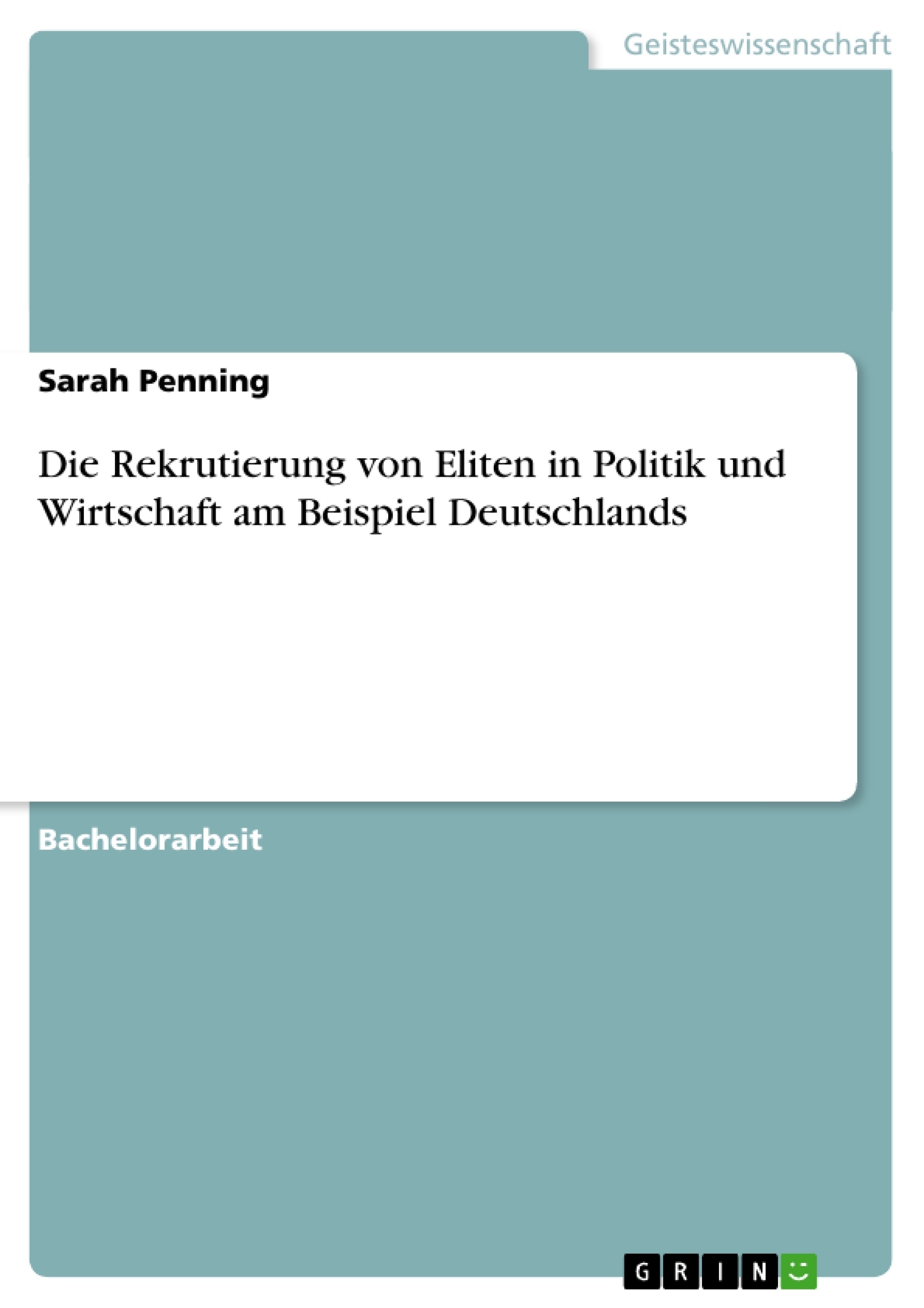Wie die Entwicklung des Elitebegriffs in der Wissenschaft verlaufen ist, soll im ersten Teil der vorliegenden Arbeit dargestellt werden. Es werden die klassischen Elitetheorien Paretos (1848 – 1923) und Moscas (1858 – 1941) vorgestellt, die nicht nur die ersten Elitetheorien überhaupt verfassten, sondern mit ihrer Gegenüberstellung von Elite und Masse, wenn auch unabsichtlich eine ideologische Grundlage für den Faschismus lieferten. Somit führen sie zu einem Wandel, insbesondere der deutschen Elitenforschung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Nachkriegstheoretiker bestimmen den Elitebegriff völlig neu. Die Elitezugehörigkeit soll nicht mehr durch die soziale Herkunft oder gar die Rasse bestimmt sein, sondern von individueller Leistung abhängig gemacht werden. Jedem Gesellschaftsmitglied soll es prinzipiell möglich sein, in Elitepositionen zu gelangen. In einem demokratischen System handelt es sich zudem um pluralistische, in Konkurrenz zueinander stehende Teileliten, so der neue Denkansatz. Das neue Eliteverständnis geht von leistungsabhängigen Positions- und Leistungseliten aus. Diese Theorie suggeriert die Möglichkeit durch Leistungsbereit-schaft, auch aus unteren Schichten aufsteigen zu können.
Demgegenüber etablierte sich ein kritischer Ansatz der Elitentheorie, dessen Vertreter, im Gegensatz zu den funktionalistischen Elitetheoretikern davon ausgehen, dass die soziale Herkunft nach wie vor einen direkten Einfluss auf die Karrierechancen und damit auf die Möglichkeit in Elitepositionen aufzusteigen hat. Die führende Klasse einer Gesellschaft sei auch in einem demokratischen System in einem hohen Maße kohärent und sozial geschlossen. Beide Ansätze sollen in dieser Arbeit verglichen werden.
Im zweiten großen Abschnitt folgt dann ein Blick in die Realität. Anhand empirischer Daten soll festgestellt werden, wie sich Eliten in Deutschland rekrutieren. Die Wahl fiel hier auf die Sektoren Politik und Wirtschaft, die neben der Wissenschaft, der Justiz, dem Militär und den Medien die wichtigsten Teileliten in Deutschland bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vorgehensweise und Struktur der Arbeit
- 2. Forschungsstand
- 2.1 Die Klassiker der Elitentheorie
- 2.1.1 Gaetano Mosca
- 2.1.2 Vilfredo Pareto
- 2.2 Der Bruch mit den Klassikern
- Elitentheorien nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.2.1 Ralf Dahrendorf – Konkurrierende Führungsgruppen statt einheitlicher Machtelite
- 2.2.2 Hans Peter Dreitzel – Leistungsqualifikation als entscheidender Rekrutierungsmechanismus
- 2.1 Die Klassiker der Elitentheorie
- 3. DIE AKTUELLE ELITENFORSCHUNG
- 3.1 Die kritische Elitenforschung
- 3.2 Pierre Bourdieu: Die Reproduktion der herrschenden Klasse
- 4. ZWISCHENFAZIT: DER KRITISCHE UND DER FUNKTIONALISTISCHE ANSATZ IM VERGLEICH
- 5. REKRUTIERUNGSMECHANISMEN VON ELITEN IN DEUTSCHLAND
- 5.1 Der Forschungsstand der modernen Elitenforschung
- 5.2 Analyse der Rekrutierung in der Wirtschaftselite
- 5.3 Analyse der Rekrutierung von Eliten im Sektor Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rekrutierung von Eliten in Deutschland, insbesondere in den Sektoren Politik und Wirtschaft. Sie untersucht die Frage, aus welchen Gesellschaftsklassen die Eliten rekrutiert werden und wie offen sie gegenüber Aufsteigern aus Nicht-Eliten sind. Dabei werden die Unterschiede in den Rekrutierungsmechanismen zwischen Politik und Wirtschaft analysiert. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die relevanten Theorien der Elitenforschung anhand empirischer Daten aus Deutschland zu überprüfen und so einen Beitrag zum Verständnis der Elitebildung in der Bundesrepublik zu leisten.
- Entwicklung der Elitenforschung: von den Klassikern bis zur modernen kritischen Elitenforschung
- Funktionalistischer vs. kritischer Ansatz in der Elitenforschung
- Analyse der Rekrutierungsmechanismen von Eliten in Politik und Wirtschaft in Deutschland
- Vergleich von theoretischen Modellen mit empirischen Befunden
- Die Rolle der sozialen Herkunft bei der Elitenrekrutierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Elitenförderung in der heutigen Gesellschaft dar und führt in die Problematik der Elitedefinition in einem demokratischen System ein. Kapitel 1 erläutert die Vorgehensweise und Struktur der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Forschungsstand der Elitenforschung, beginnend mit den klassischen Theorien von Mosca und Pareto. Anschließend werden die funktionalistischen Ansätze von Dahrendorf und Dreitzel nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt. Kapitel 3 widmet sich der kritischen Elitenforschung und stellt die Thesen von Pierre Bourdieu zur Reproduktion der herrschenden Klasse dar. Kapitel 4 bietet einen Vergleich des kritischen und des funktionalistischen Ansatzes. Kapitel 5 analysiert anhand empirischer Daten die Rekrutierung von Eliten in Politik und Wirtschaft in Deutschland.
Schlüsselwörter
Eliten, Elitenforschung, Rekrutierung, Deutschland, Politik, Wirtschaft, soziale Herkunft, Leistungsprinzip, klassischer Elitentheorie, funktionalistischer Ansatz, kritischer Ansatz, Pierre Bourdieu, Habitustheorie, Potsdamer Elitestudie, Michael Hartmann.
- Quote paper
- Sarah Penning (Author), 2009, Die Rekrutierung von Eliten in Politik und Wirtschaft am Beispiel Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144801