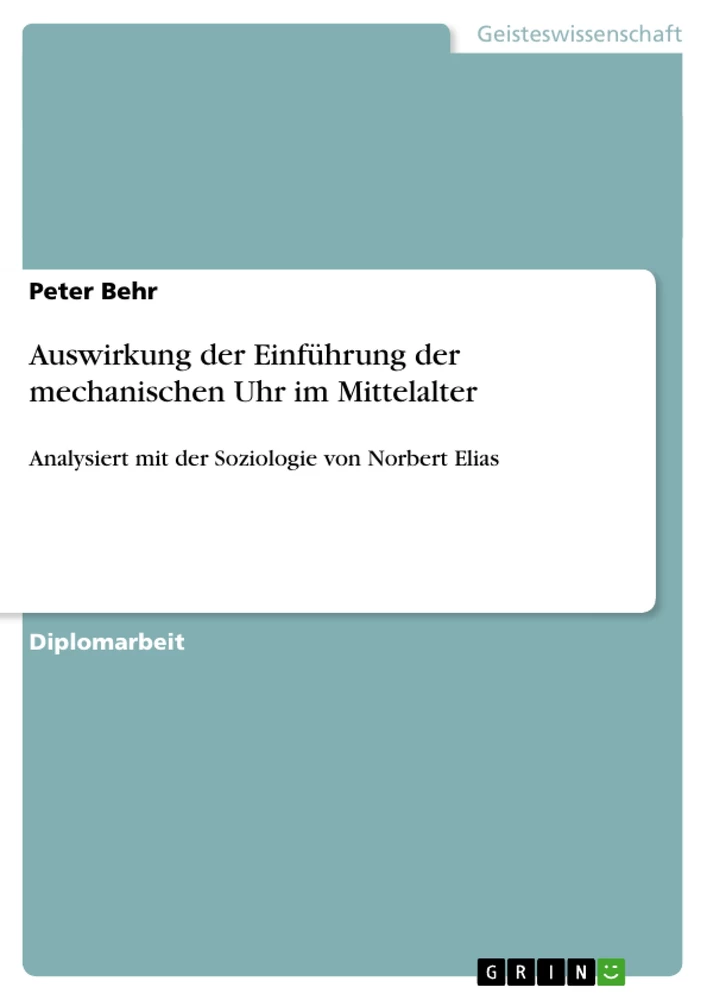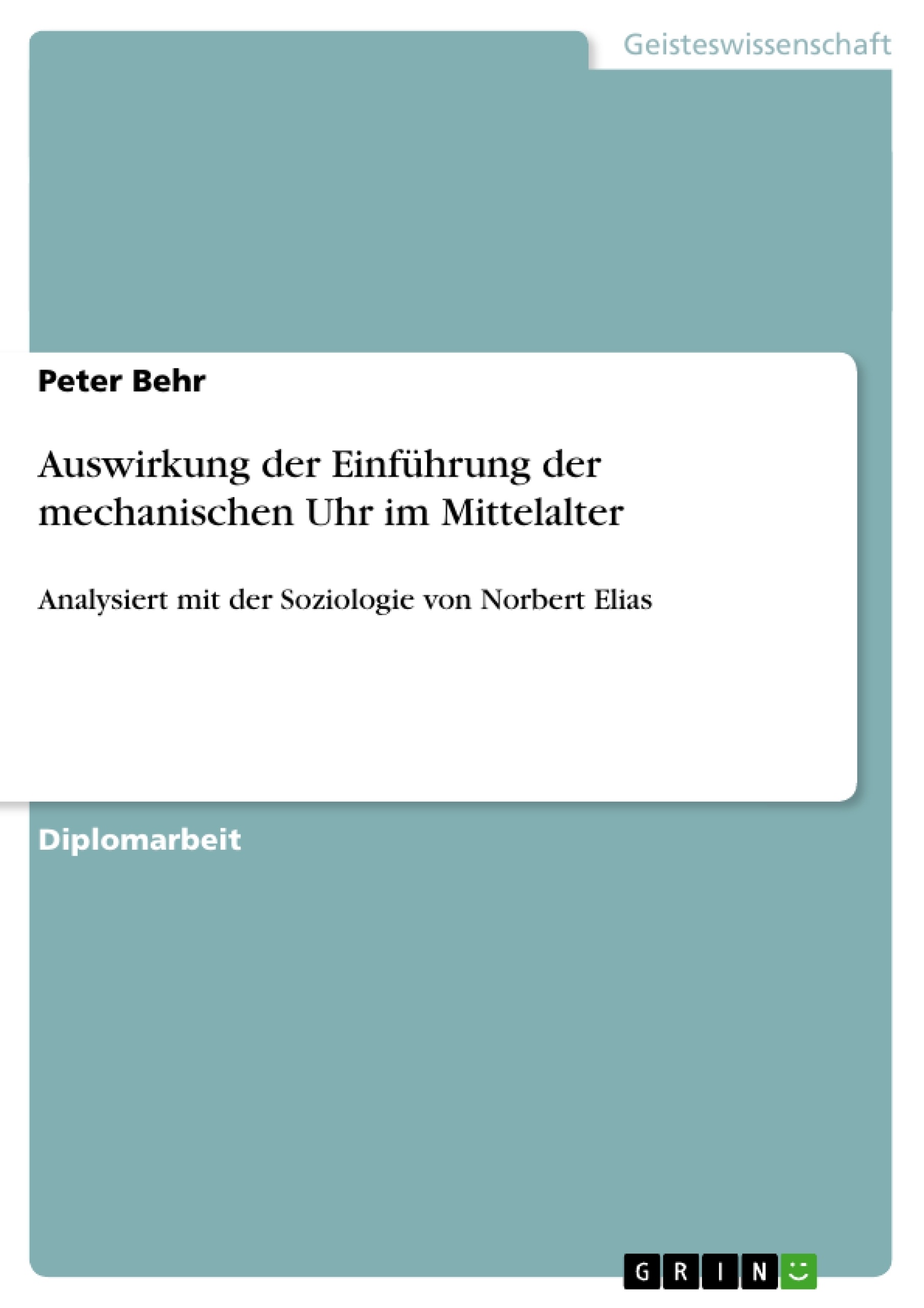Weil ich in der Nähe eines Glockenturms meine Kindheit verbrachte, war mir das stündliche Geläut bestens vertraut so vertraut, dass es im Alltag von mir überhört wurde. Die Uhr am Kirchturm schlägt, weil sie die Zeit angibt. Vor allem für Leute die nicht sehen können sei das wichtig erklärte mir jemand. Einleuchtend vorerst. Irgendwann später hörte ich auch, dass die Menschen früher noch keine eigene Uhr hatten und die Kirchenuhr, um die Zeit zu wissen, umso wichtiger war. Ohne hätte natürlich keiner irgendeinen Termin einhalten können. Jahre später stolperte die Erkenntnis über mich, dass an anderen Stellen, z.B. in anderen Ländern, gar keine Kirchtürme stehen. Und auch dort leben, lieben und tun die Menschen Dinge zu vereinbarten Zeitpunkten. Und eigentlich hört doch auch bei uns keiner mehr wirklich hin, wenn die Uhr schlägt. Wir haben unsere Uhr am Handgelenk. Als Student begann ich mich mehr dafür zu interessieren: Wann und wieso war es irgendwann zum ersten Mal der Fall, dass ein Jeder auf das Schlagen der Uhr gehört hat und sofort wusste, was dieses bedeutet? Wieso achteten die Menschen überhaupt auf so etwas wie den Glockenschlag war er denn mehr als ein abstraktes Symbol? Was bedingte unser heutiges Temporalsystem, die Art und Weise wie wir mit Zeit umgehen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zeit
- 3 Die mechanische Uhr und die mittelalterliche Stadt
- 3.1 Uhr, mechanische Uhr und Glocke
- 3.2 Die mittelalterliche Stadt
- 3.3 Wichtige Veränderungen innerhalb der Epoche
- 3.4 Die Temporalstruktur in der mittelalterlichen Stadt
- 3.5 Einführung der mechanischen Uhr
- 3.6 Einstellung verschiedener sozialer Gruppen zur mechanischen Uhr
- 3.7 Durch die mechanische Uhr bedingte Veränderungen des öffentlichen Lebens
- 3.8 Zusammenhang zwischen Religion und Einführung der mechanischen Uhr
- 3.9 Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und mechanischer Uhr
- 3.10 Gründe für die Einführung der mechanischen Uhr/ zusammenfassende Darstellung
- 4 Für diese Arbeit relevante Teile der Soziologie Norbert Elias'
- 4.1 Figurationen
- 4.2 Psychogenese und Soziogenese
- 4.3 Selbstzwang und Fremdzwang
- 4.4 Elias' Machtbegriff
- 4.5 ‚Über die Zeit im Kontext des ,Prozess der Zivilisation‘
- 5 Analyse des Einführungsprozesses
- 5.1 Historische Umstände reflektiert mit Elias' Soziologie - Schritt 1
- 5.2 Die vier Interdependenztypen im Kontext geschichtlicher Fakten – Schritt 2
- 5.3 Bedeutung von Stadt, Ökonomie und Bürgertum - Schritt 3
- 5.4 Die Figurative Macht im Einführungsprozess – Schritt 4
- 6 Fazit
- 7 Ausblick
- 8 Exkurs
- 9 Anhang
- 10 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Einführung der mechanischen Uhr im Mittelalter. Ziel ist es, diesen Prozess mithilfe der Soziologie Norbert Elias' zu analysieren und zu verstehen, wie sich die gesellschaftliche Zeitwahrnehmung und -organisation durch die neue Technologie veränderten. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion zwischen technologischem Fortschritt und gesellschaftlicher Entwicklung.
- Die soziale Konstruktion von Zeit im Mittelalter
- Der Einfluss der mechanischen Uhr auf die Organisation des öffentlichen Lebens
- Die Rolle von Religion und Wirtschaft bei der Verbreitung der mechanischen Uhr
- Die Anwendung der Figurationssoziologie von Norbert Elias auf den historischen Prozess
- Die Veränderung der Machtstrukturen durch die Einführung der mechanischen Uhr
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen der Einführung der mechanischen Uhr im Mittelalter. Sie beleuchtet den Unterschied zwischen der individuellen und kollektiven Zeitwahrnehmung und betont die Bedeutung der sozialen Determiniertheit von Zeitrepräsentationen. Die Arbeit argumentiert, dass sich mit einer veränderten Gesellschaft auch die Zeitordnung wandelt, wobei die Uhr als technisches Mittel zur Synchronisierung mit dieser Ordnung dient. Die Unzulänglichkeit von Sonnenuhren für eine komplexe, westliche Gesellschaft wird als Beispiel angeführt, um die Notwendigkeit einer präziseren Zeitmessung hervorzuheben.
3 Die mechanische Uhr und die mittelalterliche Stadt: Dieses Kapitel untersucht den Kontext der Einführung der mechanischen Uhr im mittelalterlichen städtischen Umfeld. Es analysiert die verschiedenen Aspekte der mittelalterlichen Stadtstruktur, wichtige Veränderungen innerhalb dieser Epoche und deren Auswirkungen auf die Temporalstruktur. Besonders wird der Einfluss der mechanischen Uhr auf die verschiedenen sozialen Gruppen beleuchtet, sowie die Verbindungen zu religiösen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Zusammenfassung der Gründe für die Einführung der mechanischen Uhr bildet den Abschluss dieses Kapitels.
4 Für diese Arbeit relevante Teile der Soziologie Norbert Elias': Dieses Kapitel stellt die für die Analyse relevanten Konzepte der Soziologie Norbert Elias' vor, insbesondere die Konzepte der Figurationen, Psychogenese und Soziogenese, Selbstzwang und Fremdzwang, Elias' Machtbegriff und seine Ausführungen zur Zeit im Kontext des „Prozesses der Zivilisation“. Diese theoretischen Grundlagen bilden das analytische Werkzeug für die Untersuchung des Einführungsprozesses der mechanischen Uhr.
5 Analyse des Einführungsprozesses: In diesem Kapitel wird der historische Einführungsprozess der mechanischen Uhr anhand der in Kapitel 4 dargestellten Konzepte der Soziologie Norbert Elias analysiert. Durch einen schrittweisen Ansatz werden die historischen Umstände im Lichte von Elias' Theorien beleuchtet. Die Interdependenz verschiedener Akteure und die Rolle von Stadt, Ökonomie und Bürgertum werden untersucht. Schließlich wird die figurative Macht im Einführungsprozess der mechanischen Uhr analysiert.
Schlüsselwörter
Mechanische Uhr, Mittelalter, Soziologie Norbert Elias, Figurationen, Zeitmessung, Stadtentwicklung, soziale Ordnung, Machtstrukturen, Wirtschaft, Religion, kollektive Zeitwahrnehmung, Prozess der Zivilisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Die Einführung der mechanischen Uhr im Mittelalter und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen
Was ist das Thema dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Einführung der mechanischen Uhr im Mittelalter und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Zeitwahrnehmung und -organisation. Sie analysiert diesen Prozess mithilfe der Soziologie Norbert Elias' und beleuchtet die Interaktion zwischen technologischem Fortschritt und gesellschaftlicher Entwicklung.
Welche zentralen Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Fragen der sozialen Konstruktion von Zeit im Mittelalter, dem Einfluss der mechanischen Uhr auf das öffentliche Leben, der Rolle von Religion und Wirtschaft bei ihrer Verbreitung, der Anwendung der Figurationssoziologie von Norbert Elias und der Veränderung von Machtstrukturen durch die neue Technologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zeit, Die mechanische Uhr und die mittelalterliche Stadt (mit Unterkapiteln zur Uhr selbst, der mittelalterlichen Stadt, wichtigen Veränderungen der Epoche, der Temporalstruktur, der Einführung der mechanischen Uhr, den Einstellungen verschiedener sozialer Gruppen, den Veränderungen des öffentlichen Lebens, dem Zusammenhang mit Religion und Wirtschaft und einer zusammenfassenden Darstellung der Gründe für die Einführung), Relevante Teile der Soziologie Norbert Elias' (Figurationen, Psychogenese und Soziogenese, Selbstzwang und Fremdzwang, Elias' Machtbegriff, Zeit im Kontext des „Prozesses der Zivilisation“), Analyse des Einführungsprozesses (mit schrittweiser Analyse historischer Umstände, Interdependenztypen, Bedeutung von Stadt, Ökonomie und Bürgertum und der figurativen Macht), Fazit, Ausblick, Exkurs, Anhang und Literaturverzeichnis.
Welche soziologischen Konzepte von Norbert Elias werden verwendet?
Die Arbeit nutzt zentrale Konzepte der Soziologie Norbert Elias', darunter Figurationen, Psychogenese und Soziogenese, Selbstzwang und Fremdzwang, Elias' Machtbegriff und seine Ausführungen zur Zeit im Kontext seines „Prozesses der Zivilisation“, um den Einführungsprozess der mechanischen Uhr zu analysieren.
Wie wird der Einführungsprozess der mechanischen Uhr analysiert?
Der Einführungsprozess wird schrittweise analysiert, indem historische Umstände im Lichte von Elias' Theorien beleuchtet werden. Die Interdependenz verschiedener Akteure und die Rolle von Stadt, Ökonomie und Bürgertum werden untersucht, ebenso wie die figurative Macht im Einführungsprozess.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Mechanische Uhr, Mittelalter, Soziologie Norbert Elias, Figurationen, Zeitmessung, Stadtentwicklung, soziale Ordnung, Machtstrukturen, Wirtschaft, Religion, kollektive Zeitwahrnehmung, Prozess der Zivilisation.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen der Einführung der mechanischen Uhr im Mittelalter zu untersuchen und zu verstehen, wie sich die gesellschaftliche Zeitwahrnehmung und -organisation durch diese neue Technologie veränderten.
Welche Rolle spielen Religion und Wirtschaft in der Analyse?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Einführung der mechanischen Uhr und religiösen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen im Mittelalter. Es wird analysiert, wie diese Faktoren die Verbreitung der neuen Technologie beeinflusst haben.
Wie wird die Zeitwahrnehmung im Mittelalter dargestellt?
Die Arbeit differenziert zwischen individueller und kollektiver Zeitwahrnehmung und betont die soziale Determiniertheit von Zeitrepräsentationen. Sie argumentiert, dass sich mit einer veränderten Gesellschaft auch die Zeitordnung wandelt, wobei die Uhr als technisches Mittel zur Synchronisierung dient.
- Quote paper
- Peter Behr (Author), 2009, Auswirkung der Einführung der mechanischen Uhr im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144766