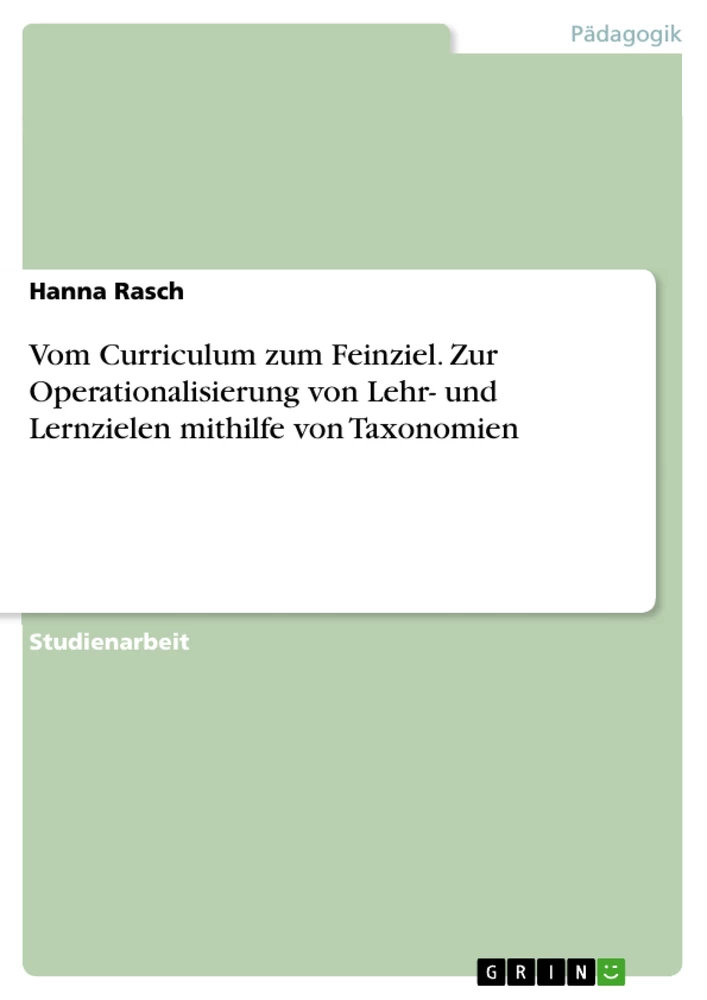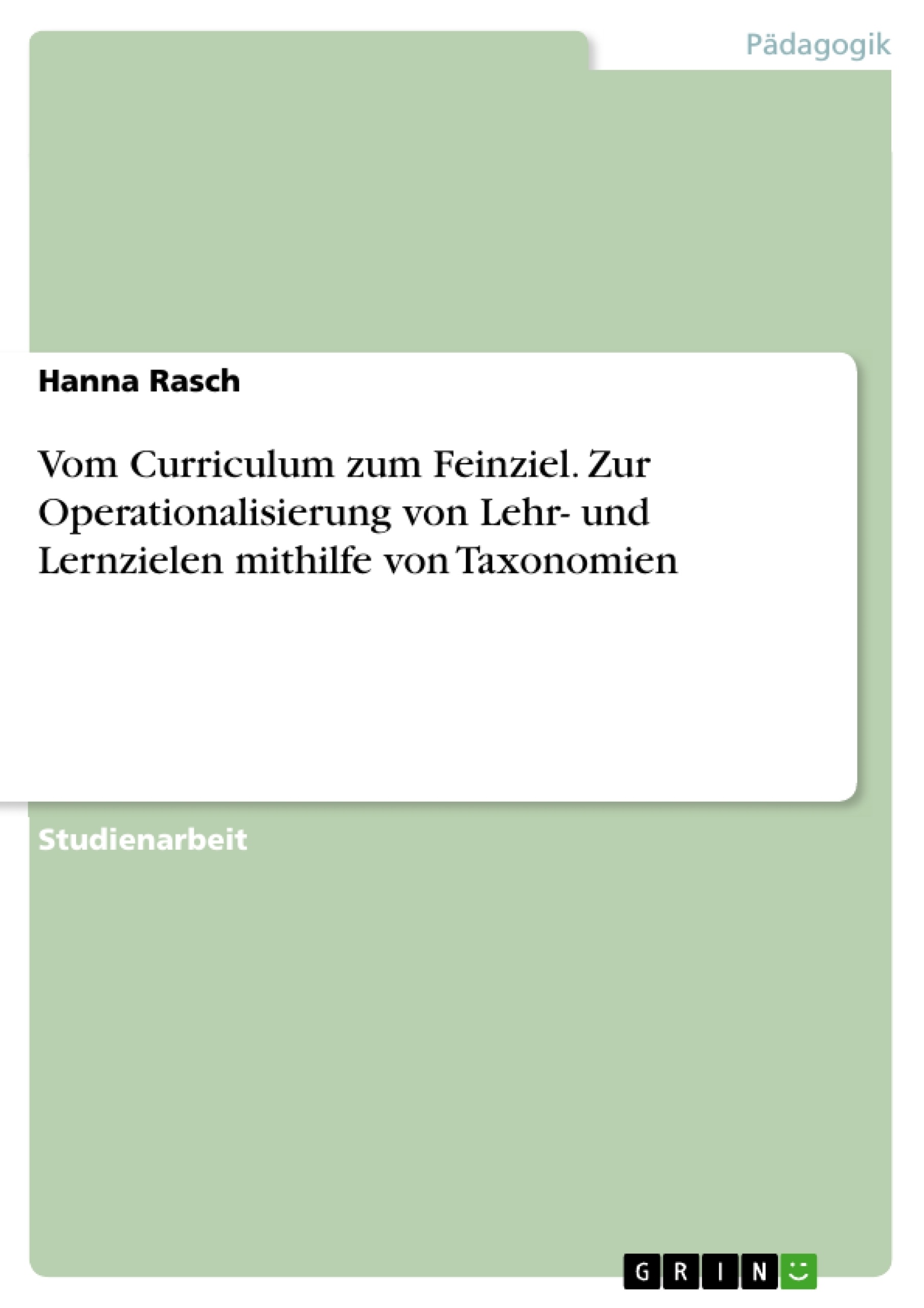Bei der sinnvollen Planung von Unterrichtseinheiten ist es von immenser Wichtigkeit, die Lehr- und Lernziele festzulegen, am besten in schriftlicher Form. Dabei wird vom Curriculum des jeweiligen Faches ausgegangen und so eine immer stärkere Spezifizierung der Ziele, von den sehr allgemein gehaltenen und wenig abgegrenzten Richtzielen über die schon etwas genauer definierten Grobziele bis hin zu den sehr genau bestimmten Feinzielen, vorgenommen. Dieser Prozess wird als Operationalisierung der Lernziele bezeichnet. Hierbei ist es
sinnvoll, als Orientierungshilfe die Lehrzieltaxonomien im kognitiven sowie im affektiven Bereich zu Rate zu ziehen. Es stellt sich hier nun die Frage, wie genau der Operationalisierungsprozess eigentlich abläuft, und ebenso, welche Relevanz er für die Unterrichtsgestaltung besitzt. Diese Frage wird in der vorliegenden Arbeit zunächst geklärt werden, um dann die Taxonomisierung von Lehrzielen im kognitiven Bereich nach Benjamin S. Bloom und Mitarbeitern sowie im affektiven Bereich nach David R. Krathwohl und Mitarbeitern genauer zu erläutern. Anschließend wird der Weg vom Lehrziel zum Feinziel anhand einiger Beispiele aus dem Lehrplan für das Unterrichtsfach
Deutsch in der Sekundarstufe II an Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen verdeutlicht. So kann schließlich die Frage nach der Funktion der Taxonomie von Lehrzielen im Operationalisierungsprozess geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. PROBLEMSTELLUNG
- 2. DIE OPERATIONALISIERUNG VON LEHR- UND LERNZIELEN UND DEREN RELEVANT FÜR DIE UNTERRICHTSGESTALTUNG
- 3. DIE TAXONOMISIERUNG
- 3.1. Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich nach Bloom
- 3.2. Taxonomie von Lernzielen im affektiven Bereich nach Krathwohl
- 4. DER WEG VOM LEHRZIEL ZUM FEINZIEL ANHAND VON BEISPIELEN AUS DEM LEHRPLAN FÜR DEUTSCH AN GYMNASIEN UND GESAMTSCHULEN
- 5. FAZIT: FUNKTIONEN VON LEHRZIELTAXONOMIEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess der Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen und dessen Bedeutung für die Unterrichtsgestaltung. Sie beleuchtet die Anwendung von Taxonomien, insbesondere die kognitiven (Bloom) und affektiven (Krathwohl) Modelle, um Lernziele präzise zu formulieren und vom Curriculum bis hin zu konkreten Feinzielen zu spezifizieren. Die Arbeit analysiert anhand von Beispielen aus dem Lehrplan Deutsch die praktische Umsetzung dieses Prozesses.
- Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen
- Relevanz der Operationalisierung für die Unterrichtsgestaltung
- Anwendung von Bloom's Taxonomie im kognitiven Bereich
- Anwendung von Krathwohl's Taxonomie im affektiven Bereich
- Der Weg vom Lehrziel zum Feinziel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Einführung des Problems der präzisen Formulierung von Lehr- und Lernzielen im Unterricht. Sie betont die Notwendigkeit, von allgemeinen Curricula zu konkreten Feinzielen zu gelangen, um den Unterricht effektiv zu planen und zu gestalten. Die Operationalisierung von Lernzielen und die Rolle von Taxonomien als Hilfsmittel werden als zentrale Fragestellungen hervorgehoben.
2. Die Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen und deren Relevanz für die Unterrichtsgestaltung: Dieses Kapitel erläutert den Prozess der Operationalisierung, der von allgemeinen Richtzielen über Grobziele zu Feinzielen führt. Es wird detailliert beschrieben, wie Feinzielen das gewünschte Schülerverhalten, die Bedingungen und Beurteilungskriterien präzise definieren. Die Bedeutung der klaren Formulierung von Feinzielen für die Motivation und den Lernerfolg der Schüler wird hervorgehoben, ebenso die Bedeutung für die Auswahl geeigneter Lernmethoden und die Erstellung von Prüfungsaufgaben. Die Arbeit von Mager zur dreikomponentigen Feinzielbeschreibung (Endverhaltensbeschreibung, genaue Bestimmung des Endverhaltens, und Bestimmung des Beurteilungsmaßstabes) wird als wichtiger Bezugspunkt genannt.
3. Die Taxonomisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Klassifizierung von Lernzielen mithilfe von Taxonomien. Es wird zunächst die kognitive Taxonomie nach Bloom vorgestellt, die Lernziele in sechs Hauptklassen (Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten, Erschaffen) unterteilt, welche jeweils in Unterklassen gegliedert sind. Die hierarchische Struktur und der Aufbau der Klassen werden erläutert, wobei der Fokus auf dem "Wissen"-Bereich liegt, der in Unterkategorien wie "Wissen von konkreten Einzelheiten", "Wissen von Wegen und Mitteln" und weiteren differenziert wird. Die Bedeutung der verschiedenen Abstraktionsniveaus wird betont.
Schlüsselwörter
Operationalisierung, Lehrziele, Lernziele, Taxonomie, Bloom, Krathwohl, Feinziele, Unterrichtsgestaltung, Curriculum, kognitiver Bereich, affektiver Bereich, Lernplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen und ihrer Bedeutung für die Unterrichtsgestaltung. Sie analysiert den Prozess der präzisen Formulierung von Lernzielen, ausgehend von allgemeinen Curricula bis hin zu konkreten Feinzielen, und untersucht die Anwendung von Taxonomien wie den Modellen von Bloom (kognitiv) und Krathwohl (affektiv).
Welche Taxonomien werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung der kognitiven Taxonomie nach Bloom und der affektiven Taxonomie nach Krathwohl. Bloom's Taxonomie gliedert Lernziele in sechs Hauptklassen (Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten, Erschaffen), während Krathwohl's Taxonomie den affektiven Bereich der Lernziele betrachtet. Die Arbeit erklärt detailliert die hierarchische Struktur und die einzelnen Ebenen dieser Taxonomien.
Wie wird die Operationalisierung von Lehrzielen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den Prozess der Operationalisierung als Weg von allgemeinen Richtzielen über Grobziele zu Feinzielen. Sie erklärt, wie Feinzielen das gewünschte Schülerverhalten, die Bedingungen und Beurteilungskriterien präzise definieren. Die dreikomponentige Feinzielbeschreibung nach Mager (Endverhaltensbeschreibung, genaue Bestimmung des Endverhaltens, und Bestimmung des Beurteilungsmaßstabes) wird als wichtiger Bezugspunkt genannt.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit illustriert den Prozess der Operationalisierung anhand von Beispielen aus dem Lehrplan für Deutsch an Gymnasien und Gesamtschulen. Dies veranschaulicht die praktische Umsetzung der theoretischen Konzepte.
Welche Bedeutung hat die Operationalisierung für den Unterricht?
Die klare Formulierung von Feinzielen ist entscheidend für die Motivation und den Lernerfolg der Schüler. Sie ermöglicht die Auswahl geeigneter Lernmethoden und die Erstellung von zielgerichteten Prüfungsaufgaben. Die Operationalisierung trägt somit zu einer effektiven Unterrichtsplanung und -gestaltung bei.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit fasst die Funktionen von Lehrzieltaxonomien zusammen. Sie unterstreicht deren Bedeutung als Hilfsmittel zur präzisen Formulierung von Lernzielen und deren Beitrag zu einer effektiven und zielorientierten Unterrichtsgestaltung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Problemstellung, Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen und deren Relevanz für die Unterrichtsgestaltung, Die Taxonomisierung (inklusive Bloom und Krathwohl), Der Weg vom Lehrziel zum Feinziel anhand von Beispielen aus dem Lehrplan für Deutsch, und Fazit: Funktionen von Lehrzieltaxonomien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Operationalisierung, Lehrziele, Lernziele, Taxonomie, Bloom, Krathwohl, Feinziele, Unterrichtsgestaltung, Curriculum, kognitiver Bereich, affektiver Bereich, Lernplanung.
- Quote paper
- Hanna Rasch (Author), 2009, Vom Curriculum zum Feinziel. Zur Operationalisierung von Lehr- und Lernzielen mithilfe von Taxonomien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144713