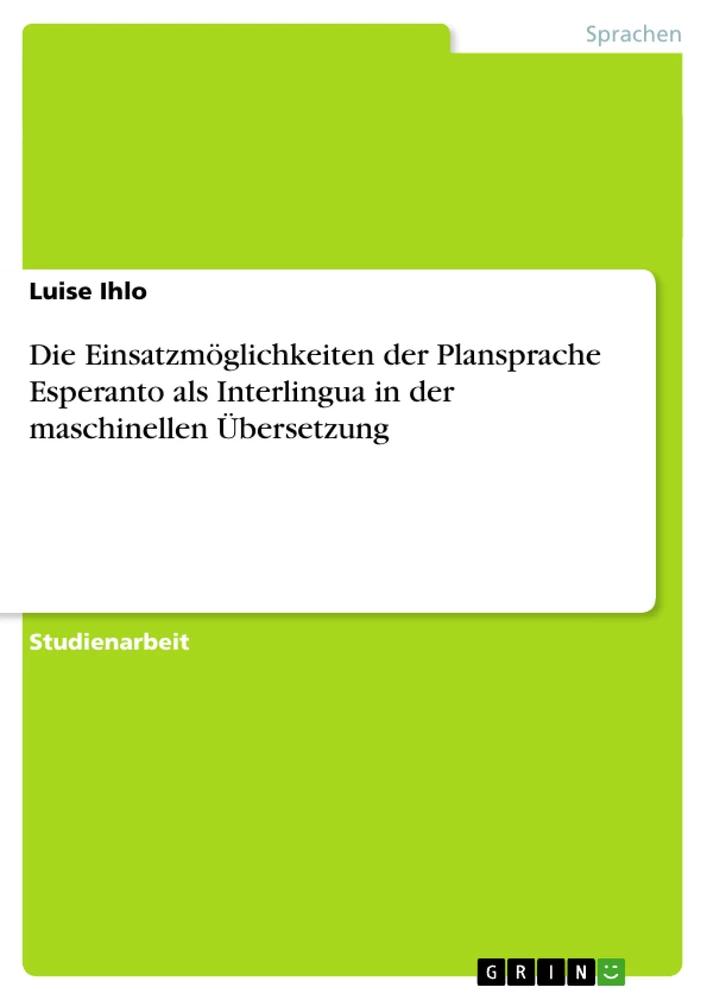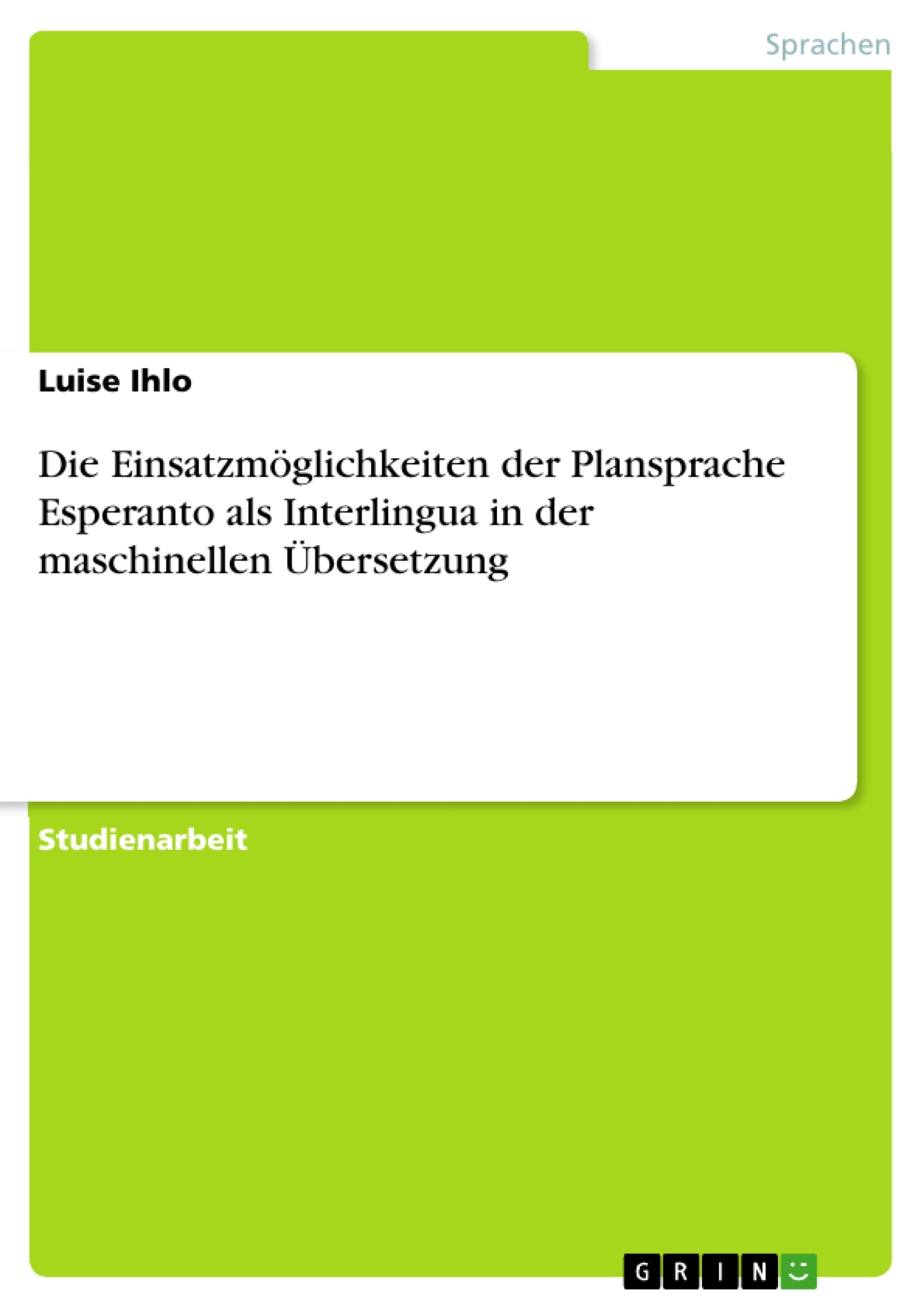In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob sich bei der Interlingua-Methode, einer speziellen indirekten Form der Übersetzung der maschinellen Übersetzung, die Plansprache Esperanto als Zwischensprache einsetzen lässt. Die einzige in einer Sprachgemeinschaft funktionierende Plansprache, Esperanto, weist viele Eigenschaften auf, die sie als neutrale Zwischensprache geeignet macht. Sie vereint die Eigenschaften einer natürlichen Sprache, wie Autonomie, Ausdrucksstärke und Flexibilität und weist auch die Vorteile eines künstlich geschaffenen Sprachsystems auf: Morphologie und Syntax des Esperanto sind sehr klar und einfach, es weist eine hohe Regelmäßigkeit in der Grammatik und Wortbildung auf und lässt sich gut zerlegen und analysieren. Die Betrachtung dazu erfolgt im letzten Kapitel dieser Arbeit.
Kapitel Eins gibt eine Übersicht über die Geschichte und die gängigen Methoden der Maschinellen Übersetzung (MÜ). In welchen Bereichen kann die MÜ eingesetzt werden und ist sie überhaupt in der Lage, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern?
Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Plansprachen geklärt, welcher den meisten Menschen eher unter Hilfssprachen, Universalsprachen oder künstliche Sprachen bekannt sind. Es wird der Frage nachgegangen, ob es eine Illusion ist, mit der Erschaffung einer künstlichen Sprache Brücken über Landes- und Sprachgrenzen hinaus schlagen zu wollen oder ob ein solches Vorhaben tatsächlich funktionieren kann. Diese Sprachen vereinen in sich die Eigenschaft, für jeden schnell und leicht erlernbar zu sein, aber trifft dies wirklich gleichermaßen auf alle Sprecher verschiedener Sprach- und Kommunikationsgemeinschaften zu?
Im dritten Kapitel wird speziell auf die Plansprache Esperanto eingegangen. Dabei wird erläutert, wieso sich Esperanto als einzige Plansprache gegenüber hunderten von anderen Plansprachenprojekten durchsetzen konnte und noch bis heute gesprochen wird. Es wird hervorgehoben, was Esperanto von anderen plansprachlichen Systemen unterscheidet, wobei sowohl sprachstrukturelle als auch außersprachliche Aspekte betrachtet werden.
Im letzten Kapitel wird ein Projekt vorgestellt, das gegen Ende der 80er Jahre als erstes und bisher einziges Modell Erfahrungen mit dem Einsatz von Esperanto als Interlingua in der MÜ sammelte. Dabei wird vor allem der Anspruch der Autonomie bei der Wahl einer Zwischensprache erläutert und geklärt, ob Esperanto in der Lage ist, diese Ansprüche ausreichend zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Maschinelle Übersetzung
- Motive
- Begriff
- Historischer Abriss
- SYSTRAN
- TITUS
- METEO
- METAL
- Die wichtigsten Ansätze
- Wort für Wort
- Satzteile
- Transfer
- Interlingua
- EBMT
- SBMT
- HAMT
- Fazit
- Plansprachen
- Motive
- Begriff
- Interlinguistik
- Eigenschaften
- Klassifikation der Plansprachen
- Traditionelle Klassifikation nach Moch/Couturat/Leau
- Klassifikation nach realer kommunikativer Rolle
- Esperanto
- Entstehung
- Esperantologie
- Gründe für den relativen Erfolg des Esperanto
- Sprachstrukturelle Gründe
- Außersprachliche Gründe
- Kritik
- Esperanto als Interlingua
- Das Projekt DLT
- Warum Esperanto als Interlingua?
- Autonomie der Zwischensprache
- Autonomie bei Esperanto
- Vorteile des Esperanto als Interlingua
- Nachteile und Ausbesserungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung der Plansprache Esperanto als Interlingua in der maschinellen Übersetzung. Es wird geprüft, ob Esperanto, als einzige in einer Sprachgemeinschaft funktionierende Plansprache, aufgrund seiner Eigenschaften als neutrale Zwischensprache dienen kann. Die Arbeit beleuchtet die Vorteile und Nachteile dieser Anwendung und betrachtet dabei sowohl sprachstrukturelle als auch außer-sprachliche Aspekte.
- Maschinelle Übersetzung: Methoden und historische Entwicklung
- Plansprachen: Definition, Eigenschaften und Klassifizierung
- Esperanto: Entstehung, Erfolg und Kritik
- Esperanto als Interlingua: Vorteile und Herausforderungen
- Das Projekt DLT als Fallbeispiel für den Einsatz von Esperanto in der maschinellen Übersetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeit der Plansprache Esperanto als Interlingua in der maschinellen Übersetzung. Esperanto vereint Eigenschaften natürlicher Sprachen (Autonomie, Ausdrucksstärke, Flexibilität) mit den Vorteilen eines künstlichen Systems (klare Morphologie und Syntax, hohe Regelmäßigkeit). Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel, die sich mit maschineller Übersetzung, Plansprachen, Esperanto und schließlich dem Einsatz von Esperanto als Interlingua auseinandersetzen.
1 Maschinelle Übersetzung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Geschichte und gängigen Methoden der maschinellen Übersetzung (MÜ). Es werden die Motive für den Einsatz von MÜ, wie z.B. die zunehmende Internationalisierung von Unternehmen und kürzere Produktlebenszyklen, erläutert. Der Begriff der MÜ wird definiert und verschiedene Ansätze, wie Wort-für-Wort-Übersetzung, Satzteil-Übersetzung, Transfer und Interlingua-Ansätze, werden vorgestellt. Die Kapitel beleuchtet außerdem die Grenzen der MÜ und die Notwendigkeit von Terminologiemanagement.
2 Plansprachen: Dieses Kapitel klärt den Begriff der Plansprachen und untersucht die Frage nach ihrer Sinnhaftigkeit. Es wird diskutiert, ob die Schaffung einer künstlichen Sprache tatsächlich Brücken über Sprachgrenzen schlagen kann. Die Kapitel beleuchtet die Eigenschaften von Plansprachen und deren Klassifizierung, unter Berücksichtigung traditioneller und rollenbasierter Klassifikationen.
3 Esperanto: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Plansprache Esperanto. Es wird erläutert, warum sich Esperanto gegenüber anderen Plansprachen durchsetzen konnte und bis heute eine aktive Sprachgemeinschaft unterhält. Sowohl sprachstrukturelle als auch außer-sprachliche Gründe für den Erfolg werden analysiert, und kritische Aspekte werden ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Maschinelle Übersetzung, Interlingua, Plansprachen, Esperanto, DLT-Projekt, Sprachtechnologie, künstliche Sprache, Übersetzungstechnologie, kommunikative Rolle, Sprachstrukturelle Eigenschaften.
FAQ: Untersuchung der Eignung von Esperanto als Interlingua in der Maschinellen Übersetzung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung der Plansprache Esperanto als Interlingua in der maschinellen Übersetzung. Es wird geprüft, ob Esperanto aufgrund seiner Eigenschaften als neutrale Zwischensprache dienen kann.
Welche Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Vorteile und Nachteile des Einsatzes von Esperanto als Interlingua, wobei sowohl sprachstrukturelle als auch außer-sprachliche Aspekte betrachtet werden. Sie umfasst die Geschichte und Methoden der maschinellen Übersetzung, die Definition und Eigenschaften von Plansprachen, die Entstehung und den Erfolg von Esperanto, sowie dessen Kritikpunkte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Maschineller Übersetzung (Methoden, historische Entwicklung), Plansprachen (Definition, Eigenschaften, Klassifizierung), Esperanto (Entstehung, Erfolg, Kritik) und Esperanto als Interlingua (Vorteile, Herausforderungen, Das DLT-Projekt als Fallbeispiel).
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die Arbeit konzentriert sich auf die maschinelle Übersetzung, Plansprachen, insbesondere Esperanto, und deren Eignung als Interlingua. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den sprachstrukturellen und außer-sprachlichen Aspekten, die den Erfolg oder Misserfolg von Esperanto als Interlingua beeinflussen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Eignung von Esperanto als Interlingua in der maschinellen Übersetzung zu analysieren und die Vor- und Nachteile dieser Anwendung zu bewerten. Dabei wird auch das Projekt DLT als konkretes Beispiel herangezogen.
Welche Methoden der maschinellen Übersetzung werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ansätze der maschinellen Übersetzung, darunter Wort-für-Wort-Übersetzung, Satzteil-Übersetzung, Transfer und Interlingua-Ansätze. Die historischen Entwicklungen und die Grenzen der maschinellen Übersetzung werden ebenfalls diskutiert.
Wie werden Plansprachen klassifiziert?
Die Arbeit beschreibt traditionelle Klassifikationen von Plansprachen nach Moch/Couturat/Leau und eine Klassifizierung nach der realen kommunikativen Rolle der Sprachen.
Warum wird Esperanto als Fallbeispiel ausgewählt?
Esperanto wird als Fallbeispiel ausgewählt, weil es die einzige Plansprache ist, die in einer Sprachgemeinschaft tatsächlich funktioniert. Die Arbeit analysiert die Gründe für den relativen Erfolg von Esperanto, sowohl sprachstrukturelle als auch außer-sprachliche Faktoren.
Welche Kritikpunkte an Esperanto werden angesprochen?
Die Arbeit berücksichtigt kritische Aspekte von Esperanto, ohne diese im Detail zu diskutieren. Die Kritikpunkte werden im Kontext der Eignung als Interlingua betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Maschinelle Übersetzung, Interlingua, Plansprachen, Esperanto, DLT-Projekt, Sprachtechnologie, künstliche Sprache, Übersetzungstechnologie, kommunikative Rolle, sprachstrukturelle Eigenschaften.
- Quote paper
- Luise Ihlo (Author), 2009, Die Einsatzmöglichkeiten der Plansprache Esperanto als Interlingua in der maschinellen Übersetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144666