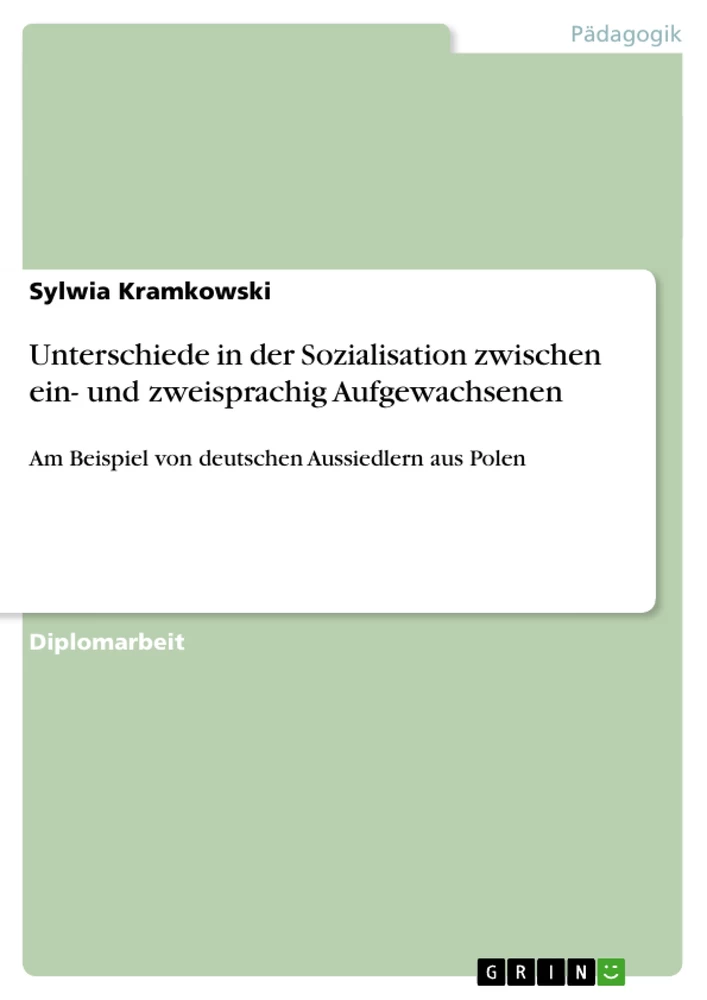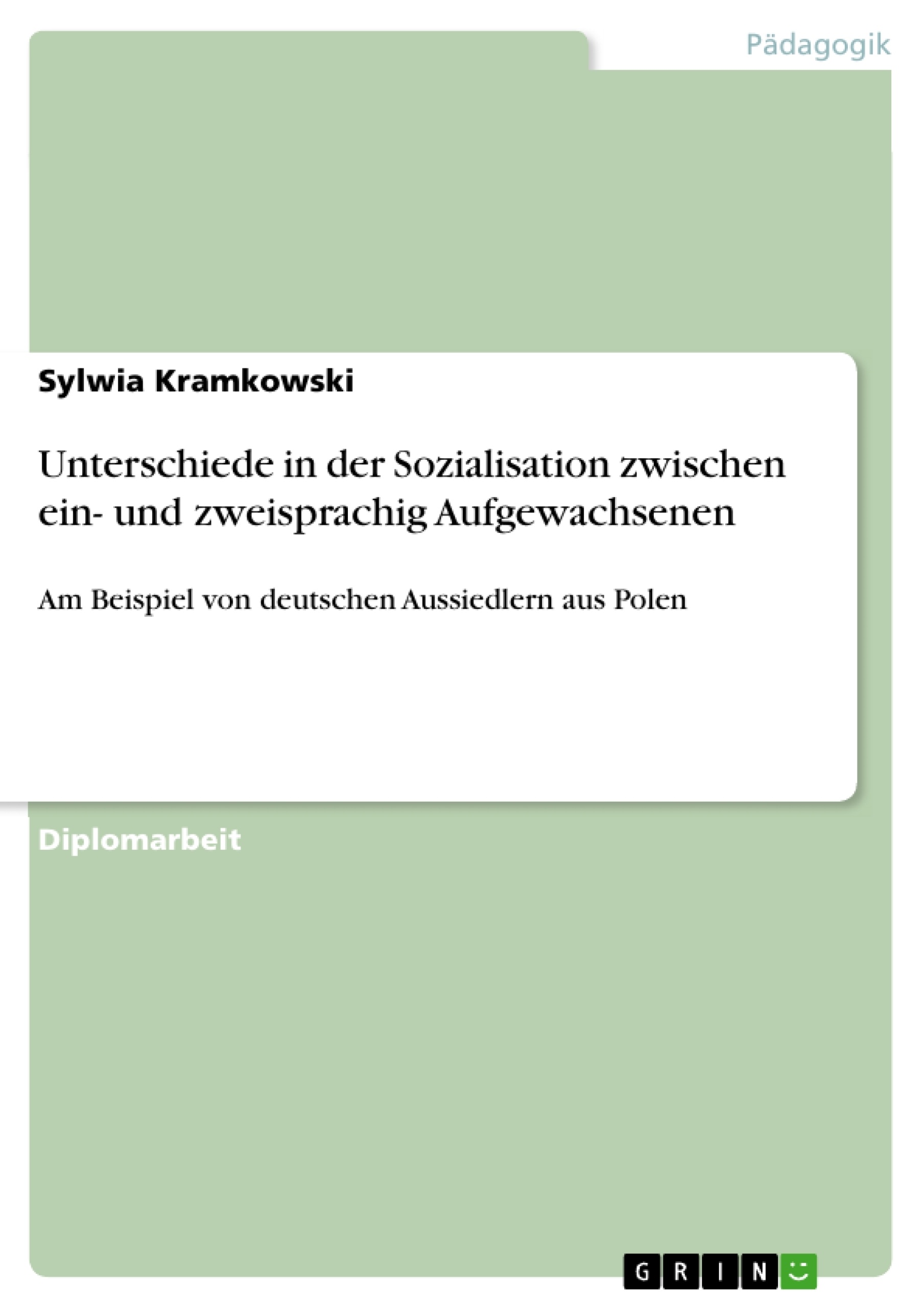Mit der Globalisierung gewinnt das Thema des Zusammenlebens von verschiedenen Kulturen an immer größerer Aktualität. Menschen verlassen, bedingt durch Aussiedlungen, Familienzusammenführungen, politisch oder wirtschaftlich motivierte Flucht ihr Heimatland, um sich ein neues Leben in einem anderen Land aufzubauen.
Deutschland ist mittlerweile eines der wichtigsten Einwanderungsländer der Welt.Hier leben aktuell rund 82 Millionen Einwohner, darunter etwa 15,4 Millionen mit
Migrationshintergrund - Tendenz steigend. Dabei liegt der Fokus in der Öffentlichkeit, insbesondere auf türkischen Einwanderern, die den größten Einwanderungsteil in Deutschland ausmachen. Die zweitgrößte Gruppe bilden (Spät-)Aussiedler, die oftmals
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Generell wird in Bezug auf Migrantengruppen häufig der Aspekt des Sprachumgangs diskutiert.
Auch in der vorliegenden Diplomarbeit wird der Sprachumgang untersucht, wobei in diesem Zusammenhang die zentrale Fragestellung dieser Arbeit entstand und zwar ob es
Unterschiede in der Sozialisation zwischen ein- und zweisprachig
Aufgewachsenendeutschen (Spät-)Aussiedlern aus Polen gibt.
Dazu wurden folgende Fragen thematisiert: Gibt es signifikante Unterschiede innerhalb der drei Sozialisationsphasen? Dazu wurde untersucht, welche Sprachen innerhalb der Familie verwendet wurden und wie die schulischen als auch beruflichen Werdegänge
bei den Probanden aussahen. Weiterhin wurden sowohl die Freundeskreise als auch die Partnerwahl auf ihre Zusammensetzung der Nationalitäten hin geprüft. Zuletzt stellte sich die Frage nach dem Identitätsgefühl. Fühlen sich zweisprachig Aufgewachsene
aufgrund ihrer Sozialisation eher polnisch und haben einen stärkeren Bezug zu ihrem ursprünglichen Heimatland Polen?[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I
- Sozialisation
- Sozialisation/Enkulturation
- Die drei Sozialisationsphasen
- Die Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz
- Kultur
- Akkulturation
- Der Zusammenhang von Kultur und Erziehung
- Persönlichkeit
- Identität
- Soziale Identität und die Identifikation mit der Gruppe
- Personale Identität
- Aufbau kultureller Identität
- Sprache
- Sprachtheorien
- Spracherwerb
- Muttersprache
- Theorien zum Erstspracherwerb
- Zweisprachigkeit
- Sprache und kultureller Einfluss
- Sprache und Identität
- Bildung und Sprache
- Bildungserfolg im Kontext von Sprache
- Mehrsprachigkeit und Schule
- Bedeutung der Schriftsprache für die Sprachentwicklung
- Teil II
- Empirische Untersuchung zu Unterschieden in der Sozialisation von ein- und zweisprachig Aufgewachsenen - am Beispiel von deutschen Aussiedlern aus Polen
- Gegenstand, Zielsetzung und Fragestellungen der Untersuchung
- Gegenstand der Untersuchung: Gruppenauswahl der deutschen Aussiedler aus Polen
- Auswahl der Interviewpartner und Kontaktaufnahme
- Zielsetzung der Untersuchung
- Zentrale Fragestellung des Forschungsgegenstandes
- Leitende Annahmen von Faktoren, die Unterschiede in der Sozialisation beeinflussen können
- Methodische Anlage der Untersuchung
- Orientierung an der qualitativen Sozialforschung
- Das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung
- Beschreibung des methodischen Verlaufs des narrativen Interviews
- Die Methode des narrativen Interviews
- Ablauf des narrativen Interviews
- Zum Transkriptionsverfahren
- Die Stichprobe der Erhebung
- Das methodische Vorgehen bei der Auswertung der Daten
- Auswertung der Datenmaterialien
- Ergebnisse der Erhebung
- Allgemeine Anmerkungen zu den Interviews nach deren erster Durchsicht
- 1. Schritt der 3. Ebene: Typenbildung jedes Einzelfalles
- Zweiter und dritter Schritt der 3. Ebene: Vergleich der Einzelfälle und Abstraktion der daraus entstandenen Typologien
- Einfluss von Sprache und Kultur auf die Sozialisation
- Identitätsentwicklung und -bildung in einem multikulturellen Kontext
- Unterschiede in der Sozialisation zwischen einsprachigen und zweisprachigen Aussiedlern
- Sozialisationsfaktoren wie Familie, Schule und Peergroup
- Die Bedeutung der Muttersprache für die Integration in die deutsche Gesellschaft
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert den aktuellen Stand der Forschung zu Migration und Integration in Deutschland, sowie die Bedeutung der Aussiedlergruppe aus Polen für die deutsche Gesellschaft. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor, welche sich mit den Unterschieden in der Sozialisation zwischen einsprachig und zweisprachig aufgewachsenen Aussiedlern aus Polen auseinandersetzt.
- Sozialisation: Dieses Kapitel behandelt grundlegende Theorien und Konzepte der Sozialisation und Enkulturation, insbesondere die Rolle der Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz. Es beleuchtet die Bedeutung von Kultur und deren Einfluss auf die Erziehung sowie die Herausforderungen des Akkulturationsprozesses für Einwanderer.
- Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Sprachtheorien und den Theorien des Erstspracherwerbs. Es beleuchtet die Herausforderungen des Spracherwerbs in einem mehrsprachigen Umfeld und untersucht die Bedeutung der Muttersprache für die kulturelle Identität, sowie die Auswirkungen auf die Bildung und den schulischen Erfolg.
- Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie, die sich auf qualitative Sozialforschung konzentriert. Es erläutert die Auswahl der Interviewpartner, die Durchführung der narrativen Interviews und die methodische Auswertung der gewonnenen Daten.
- Ergebnisse der Erhebung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es analysiert die Interviews der deutschen Aussiedler aus Polen und untersucht die Unterschiede in ihren Sozialisationsprozessen, insbesondere in Bezug auf die Sprachentwicklung, die Bildung und die Identitätsbildung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Unterschiede in der Sozialisation von einsprachig und zweisprachig aufgewachsenen deutschen Aussiedlern aus Polen. Die Arbeit analysiert, welche Sprach- und Kulturkontexte bei den Aussiedlern während ihrer Sozialisation in Deutschland eine Rolle spielten und welchen Einfluss diese auf ihre Identität und ihre soziale Integration hatten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit sind: Sozialisation, Enkulturation, Kultur, Akkulturation, Identität, Sprache, Mehrsprachigkeit, Muttersprache, Integration, Aussiedler, deutsche Aussiedler aus Polen, Migranten, Sozialisationsfaktoren, Familie, Schule, Peergroup, empirische Untersuchung, qualitative Sozialforschung, narratives Interview.
- Quote paper
- Sylwia Kramkowski (Author), 2009, Unterschiede in der Sozialisation zwischen ein- und zweisprachig Aufgewachsenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144636