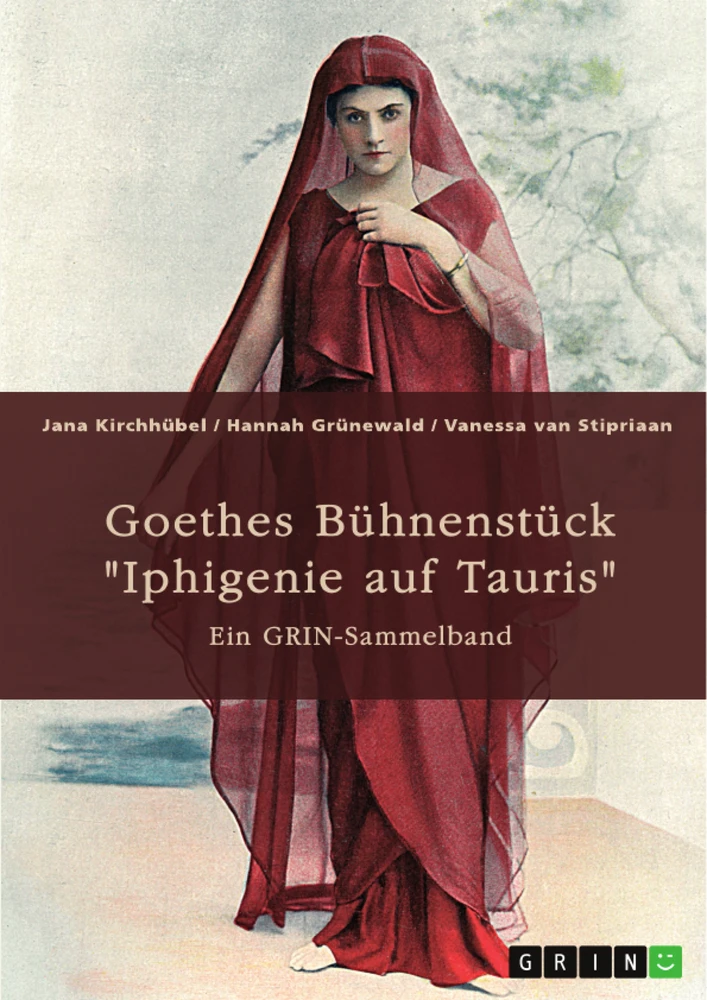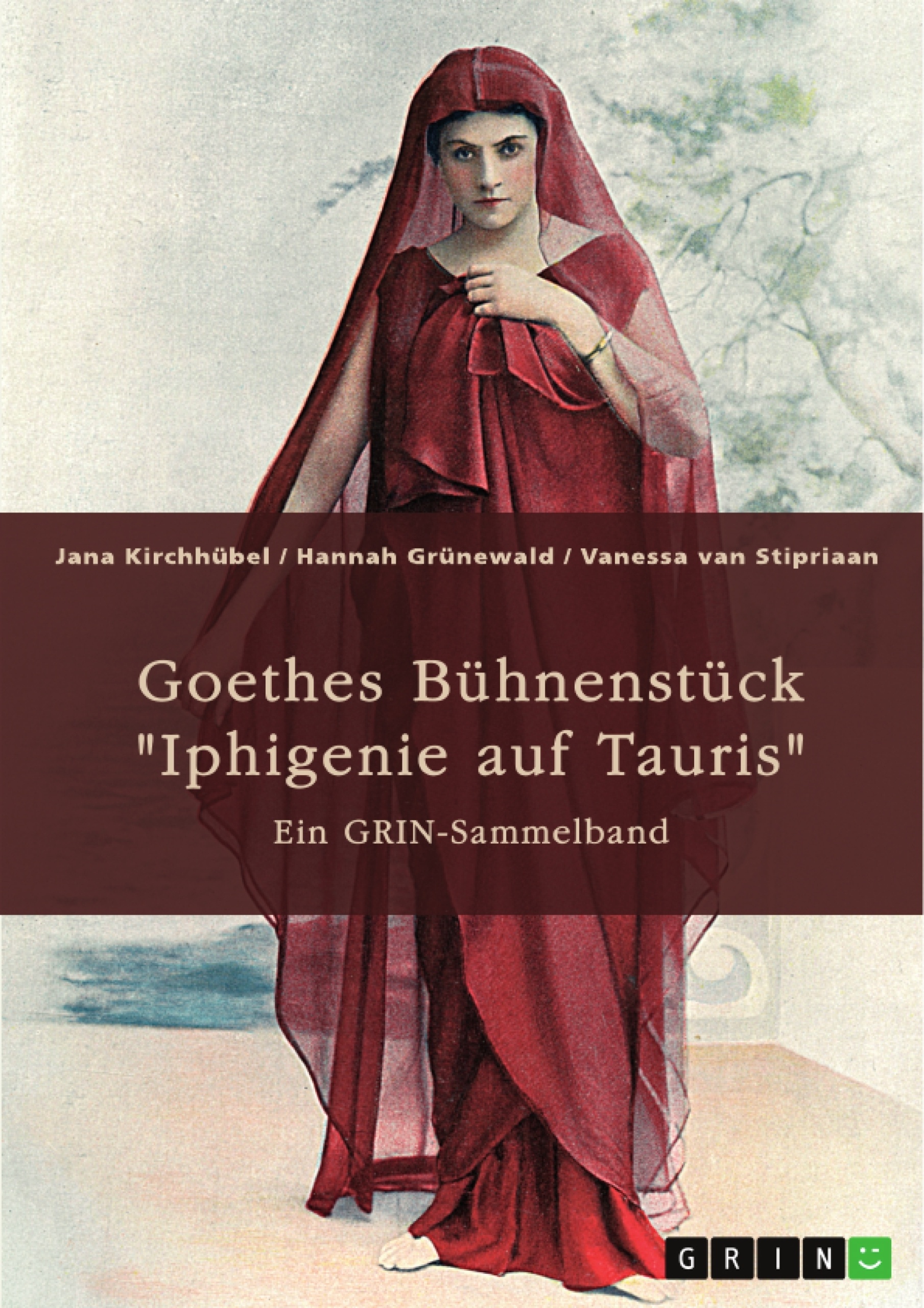Was mag Goethe dazu bewegt haben, wieder den alten klassizistischen Faden aufzunehmen? Setzte er tatsächlich alle Forderungen im französischen Sinne um? Oder passte er diese nicht vielmehr seinen eigenen Vorstellungen und denen seiner Zeitgenossen an? Auf welche Art und Weise geschah das? Dazu muss zunächst einmal untersucht werden, was die Forderungen überhaupt besagten, die vor allem durch die französischen Dramatiker Pierre Corneille und Jean Racine an Bedeutung erfahren haben, aber bereits in Aristoteles‘ "Poetik" ihren Ursprung finden. Bei allen diesen Untersuchungen steht die Thematik der "drei Einheiten" im Vordergrund.
Geradezu einig war man sich jahrelang um die "klassisch-humanistische" Deutung der Iphigenie, deren "Lesart lange unbezweifelt" blieb. Die Komponente der inneren Konflikte der Protagonistin blieben oft im Dunkeln, dabei scheint es fast unmöglich, bei der Analyse der Iphigenie nicht über unschlüssige Muster und Motive zu stolpern. Iphigenie als Heilerin und heilspendende, humanistische Heroine zu deklarieren, simplifiziert ihren vielschichtigen Charakter in allzu euphorischer Manier. In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand der Untersuchung der Kommunikation und des Verhaltens Iphigenies widersprüchliches, konfliktreiches Inneres zum Gegenstand der Interpretation machen. Dabei werde ich mich kritisch mit der Frage auseinandersetzen, wie sich Iphigenie als Mensch, vor allem aber als Frau den Konflikten ihres Daseins und den Konzepten des idealisierten Frauenbildes stellt.
Diese Arbeit wird sich nicht nur ausführlich mit Iphigenies Einfluss auf Orest beschäftigen, sondern im Besonderen mit der Figur des Orest selbst. Das Untersuchungsinteresse liegt auf seinem Wahnsinn, der Heilung des selbigen und dem Einfluss der Heldentradition auf seine Taten und Entscheidungen. In den folgenden Kapiteln wird Orest als eine Figur mit traumatischen Erlebnissen betrachtet und seine Taten werden mit diesem Hintergrund analysiert und im Handlungskontext eingeordnet. Es soll gezeigt werden, dass Orest ein vielschichtiger Charakter ist, der durch Erziehung und Traditionsbewusstsein in seine Lage geriet und am Ende des Stückes als autonome Figur sein Handeln selbst bestimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Lehre von den „drei Einheiten“
- Die Auseinandersetzung mit der antiken Regelpoetik in der Neuzeit
- Die Umsetzung der „drei Einheiten“ in Goethes „Iphigenie“
- Die Einheit der Handlung
- Die Einheit des Ortes und der Zeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Goethes „Iphigenie auf Tauris“ und untersucht, wie er die „drei Einheiten“ der klassischen Dramenlehre in seinem Werk aufnahm und umsetzte. Das Werk analysiert Goethes Umgang mit den Regeln des französischen Klassizismus und beleuchtet die Frage, ob er diese vollständig übernommen oder aber seinen eigenen Vorstellungen und denen seiner Zeitgenossen angepasst hat. Darüber hinaus werden die einzelnen Aspekte der „drei Einheiten“ – Einheit der Handlung, Einheit des Ortes und Einheit der Zeit – im Detail betrachtet.
- Goethes Verhältnis zum französischen Klassizismus
- Die „drei Einheiten“ in der Dramenlehre
- Analyse der „Iphigenie auf Tauris“ im Hinblick auf die „drei Einheiten“
- Goethes Interpretation der klassischen Dramenregeln
- Die Bedeutung der „drei Einheiten“ für die Gestaltung des Dramas
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und stellt Goethes Entwicklung und seine Haltung zur klassischen Dramenlehre dar. Dabei wird Goethes anfängliche Kritik an den „drei Einheiten“ und sein späterer Wechsel zu einer klassizistischen Schreibweise beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich der Lehre von den „drei Einheiten“ selbst. Hier werden die einzelnen Einheiten – Einheit der Handlung, Einheit des Ortes und Einheit der Zeit – definiert und ihre historischen Wurzeln in der Poetik des Aristoteles beleuchtet. Im dritten Kapitel wird die Auseinandersetzung mit der antiken Regelpoetik in der Neuzeit behandelt. Hierbei werden die verschiedenen Ansätze und Interpretationen der „drei Einheiten“ in der Renaissance und im Barock vorgestellt. Das vierte Kapitel analysiert Goethes „Iphigenie auf Tauris“ im Hinblick auf die „drei Einheiten“. Hier werden die einzelnen Aspekte des Dramas – wie die Einheit der Handlung, die Einheit des Ortes und die Einheit der Zeit – im Detail betrachtet und Goethes spezifische Umsetzung der klassischen Regeln analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: „Iphigenie auf Tauris“, Johann Wolfgang von Goethe, „drei Einheiten“, klassische Dramenlehre, französische Klassizismus, Aristoteles, Einheit der Handlung, Einheit des Ortes, Einheit der Zeit, Regelpoetik, Drama, Literaturgeschichte.
- Quote paper
- Jana Kirchhübel (Author), Hannah Grünewald (Author), Vanessa van Stipriaan (Author), GRIN Verlag (Hrsg.) (General editor), 2024, Goethes Bühnenstück "Iphigenie auf Tauris". Interpretationsansätze und Motivik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1442452