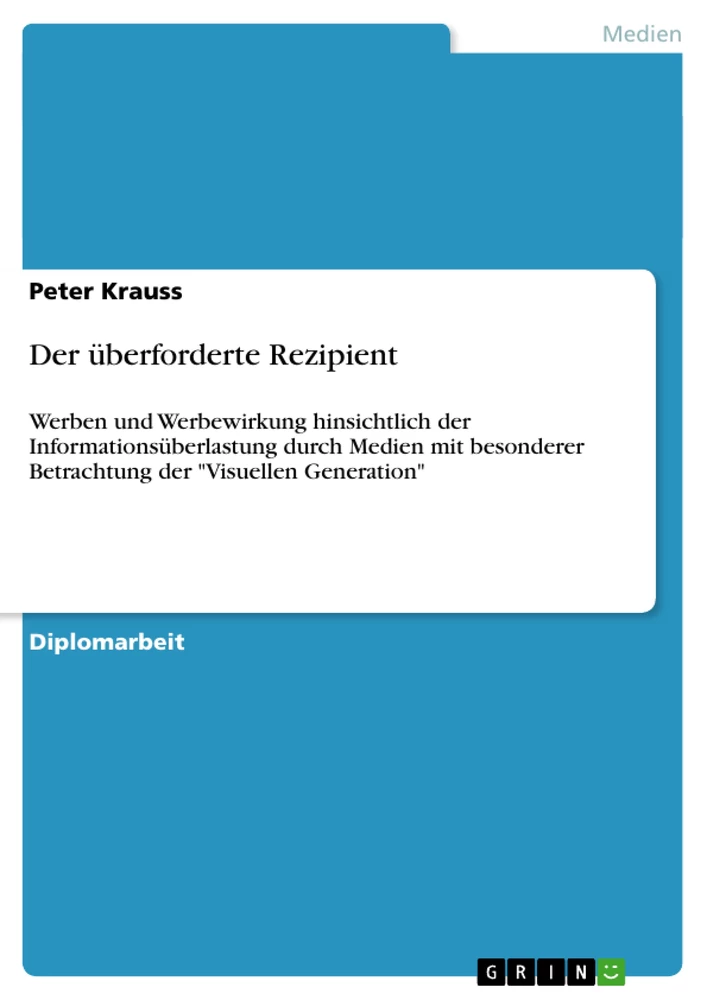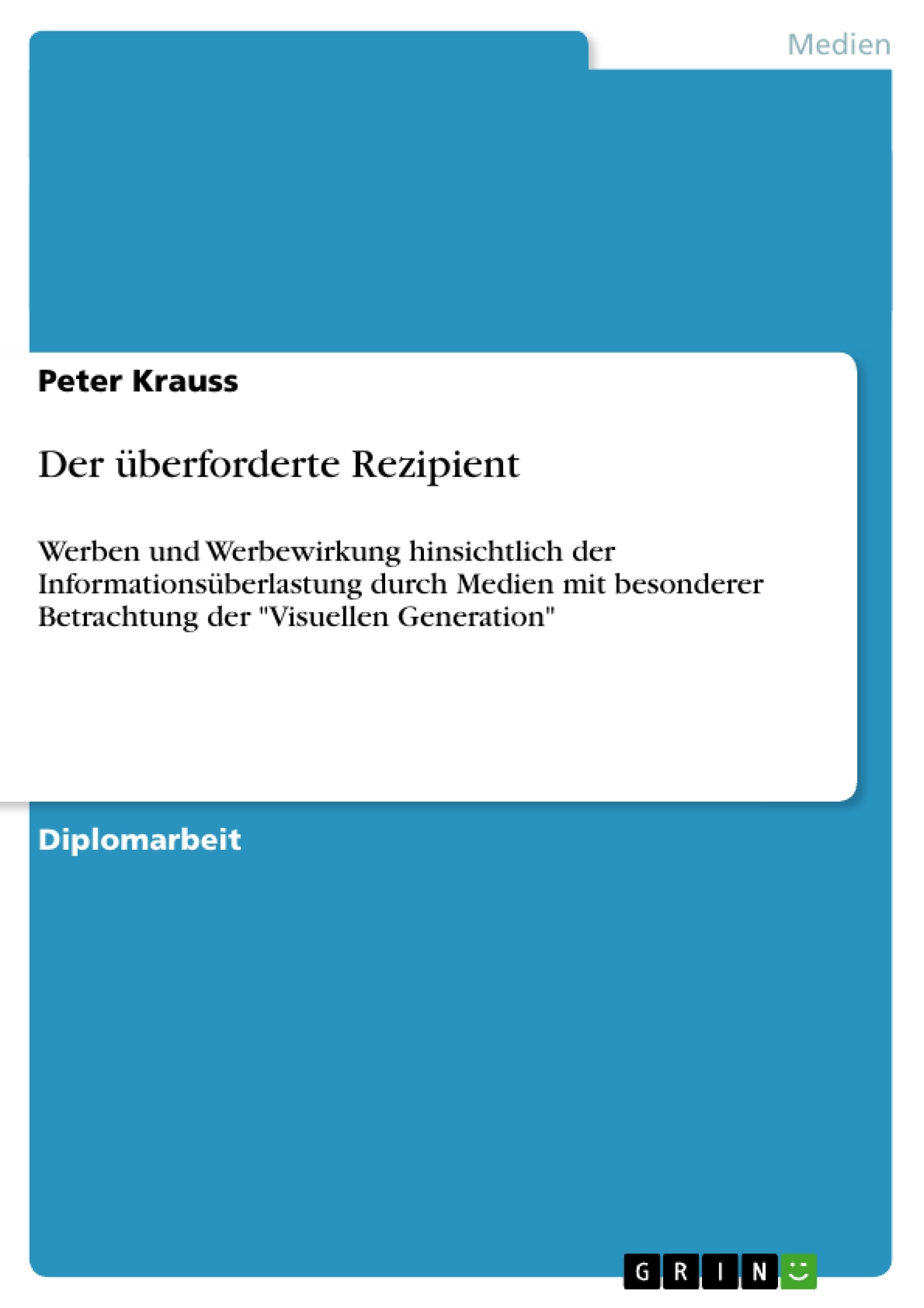Informationsaufnahme durch Text machte Platz für die Informationsaufnahme durch Bilder und „Learning by doing“. Schultz, Tannenbaum und Lauterborn bringen hier ein leicht verständliches Beispiel: Wo früher noch Bedienungsanleitungen gelesen wurden und man sich Schritt für Schritt durch die Kapitel arbeitete, wird heute herumprobiert und man findet sich durch visuelle Anhaltspunkte zurecht, nach dem Motto: „Einfach mal schauen was passiert“. Die drei Autoren gründen darauf auch die Aussage, dass sich die Kommunikation erhebliche verändert hat und weiter verändern wird, hin zur visuellen Kommunikation .
In dieser Diplomarbeit wird der Begriff vor allem mit den Reizen, die durch Werbebotschaften in den Medien verbreitet werden in Bezug gebracht. Werbung in all ihrer Verschiedenartigkeit ist heutzutage fast unumgänglich. Sie begegnet den Menschen täglich im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen und Zeitschriften, auf Plakaten oder beim Surfen im Internet. Beim Einkaufen hängt sie von der Decke, bewegt sich auf der Rolltreppe unter den Füßen, wird auf den Boden geklebt oder hängt an den Regalen.
Der Rezipient, beziehungsweise potentielle Konsument, hat seine eigene Methode sich den Werbebotschaften zu entziehen, er reagiert nicht mehr darauf beziehungsweise nur noch sehr sondiert.
Angesichts weitgehender Produkthomogenität, vor allem bei Gütern des täglichen Gebrauchs, ist es deshalb nicht verwunderlich, dass gerade werbliche Informationen dem zum Opfer fallen. Und ohne dass eine Botschaft wahrgenommen wird, kann sie nicht wirken.
Zudem herrscht allgemein keine gute Meinung gegenüber Werbebotschaften. Überlegungen wie „davon kann man sowieso nur die Hälfte glauben“ hatte wohl jeder schon einmal, denn schließlich waschen alle weißer als die anderen, schmecken am fruchtigsten und überbieten sich in sonstigen Superlativen.
Dies ist ein großes Problem der Werbetreibenden, denn es nützt die teuerste Werbung nichts, wenn sie den Betrachter nicht interessiert, weil er ihr mit Trotz, Ignoranz oder Misstrauen begegnet. Denn dem Verhalten des Rezipienten stehen sowohl die großen Summen gegenüber, die Unternehmen für ihre Werbung ausgeben wie auch der Wunsch, die eigenen Produkte zu verkaufen und sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage und Problemstellung
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Einschränkungen
- Was ist Werbung?
- Geschichte und Begriff der Werbung
- Die Werbung als Bestandteil des Marketing-Mix
- Werbemittel und Werbeträger
- Ziele der Werbung
- Entwicklungen des deutschen Werbemarktes
- Werbewirkung
- Attention - Wahrnehmung von Werbung
- Interest & Desire - Interesse und Bedürfnisbildung durch Werbung
- Das Produkt als Einflussfaktor
- Werbeträger und Werbemittel als Einflussfaktoren
- Der Rezipient als Einflussfaktor
- Action - Verhalten aufgrund von Werbewirkung
- Der überforderte Rezipient
- Informationsaufnahme – Das Drei-Speicher-Modell
- Informationsüberlastung
- Das Mediennutzungsverhalten der Deutschen
- Informationsüberlastung durch Medien und Werbung
- Die Problematik des informationsüberlasteten Konsumenten
- Die visuelle Generation
- Der Fragebogen
- Die visuelle Generation und die Medien
- Die visuelle Generation und die Werbung
- Allgemeine Aussagen und „visuelles Verhalten“
- Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- Werben für die visuelle Generation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik der Werbewirkung in Zeiten der Informationsüberlastung, insbesondere im Kontext der „Visuellen Generation“. Das Ziel ist es, die Herausforderungen der Werbekommunikation im digitalen Zeitalter zu analysieren und Strategien für eine effektive Ansprache der Zielgruppe zu entwickeln.
- Informationsüberlastung durch Medien und Werbung
- Wahrnehmung und Verarbeitung von Werbebotschaften
- Das Mediennutzungsverhalten der „Visuellen Generation“
- Eignung von Werbemitteln und -trägern für die „Visuelle Generation“
- Entwicklungen und Trends im deutschen Werbemarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Ausgangslage und Problemstellung sowie die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit darlegt. Anschließend wird der Begriff der Werbung definiert und in seinen historischen Kontext eingebettet. Es werden die verschiedenen Werbemittel, -träger und Ziele der Werbung sowie Entwicklungen des deutschen Werbemarktes betrachtet. Im weiteren Verlauf wird die Werbewirkung im Detail analysiert. Dabei wird der Einfluss von Produkten, Werbeträgern und Rezipienten auf die Wirkung von Werbung untersucht.
Die Arbeit widmet sich dann dem Phänomen der Informationsüberlastung und beleuchtet das Mediennutzungsverhalten der Deutschen. Die Problematik des informationsüberlasteten Konsumenten wird im Kontext von Medien und Werbung dargestellt. Schließlich wird die „Visuelle Generation“ im Fokus der Arbeit stehen und die spezifischen Mediennutzungs- und Werbepräferenzen dieser Generation untersucht. Die Ergebnisse der Befragung werden zusammengefasst und interpretiert. Abschließend werden Strategien für eine effektive Werbung für die „Visuelle Generation“ entwickelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Werbung, Werbewirkung, Informationsüberlastung, Mediennutzungsverhalten, „Visuelle Generation“, digitale Medien, Online-Werbung, Social Media, Marketing, Kommunikation, Konsumverhalten.
- Quote paper
- Peter Krauss (Author), 2006, Der überforderte Rezipient, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144202