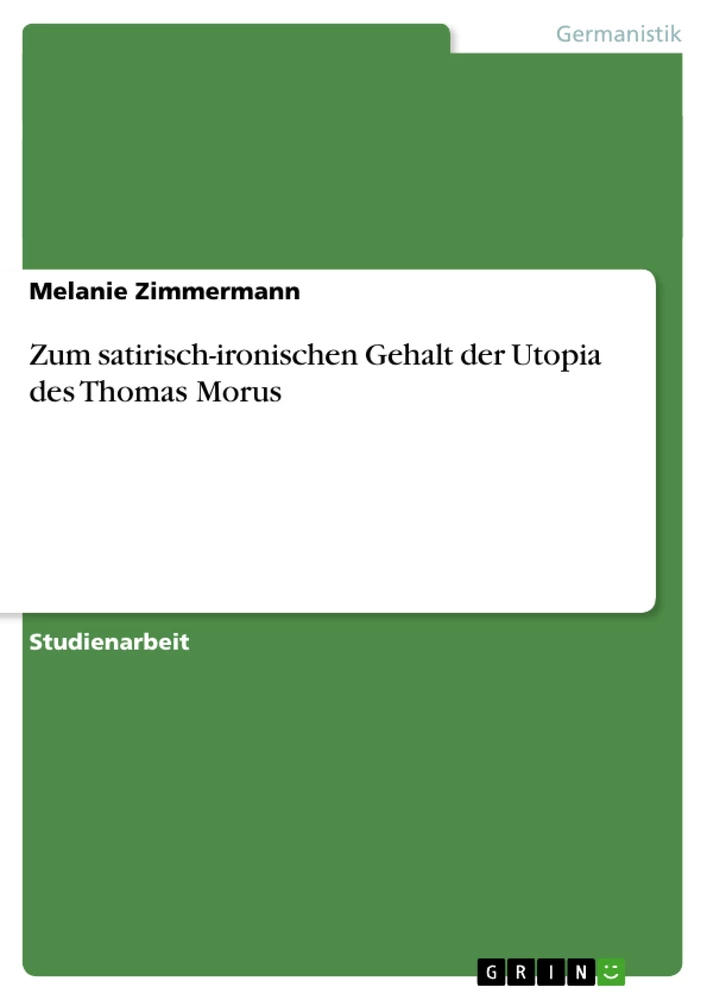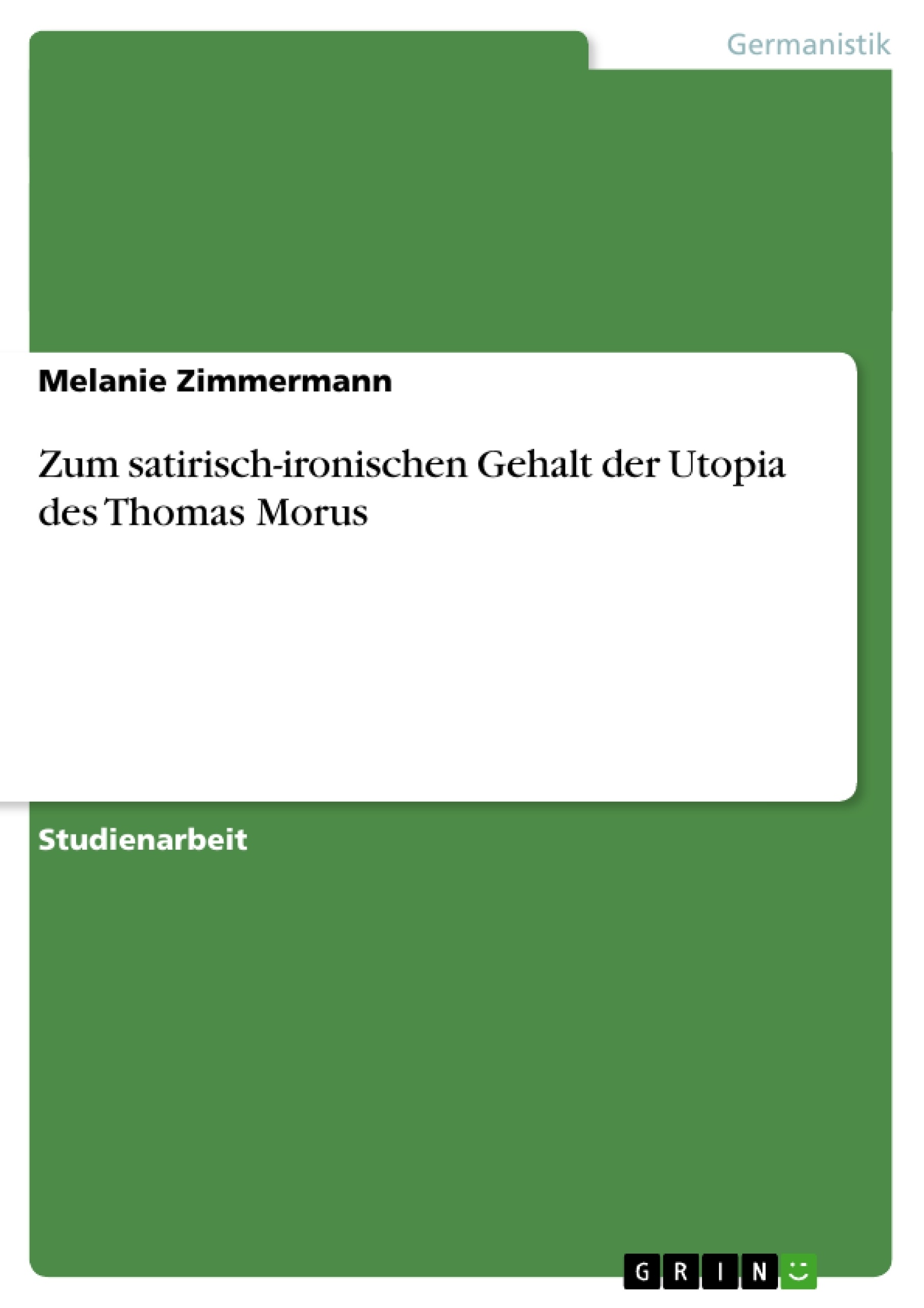Die Rezeptionsgeschichte der Utopia des Thomas Morus (1478–1535) ist nicht nur eine
zeitlich sehr umfangreiche, sondern auch eine vielgestaltige, in der die verschiedensten Interpretationsansätze
an das Werk herangetragen wurden und noch immer werden. So nahm
die Utopia-Rezeption unmittelbar nach der Veröffentlichung ihren Anfang bei den Humanisten
des frühen 16. Jahrhunderts, dem Freundes- und Bekanntenkreis von Morus, der seine
ursprünglich intendierte Leserschaft ausmachte. Es scheint Morus seinerzeit darum gegangen
zu sein, „die anvisierten Rezipienten in die Diskussion um gesellschaftliche
Probleme miteinzubeziehen und eine Diskussion über die Art und Weise möglicher Reformen
bei den in politischer Verantwortung stehenden Humanisten zu initiieren“, schreibt
Honke. Die Utopia ist „ein schillernder Beitrag zur Reformdiskussion der Zeit“ gewesen.
Das Werk erhielt auch besondere Zuwendung durch die Sozialisten des 19. und die Kommunisten
des 20. Jahrhunderts aufgrund des im zweiten Buch der Utopia beschriebenen
kommunistischen Gemeinwesens, das Morus’ Werk gewissermaßen als einem „programmatischen
Vorläufer“ Geltung verschaffte.
Im Unterschied zur Rezeption der Humanisten des frühen 16. Jahrhunderts, in der vorrangig
auf die politische, gesellschaftskritische Dimension des 'goldenen Büchleins' eingegangen
wurde, zeichnet sich die Rezeption seit dem 19. Jahrhundert durch die Berücksichtigung
der Biographie des Autors und eine stärkere Fokussierung auf die literarische
Komposition und die Bedeutungsdimensionen des Werkes aus. So notiert Kreyssig, es sei
seit „der Entstehung der modernen Philologien im 19. Jahrhundert [...] eine durchgängige
Deutungsmöglichkeit zu erkennen: Die Utopia wird als Spielerei, als jeu d’esprit und – seit
den sechziger Jahren [des 20.] Jahrhunderts – auch als Satire gesehen.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserläuterungen – Satire und Ironie
- Satire
- Ironie
- Zum satirisch-ironischen Gehalt der Utopia
- Entstehungsbedingungen – Gegenwartsbezüge
- Fiktive Welten
- Verzerrende Vorzeichen - Sprechende Eigennamen
- Der Titel
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den satirisch-ironischen Gehalt der Utopia des Thomas Morus. Ziel ist es, die vielschichtigen Interpretationsansätze des Werkes zu beleuchten und die Bedeutung von Satire und Ironie für die Gestaltung der utopischen Gesellschaft in Morus' Werk zu analysieren.
- Die Entstehungsbedingungen der Utopia und die Gegenwartsbezüge des Werkes
- Die literarischen Mittel der Satire und Ironie in Morus' Utopia
- Die Konstruktion der fiktiven Welt Utopias und ihre Funktion im Kontext der Kritik an der europäischen Gesellschaft
- Die Rezeption der Utopia im Laufe der Geschichte und die unterschiedlichen Deutungsansätze des Werkes
- Die Bedeutung des Werkes für die Utopieforschung und die zeitgenössische Debatte über gesellschaftliche Verhältnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die vielgestaltige Rezeptionsgeschichte der Utopia des Thomas Morus und stellt unterschiedliche Interpretationsansätze vor. Das zweite Kapitel erläutert die Begriffe Satire und Ironie und beleuchtet deren Funktion im Kontext des literarischen Werkes. Kapitel drei widmet sich der satirisch-ironischen Gestaltung der Utopia und analysiert die Entstehungsbedingungen des Werkes, die Konstruktion der fiktiven Welt Utopias und die Verwendung von sprechenden Eigennamen und dem Titel als satirische Mittel.
Schlüsselwörter
Thomas Morus, Utopia, Satire, Ironie, Utopieforschung, politische und literarische Dimension, Rezeption, Gegenwartsbezüge, Fiktive Welten, sprechende Eigennamen, Gesellschaftliche Kritik.
- Quote paper
- Melanie Zimmermann (Author), 2009, Zum satirisch-ironischen Gehalt der Utopia des Thomas Morus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144129