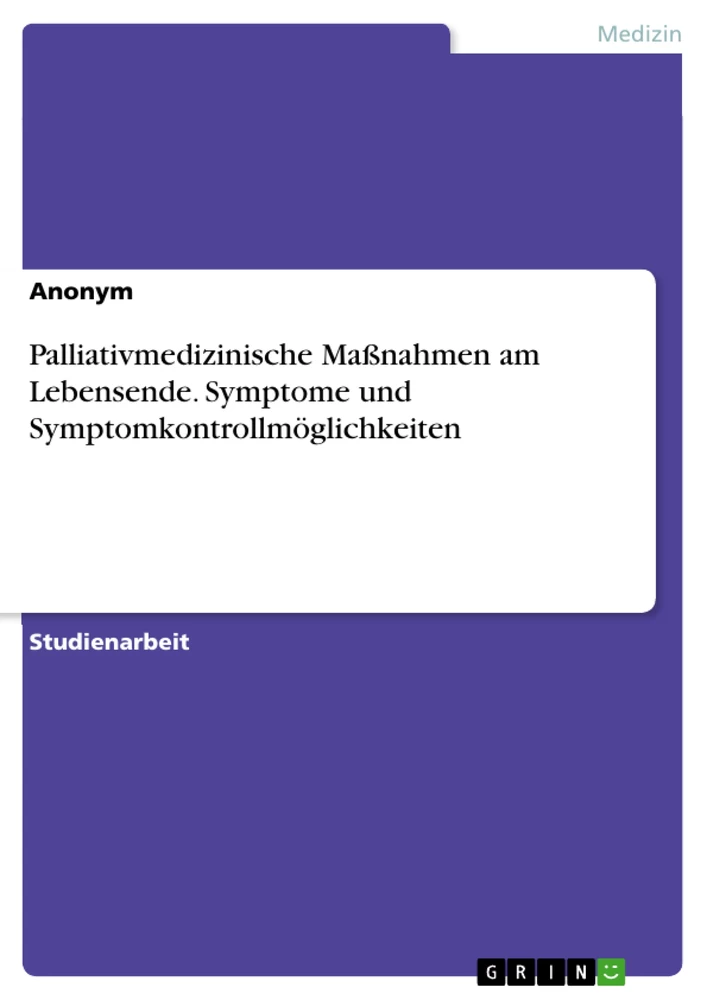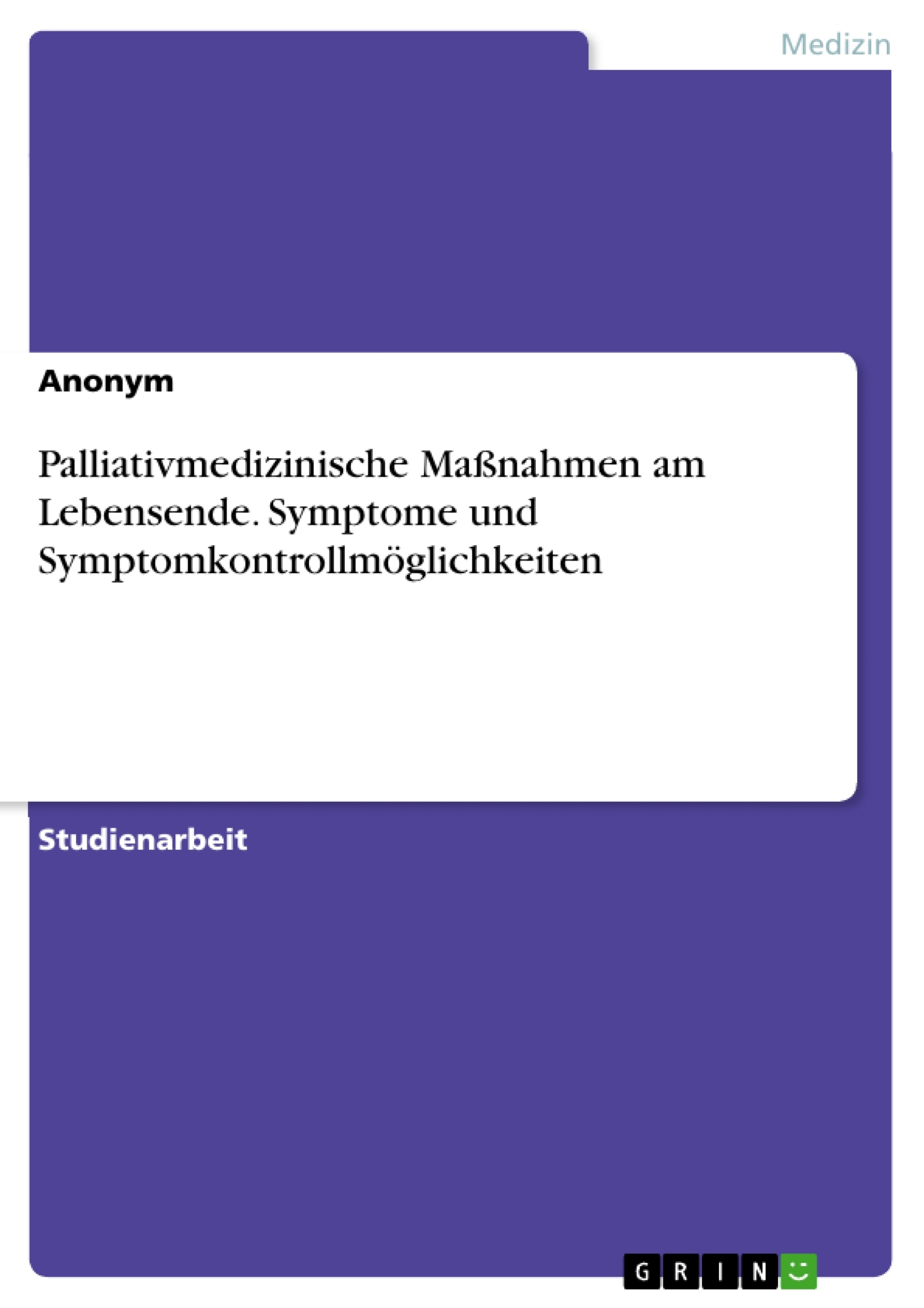Die Hausarbeit beschreibt gängige Symptome und Symptomkontrollmöglichkeiten im Rahmen palliativmedizinischer Maßnahmen am Lebensende.
Mit dem Voranschreiten des medizinischen Wissens und der Spezifikation der gesundheitlichen Pflege in der Mitte des 20. Jahrhunderts erlangte der Bereich der Versorgung von Patienten in der krankheitsbedingten Sterbephase kumulativ an Bedeutung. Die Erkenntnis, dass Patienten mit fortschreitenden Erkrankungen insbesondere im Bereich der Onkologie unzureichend versorgt wurden und mit erheblichen Symptomen zu kämpfen hatten, wurde von Dame Ciceley Saunders erkannt. Sie war eine englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und später Ärztin, die daraufhin das erste moderne Hospiz, das St. Christopher's Hospice in London gründete. Ihre eminente Arbeit entfachte die Verbreitung solcher Einrichtungen im europäischen Raum. In Deutschland wurde die erste Palliativstation 1983 in Köln, das erste Hospiz 1986 in Aachen eröffnet.
Weitere Zäsuren in der deutschen Palliativversorgung können verzeichnet werden; im Jahr 2007 wurde die Richtlinie für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) gesetzlich verankert. Zwei Jahre später wurde die Palliativmedizin in die ärztliche Approbationsordnung eingegliedert und ist seitdem fester Bestandteil der ärztlichen Ausbildung. Die nationale Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland wurde im Jahr 2010 veröffentlicht. 2015 wurde die S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung entwickelt; im selben Jahr wurde das Hospiz- und Palliativgesetz eingeführt.
Diese kurze historische Einführung dient der besseren Einordnung des Begriffs. Im Rahmen dieser Arbeit soll allerdings weder eine geschichtliche noch eine rechtliche Kontextualisierung stattfinden. Vielmehr wird eine prägnante Übersicht palliativmedizinischer Maßnahmen hinsichtlich der hier allenfalls paradigmatisch erläuterten gängigen Symptome am Lebensende dargeboten werden. Dazu gilt es zunächst den Begriff der Palliativmedizin bzw. -versorgung zu definieren. Nach der Beschreibung der Symptome am Lebensende und der entsprechenden Kontrollmöglichkeiten durch palliativ-medizinische Maßnahmen wird im Rahmen des Fazits die Bedeutung einer multimodalen Versorgung unterstrichen.
Inhaltsverzeichnis
- Sprachliche Gleichstellung
- A. Einleitung und Geschichte
- B. Begriffserklärung
- C. Symptome und Kontrollmöglichkeiten
- I. Schmerzen
- 1. Schmerzkontrolle
- II. Dyspnoe
- 1. Kontrolle der Dyspnoe
- III. Übelkeit und Erbrechen
- 1. Kontrolle von Übelkeit und Erbrechen
- IV. Angst
- 1. Angstkontrolle
- V. Depression
- 1. Kontrolle der Depression
- VI. Weitere häufige Symptome am Lebensende
- I. Schmerzen
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine prägnante Übersicht über palliativmedizinische Maßnahmen zur Behandlung gängiger Symptome am Lebensende. Die Zielsetzung ist, die wichtigsten Symptome zu beschreiben und entsprechende Kontrollmöglichkeiten aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf einer klaren und übersichtlichen Darstellung, ohne dabei auf wissenschaftliche Genauigkeit zu verzichten.
- Historische Entwicklung der Palliativmedizin
- Definition und Begriffserklärung der Palliativversorgung
- Häufige Symptome am Lebensende (Schmerz, Dyspnoe, Übelkeit/Erbrechen, Angst, Depression)
- Palliativmedizinische Maßnahmen zur Symptomkontrolle
- Bedeutung einer multimodalen Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung und Geschichte: Diese Einleitung skizziert die Entwicklung der Palliativversorgung vom 20. Jahrhundert bis heute. Sie beschreibt die zunehmende Bedeutung der Palliativmedizin, beginnend mit der Arbeit von Dame Cicely Saunders und der Gründung des ersten modernen Hospizes. Die Entwicklung in Deutschland wird mit der Eröffnung der ersten Palliativstation und des ersten Hospizes, sowie der gesetzlichen Verankerung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) und der Integration der Palliativmedizin in die ärztliche Ausbildung nachgezeichnet. Die nationale Charta und die S3-Leitlinie werden ebenfalls erwähnt. Der Abschnitt betont die Wichtigkeit des historischen Kontextes, ohne diesen jedoch im Detail zu behandeln. Der Fokus der Arbeit liegt auf den praktischen Aspekten der palliativen Versorgung.
B. Begriffserklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Palliativmedizin und -versorgung. Es wird die Heterogenität der Definitionen hervorgehoben und die Definition der WHO aus dem Jahr 2002 zitiert, welche die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien im Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen betont. Der Abschnitt erwähnt weitere definitorische Ansätze, verzichtet aber auf eine umfassende Darstellung des gesamten Spektrums an Definitionen.
C. Symptome und Kontrollmöglichkeiten: Dieser Abschnitt befasst sich mit gängigen Symptomen am Lebensende und deren Behandlung. Aufgrund des begrenzten Rahmens werden nur einige Symptome ausführlicher behandelt. Die Kapitel erläutern die Schmerzdefinition der IASP und differenzieren zwischen Nozizeptor- und neuropathischem Schmerz, mit Beispielen für die Entstehung und die Behandlung. Der Abschnitt betont die Wichtigkeit einer umfassenden Schmerzanamnese und einer multimodalen Therapie, die neben Medikamenten auch psychologische und physikalische Therapien einschließt. Die Berücksichtigung von Nebenwirkungen wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Palliativmedizin, Palliativversorgung, Symptomkontrolle, Schmerztherapie, Lebensende, Hospiz, SAPV, multimodale Versorgung, WHO-Definition, Schmerz, Dyspnoe, Übelkeit, Erbrechen, Angst, Depression.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Palliativmedizinische Symptomkontrolle"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die palliative Medizin, insbesondere die Symptomkontrolle am Lebensende. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung gängiger Symptome (Schmerz, Dyspnoe, Übelkeit/Erbrechen, Angst, Depression) und deren Behandlungsmöglichkeiten.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die wichtigsten Themen sind die historische Entwicklung der Palliativmedizin, die Definition von Palliativversorgung, häufige Symptome am Lebensende und deren palliative Behandlung, die Bedeutung einer multimodalen Versorgung und die wichtigsten Aspekte der Schmerztherapie. Das Dokument beleuchtet die Schmerzdefinition der IASP und differenziert zwischen Nozizeptor- und neuropathischem Schmerz.
Welche Symptome werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt detailliert die folgenden Symptome und deren Kontrolle: Schmerz (einschließlich Schmerzkontrolle), Dyspnoe (einschließlich Kontrollmöglichkeiten der Dyspnoe), Übelkeit und Erbrechen (einschließlich Kontrollmethoden), Angst (einschließlich Angstkontrolle) und Depression (einschließlich Kontrollmöglichkeiten der Depression). Weitere häufige Symptome am Lebensende werden ebenfalls erwähnt.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in verschiedene Abschnitte gegliedert: Eine Einleitung mit historischem Überblick, ein Kapitel zur Begriffserklärung von Palliativmedizin und -versorgung, ein ausführlicher Abschnitt zu Symptomen und deren Kontrollmöglichkeiten, und abschließend ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen prägnanten Überblick über den jeweiligen Inhalt.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, eine prägnante Übersicht über palliativmedizinische Maßnahmen zur Behandlung gängiger Symptome am Lebensende zu bieten. Es soll die wichtigsten Symptome beschreiben und entsprechende Kontrollmöglichkeiten aufzeigen, wobei der Fokus auf einer klaren und übersichtlichen Darstellung liegt, ohne auf wissenschaftliche Genauigkeit zu verzichten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Palliativmedizin, Palliativversorgung, Symptomkontrolle, Schmerztherapie, Lebensende, Hospiz, SAPV, multimodale Versorgung, WHO-Definition, Schmerz, Dyspnoe, Übelkeit, Erbrechen, Angst, Depression.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Die Zielgruppe ist nicht explizit genannt, aber aufgrund des Inhalts und des Niveaus der Informationen lässt sich vermuten, dass es sich an Personen richtet, die sich im Rahmen einer akademischen Auseinandersetzung mit dem Thema Palliativmedizin befassen (z.B. Studenten, Wissenschaftler).
Welche Definition von Palliativmedizin wird verwendet?
Das Dokument erwähnt die WHO-Definition von Palliativmedizin aus dem Jahr 2002, welche die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien im Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen betont. Es wird aber auch auf die Heterogenität der Definitionen hingewiesen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2023, Palliativmedizinische Maßnahmen am Lebensende. Symptome und Symptomkontrollmöglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1440938