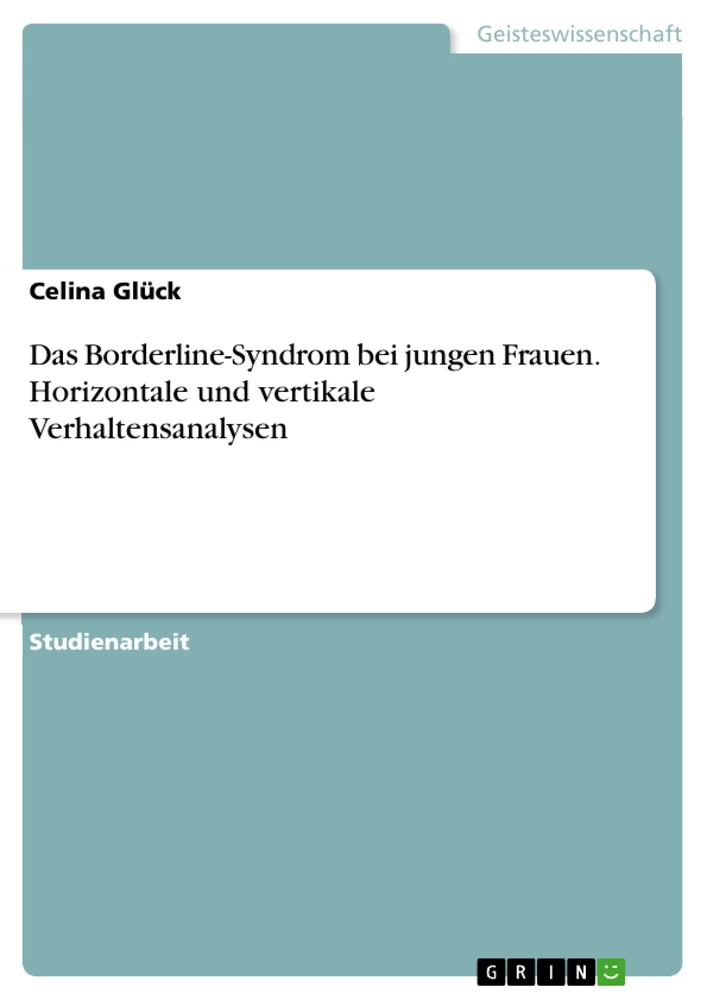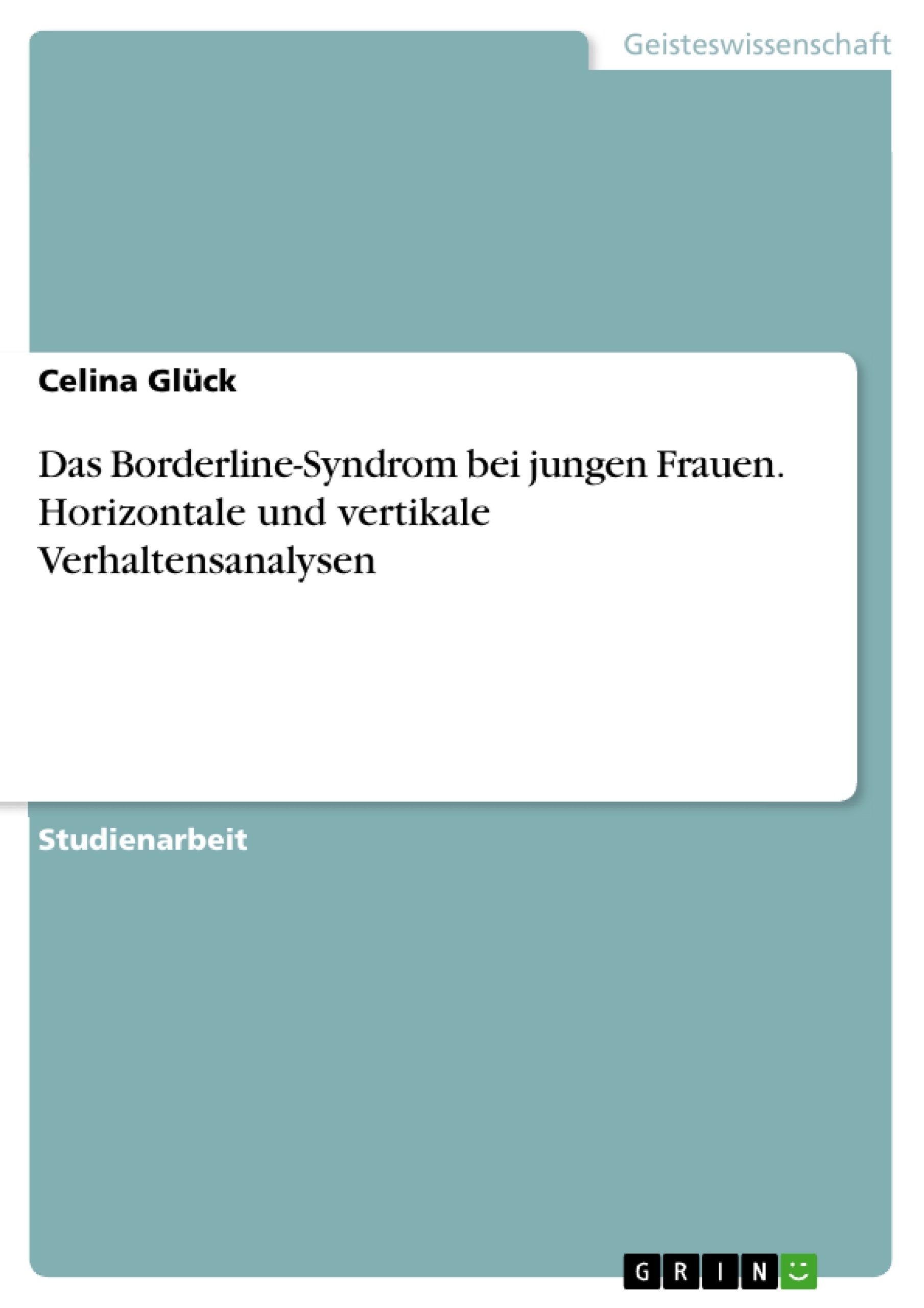Die Arbeit beschäftigt sich im theoretischen Teil mit den Symptomen, die im Rahmen einer Borderline-Störung auftreten, sowie mit weiteren empirischen Grundlagen der Thematik. Zusätzlich werden mögliche Entstehungsursachen und allgemeine Prävalenzraten aufgezeigt. Des Weiteren erfolgen statistische Daten und Verläufe in Bezug auf das Angebot von Psychotherapie für Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die durchschnittliche stationäre Behandlungsdauer und die Prävalenz potenziell chronisch-psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit und ohne Suchterkrankungen der Eltern. Der Praxisteil dieser Arbeit beschreibt eine Konzeptualisierung sowie Therapieplanung mithilfe einer horizontalen und vertikalen Verhaltensanalyse an einem imaginären Fallbeispiel. Anhand des Fallbeispiels ist es wichtig, die Biografie der Patientin zu erarbeiten. Zum Schluss werden die Ergebnisse diskutiert und Empfehlungen für Präventionsmaßnahmen abgeleitet. Mit einem kurzen Ausblick endet die Arbeit, indem erläutert wird, inwieweit die vorgegebenen Empfehlungen weiterverwendet werden können, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können und was hierfür die nächste Schritte wären.
Ungefähr 2 – 3% der Weltbevölkerung leiden laut Experten-Einschätzung an der Borderline-Störung, davon sind die meisten Betroffenen im Jugendalter bzw. jungen Erwachsenenalter. Hiervon sind 80% der Patienten weiblich. Doch was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, was ist die Entstehungsursache und Grundlage für die Borderline-Störung, welche Symptomatik tritt auf und wie kann man präventiv gegen die Entstehung von Borderline vorgehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Theoretische und empirische Grundlagen des Borderline-Syndroms
- Klassifizierung und Symptomatik der Borderline-Störung
- Entstehungsursache (Ätiologie) der Borderline-Störung
- Statistische Daten und Verläufe des Borderline-Syndroms
- Prävalenzrate bei der Allgemeinbevölkerung
- Prävalenzrate bei Jugendlichen
- Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung am Beispiel des Borderline-Syndroms
- Diagnostik-Ergebnisse
- Problemanalyse auf der Makroebene: Die vertikale Verhaltensanalyse
- Biografische Anamnese
- Disponierende Bedingungen (angeborene/erworbene Vulnerabilität/Resilienz)
- Auslösende Faktoren & Prozesse (Stressoren/Ressourcen)
- Verlaufsbestimmende/Aufrechterhaltende Faktoren (aktuelle Stressoren & Ressourcen)
- Mikroanalyse: Die horizontale Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell
- Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell
- Verhaltensmodifikation
- Schemaanalyse (kognitive Analyse)
- Therapieziele und Behandlungsplan
- Behandlungsmotivation & Kooperationsfähigkeit
- Rahmenbedingungen
- Behandlungsziele & Therapieprognose
- Therapeutische Interventionen & Reihenfolge
- Diskussion
- Empfehlungen zur Prävention von Borderline
- Ausblick für zukünftige präventive Ansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Borderline-Syndrom, insbesondere bei jungen Frauen. Sie zielt darauf ab, die Symptomatik, Entstehungsursachen und Prävalenzraten der Störung zu beleuchten. Darüber hinaus wird ein Fallbeispiel zur Konzeptualisierung und Therapieplanung mit horizontaler und vertikaler Verhaltensanalyse vorgestellt. Die Arbeit gipfelt in einer Diskussion über Präventionsmaßnahmen und einen Ausblick auf zukünftige Ansätze.
- Symptome und Klassifizierung der Borderline-Störung
- Entstehungsursachen (Ätiologie) der Borderline-Störung
- Prävalenzraten der Störung in der Allgemeinbevölkerung und bei Jugendlichen
- Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung mit horizontaler und vertikaler Verhaltensanalyse
- Präventionsmaßnahmen und zukünftige Ansätze zur Vermeidung des Borderline-Syndroms
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine allgemeine Einführung in die Borderline-Persönlichkeitsstörung, beleuchtet die Prävalenzraten und stellt grundlegende Fragen zur Störung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den theoretischen und empirischen Grundlagen des Borderline-Syndroms. Hier werden die Klassifizierung und Symptomatik der Störung, mögliche Entstehungsursachen und statistische Daten zur Prävalenz in der Bevölkerung und bei Jugendlichen beleuchtet. Kapitel 3 präsentiert eine Fallkonzeptualisierung und Therapieplanung mithilfe einer horizontalen und vertikalen Verhaltensanalyse an einem imaginären Fallbeispiel. Hierbei werden die Biografie der Patientin erarbeitet, Diagnostik-Ergebnisse, die Problemanalyse auf der Makroebene und die Mikroanalyse nach dem SORKC-Modell diskutiert. Darüber hinaus werden Therapieziele und ein Behandlungsplan vorgestellt. Kapitel 4 behandelt die Diskussion der Ergebnisse und leitet Empfehlungen für Präventionsmaßnahmen ab. Im Ausblick wird erläutert, wie die Empfehlungen weiterverwendet und in der Praxis umgesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, Borderline-Syndrom, Symptomatik, Ätiologie, Prävalenz, Jugendliche, Frauen, Verhaltensanalyse, Fallkonzeptualisierung, Therapieplanung, Prävention, Empfehlungen, Ausblick.
- Quote paper
- Celina Glück (Author), 2023, Das Borderline-Syndrom bei jungen Frauen. Horizontale und vertikale Verhaltensanalysen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1440916