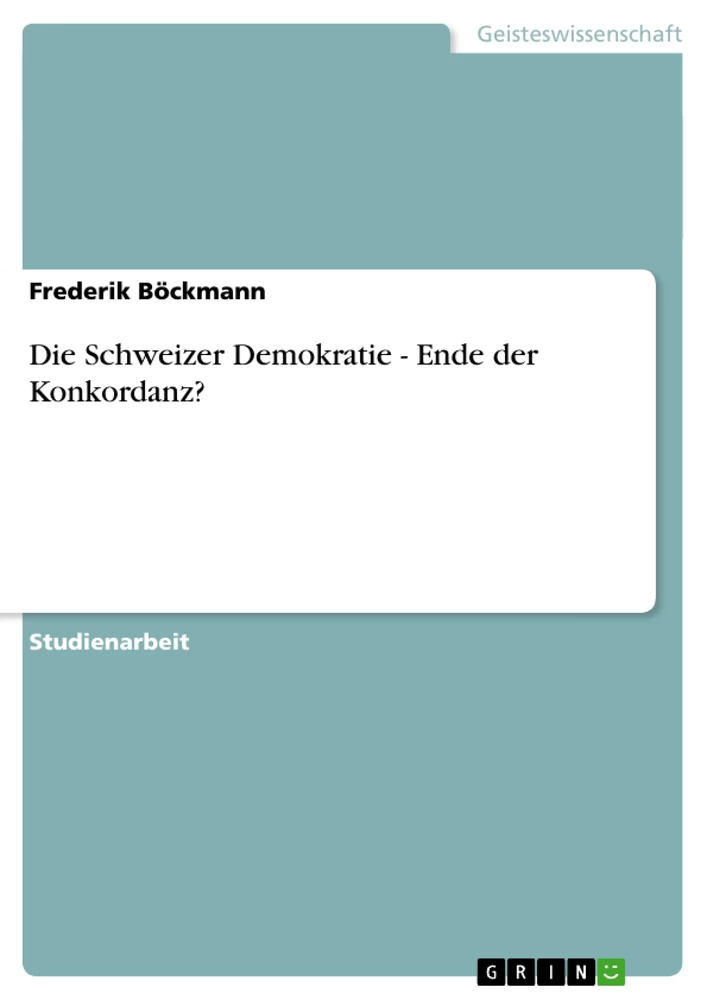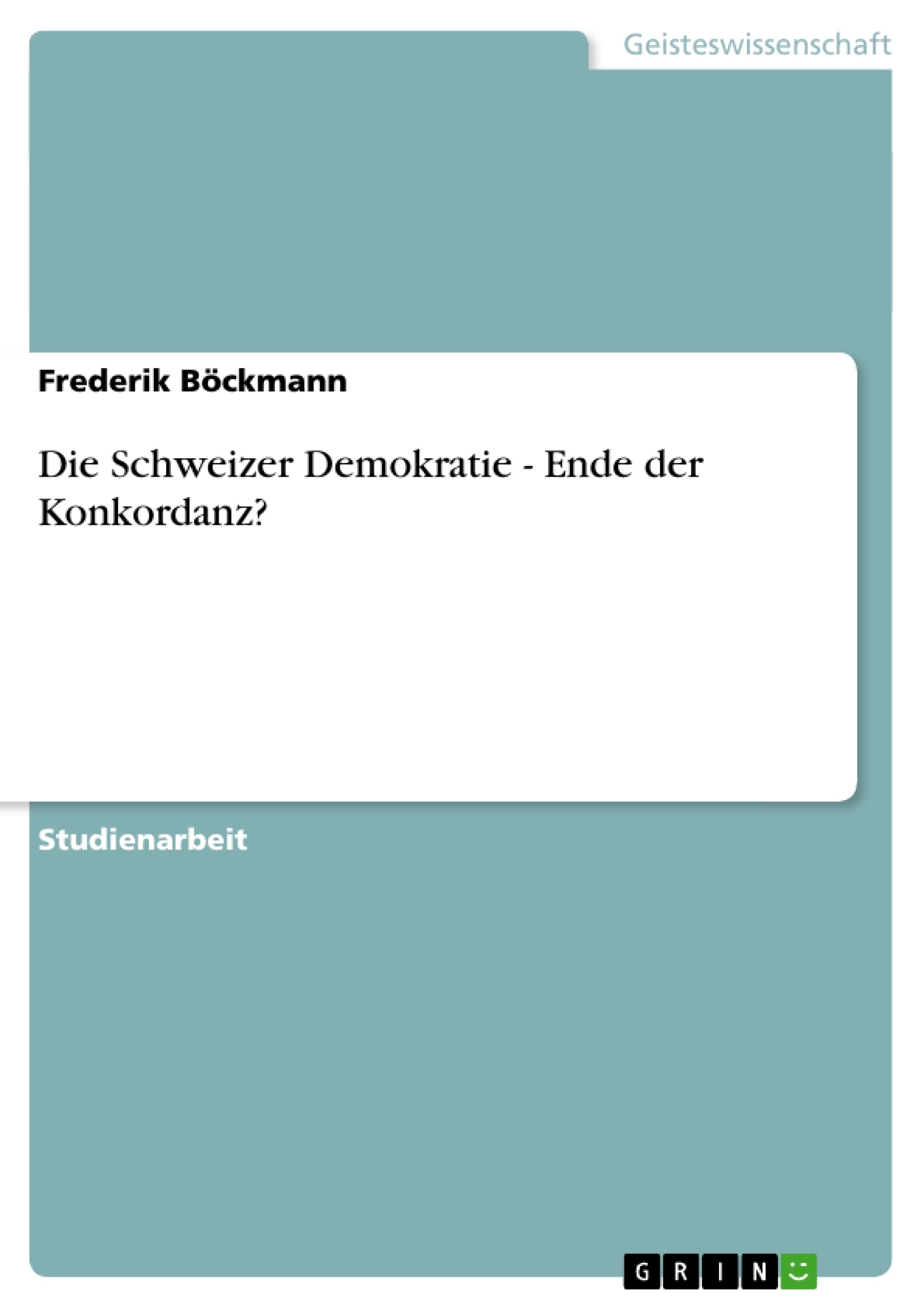„Die Schweiz ist ein Experiment, das nicht abgebrochen werden kann“, sagte einst der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt. Wichtigster Bestandteil dieses „Experiments“ ist die Konkordanz – eine Form der Verhandlungsdemokratie, die darauf abzielt, eine möglichst große Zahl von Akteuren in den politischen Prozess einzuziehen und Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu treffen. Aus diesem Grund gelten der Staat und das politisches System der Schweiz gemeinhin als Sonderfall, Unikum oder Paradebeispiel einer Konkordanzdemokratie. Allerdings gibt es auch Einwände, die Schweiz nicht als Konkordanzdemokratie einzustufen. Denn ihr Vielparteiensystem sowie ihre hochgradig segmentierte Gesellschaft hätten die Schweiz instabil, ihr hochkomplexes politisches Entscheidungssystem hanglungsunfähig, ihre dauerhaften Verteilungskoalitionen wirtschaftlich ineffektiv machen müssen. Doch die Schweiz stand jahrzehntelang Pate für ihre Systemstabilität und Leistungsfähigkeit. In den vergangenen Jahren hat die schweizerische Demokratie jedoch weiteren regen Zulauf in den politischen Diskussionen bekommen, denn die Stabilität der Konkordanz hatte nach den Wahlen 2003 erste Risse bekommen. Nachdem dort erstmals nach 131 Jahren ein amtierendes Regierungsmitglied abgewählt und die traditionelle, bis dahin unveränderte „Zauberformel“ gesprengt worden ist, sprach man bei den Eidgenossen schon selbst davon, dass die Konkordanz „zu Grabe getragen“ (vgl. Arens 2003) worden sei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Rahmenbedingungen
- Kleinstaatlichkeit
- Pluralität
- Geschichte
- Politisches System
- Allgemeine Besonderheiten
- Föderalismus
- Direkte Demokratie
- Erfüllte die Schweiz noch die Bedingungen einer Konkordanzdemokratie
- Eine tief zerklüftete Gesellschaft
- Entscheidungsfindung entgegen der Mehrheitsregel
- Vetorechte aller relevanten Bevölkerungsgruppen und deren Einbezug in die Regierung
- Proportionalität bei der Besetzung von politischen Ämtern
- Einflusssphären jeder Bevölkerungsgruppe in bestimmten Bereichen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das politische System der Schweiz und analysiert, inwieweit die Schweiz noch als Konkordanzdemokratie bezeichnet werden kann. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung und die institutionellen Besonderheiten des Schweizer Systems.
- Definition und Charakteristika der Konkordanzdemokratie
- Analyse der Rahmenbedingungen der Schweiz (Kleinstaatlichkeit, Pluralität, Geschichte)
- Bewertung des Einflusses der Schweizer Institutionen auf die Staatstätigkeit
- Untersuchung der Erfüllung der Kriterien einer Konkordanzdemokratie im heutigen Kontext
- Abschließende Beurteilung der gegenwärtigen Situation der Schweizer Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Fortbestand der Konkordanzdemokratie in der Schweiz. Sie verweist auf die historische Stabilität des Systems und die jüngeren Herausforderungen, die durch die Wahlen 2003 sichtbar wurden, in denen die traditionelle „Zauberformel“ der Regierung erstmals gebrochen wurde. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik der Analyse.
Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Konkordanzdemokratie nach Gerhard Lehmbruch als ein System, das auf Konsens und Kompromissfindung durch Einbezug vieler Akteure abzielt. Im Gegensatz zum Mehrheitsprinzip steht die Machtteilung und die Aushandlung von Kompromissen im Vordergrund. Die institutionelle Sicherung geschieht durch Proportionalität bei der Regierungsbildung und die Gewährung von Vetorechten an relevante gesellschaftliche Gruppen. Der Fokus liegt auf Konfliktregelung durch Aushandeln statt durch Mehrheitsentscheidungen.
Rahmenbedingungen: Dieser Abschnitt beleuchtet die spezifischen Rahmenbedingungen der Schweiz, die zur Entwicklung der Konkordanzdemokratie beigetragen haben. Kleinstaatlichkeit, Pluralität und die historische Entwicklung werden als wichtige Faktoren herausgestellt, die die Entstehung und den Fortbestand des Konsensmodells beeinflusst haben. Die tiefgreifenden gesellschaftlichen Spaltungen in der Schweiz werden als Ausgangspunkt für die Notwendigkeit von Konsensmechanismen dargestellt.
Politisches System: Dieses Kapitel beschreibt das politische System der Schweiz mit seinen Besonderheiten. Der Föderalismus, die direkte Demokratie und weitere institutionelle Merkmale werden analysiert und im Kontext der Konkordanzdemokratie eingeordnet. Die Kapitel untersucht, wie diese Elemente zum Funktionieren des Systems beitragen und wie sie die Entscheidungsfindung beeinflussen.
Erfüllte die Schweiz noch die Bedingungen einer Konkordanzdemokratie: Dieser Abschnitt analysiert, inwieweit die Schweiz die Kriterien einer Konkordanzdemokratie weiterhin erfüllt. Die tief zerklüftete Gesellschaft, die Entscheidungsfindung entgegen der Mehrheitsregel, Vetorechte, die Proportionalität bei der Regierungsbildung und die Einflusssphären der verschiedenen Bevölkerungsgruppen werden im Detail untersucht und im Lichte der aktuellen politischen Entwicklungen bewertet. Die Kapitel bewertet, ob die in der Definition genannten Charakteristika noch zutreffen.
Schlüsselwörter
Konkordanzdemokratie, Verhandlungsdemokratie, Schweiz, Politisches System, Föderalismus, Direkte Demokratie, Machtteilung, Konsens, Kompromiss, Pluralismus, Kleinstaatlichkeit, Vetorechte, Proportionalität, Regierungsbildung, gesellschaftliche Spaltung, Stabilität, „Zauberformel“.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Konkordanzdemokratie in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht das politische System der Schweiz und analysiert, inwieweit die Schweiz noch als Konkordanzdemokratie bezeichnet werden kann. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und die institutionellen Besonderheiten des Schweizer Systems und untersucht, ob die Schweiz die Kriterien einer Konkordanzdemokratie im heutigen Kontext weiterhin erfüllt.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika der Konkordanzdemokratie; Analyse der Rahmenbedingungen der Schweiz (Kleinstaatlichkeit, Pluralität, Geschichte); Bewertung des Einflusses der Schweizer Institutionen auf die Staatstätigkeit; Untersuchung der Erfüllung der Kriterien einer Konkordanzdemokratie im heutigen Kontext; Abschließende Beurteilung der gegenwärtigen Situation der Schweizer Demokratie.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition der Konkordanzdemokratie, Rahmenbedingungen (Kleinstaatlichkeit, Pluralität, Geschichte), Politisches System (Föderalismus, direkte Demokratie), Analyse der Erfüllung der Kriterien einer Konkordanzdemokratie in der Schweiz, und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Was sind die zentralen Rahmenbedingungen der Schweizer Konkordanzdemokratie?
Die zentralen Rahmenbedingungen, die die Entwicklung und den Fortbestand der Konkordanzdemokratie in der Schweiz beeinflusst haben, sind die Kleinstaatlichkeit, die Pluralität der Gesellschaft und die historische Entwicklung mit ihren tiefgreifenden gesellschaftlichen Spaltungen. Diese Faktoren haben die Notwendigkeit von Konsensmechanismen hervorgebracht.
Welche Rolle spielen Föderalismus und direkte Demokratie im Schweizer System?
Föderalismus und direkte Demokratie sind wichtige Elemente des politischen Systems der Schweiz und tragen zum Funktionieren der Konkordanzdemokratie bei. Sie beeinflussen die Entscheidungsfindung und ermöglichen die Einbindung verschiedener Akteure und Interessen.
Welche Kriterien werden zur Beurteilung der Konkordanzdemokratie in der Schweiz herangezogen?
Die Beurteilung basiert auf den Kriterien: tief zerklüftete Gesellschaft; Entscheidungsfindung entgegen der Mehrheitsregel; Vetorechte aller relevanten Bevölkerungsgruppen und deren Einbezug in die Regierung; Proportionalität bei der Besetzung von politischen Ämtern; Einflusssphären jeder Bevölkerungsgruppe in bestimmten Bereichen. Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Kriterien heute noch erfüllt sind.
Wie wird die "Zauberformel" der Schweizer Regierung in der Hausarbeit behandelt?
Die "Zauberformel", die die Zusammensetzung der Schweizer Regierung traditionell bestimmte, wird im Kontext der jüngeren Herausforderungen für das System erwähnt. Der Bruch der "Zauberformel" bei den Wahlen 2003 wird als Beispiel für Veränderungen im Schweizer politischen System diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Konkordanzdemokratie, Verhandlungsdemokratie, Schweiz, Politisches System, Föderalismus, Direkte Demokratie, Machtteilung, Konsens, Kompromiss, Pluralismus, Kleinstaatlichkeit, Vetorechte, Proportionalität, Regierungsbildung, gesellschaftliche Spaltung, Stabilität, „Zauberformel“.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die detaillierten Kapitelzusammenfassungen befinden sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Hausarbeit. Jede Zusammenfassung beschreibt den Inhalt und die zentralen Aussagen des jeweiligen Kapitels.
- Quote paper
- Frederik Böckmann (Author), 2009, Die Schweizer Demokratie - Ende der Konkordanz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144054