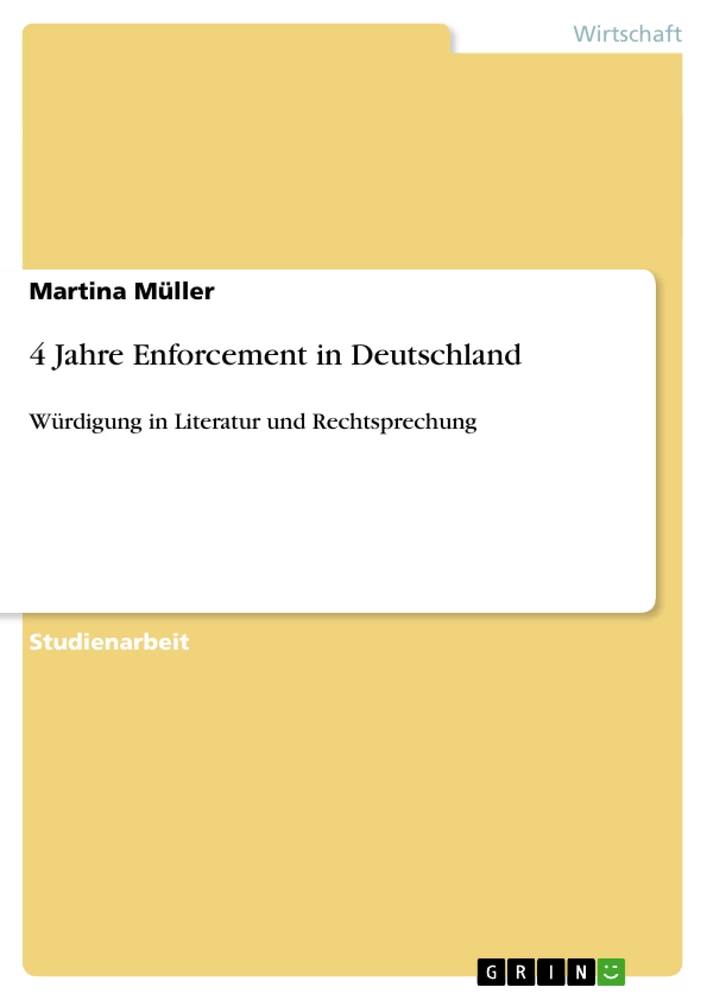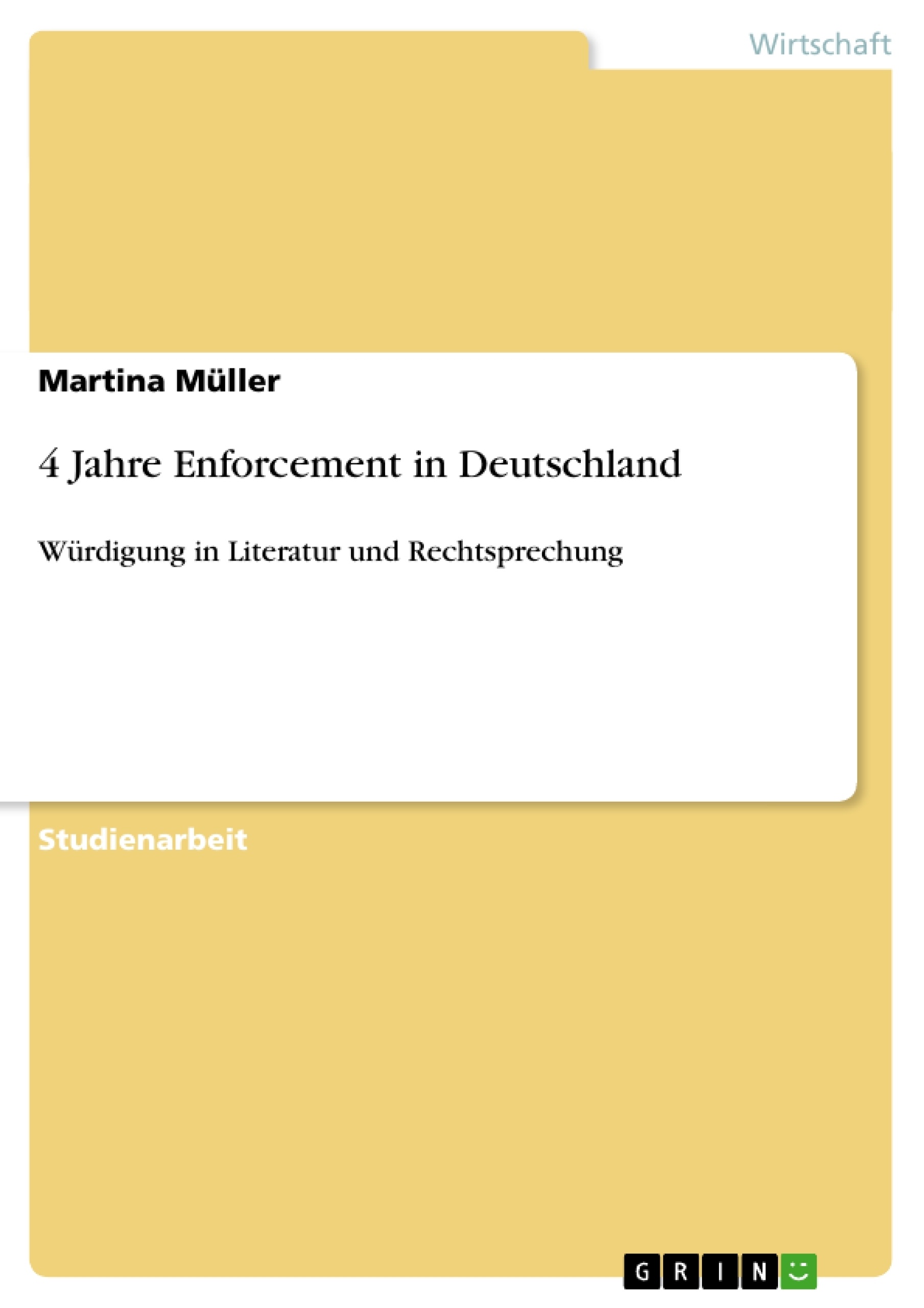Bis 2004 basierte das deutsche System zur Durchsetzung von Rechnungslegungsvorschriften im Wesentlichen auf der Prüfung der Rechnungslegung durch Abschlussprüfer und Aufsichtsrat. Jedoch haben die zahlreichen Bilanzskandale der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass dieses System nicht ausreicht, um das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Finanzberichterstattung zu erhalten und zu stärken. So gibt es aus diesem Grund z.B. in den Vereinigten Staaten bereits eine zusätzliche Überwachung von Unternehmensabschlüssen durch die staatliche Börsenaufsicht, die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). In Großbritannien übernimmt das privatrechtlich organisierte Financial Reporting Review Panel (FRRP) eine ähnliche Funktion. Es hat sich gezeigt, dass in Deutschland ein im internationalen Vergleich bereits üblicher unternehmensexterner Mechanismus zur Überwachung der Rechtmäßigkeit konkreter Unternehmensabschlüsse durch eine unabhängige Stelle fehlte. Vor diesem Hintergrund stellte die Bundesregierung im Jahr 2003 ein Zehn-Punkte-Programm zur Erweiterung der Anlegerrechte und zur Schaffung von mehr Transparenz im Aktienmarkt vor. Punkt 6 sieht hierbei die Einrichtung einer unabhängigen Stelle zur Überwachung der Rechtmäßigkeit konkreter Unternehmensabschlüsse vor und definiert in diesem Rahmen Enforcement als „Überwachung der Rechtmäßigkeit konkreter Unternehmensabschlüsse durch eine außerhalb des Unternehmens stehende, nicht mit dem gesetzlichen Abschlussprüfer (Wirtschaftsprüfer) identische unabhängige Stelle.“ Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einerseits das Enforcement-Verfahren an sich und die beteiligten Behörden und Institute darzustellen, als auch auf die Würdigung dieses verhältnismäßig neuen und weltweit bisher einzigartigen Verfahrens in der Literatur und Rechtsprechung einzugehen. Zu Beginn werden hierfür zunächst die ausführenden Organe und der Ablauf des Verfahrens an sich vorgestellt, um so ein Verständnis für die Grundprinzipien zu schaffen. In Kapitel 3.1 folgt anschließend ein Überblick über verschiedene Reaktionen der Fachliteratur sowie die vorherrschenden Meinungen und Tendenzen, ehe in Kapitel 3.2 ein aktuelles Urteil zur Wesentlichkeit der Fehlerfeststellung und eine Besprechung dieses Urteils erläutert werden. Schließlich wird in Kapitel 3.3 noch ein Artikel besprochen, der insbesondere die Reaktionen des Kapitalmarktes vorstellt und das Thema so aus Sicht der Empirie betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellung des Enforcement-Verfahrens und der beteiligten Institute
- 3. Würdigung in Literatur, Rechtsprechung und Empirie
- 3.1 Literatur
- 3.2 Rechtsprechung
- 3.2.1 Das Urteil
- 3.2.2 Die Reaktionen auf das Urteil
- 3.3 Empirie
- 4 Zusammenfassung und Fazit
- Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsanweisungen und sonstigen Rechnungslegungsnormen
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Verzeichnis der Internetquellen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Enforcement-Verfahren in Deutschland, welches seit 2004 zur Überwachung der Rechtmäßigkeit von Unternehmensabschlüssen eingesetzt wird. Ziel ist es, das Verfahren und die beteiligten Institute zu erläutern und die Würdigung in Literatur, Rechtsprechung und Empirie zu untersuchen.
- Vorstellung des Enforcement-Verfahrens und der beteiligten Institute
- Analyse der Würdigung in der Fachliteratur
- Bewertung aktueller Urteile zur Fehlerfeststellung
- Beobachtungen des Kapitalmarktes im Hinblick auf das Enforcement-Verfahren
- Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Der Autor stellt den Hintergrund des Enforcement-Verfahrens dar und erläutert die Notwendigkeit einer unabhängigen Stelle zur Überwachung der Rechtmäßigkeit von Unternehmensabschlüssen. Das Ziel der Arbeit wird definiert: eine detaillierte Darstellung des Enforcement-Verfahrens und seiner Würdigung in Literatur, Rechtsprechung und Empirie.
- Kapitel 2: Vorstellung des Enforcement-Verfahrens und der beteiligten Institute: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Grundlagen des Enforcement-Verfahrens, die involvierten Institutionen (DPR und BaFin) und den Ablauf des Verfahrens. Die Funktionsweise und die Aufgaben der beteiligten Institute werden erläutert.
- Kapitel 3.1: Literatur: Dieser Abschnitt analysiert die Reaktion der Fachliteratur auf das Enforcement-Verfahren, wobei verschiedene Meinungen und Tendenzen aufgezeigt werden.
- Kapitel 3.2: Rechtsprechung: In diesem Kapitel wird ein aktuelles Urteil zur Wesentlichkeit der Fehlerfeststellung vorgestellt und diskutiert. Die Reaktionen auf dieses Urteil werden ebenfalls beleuchtet.
- Kapitel 3.3: Empirie: Dieser Abschnitt beleuchtet die Reaktionen des Kapitalmarktes auf das Enforcement-Verfahren und bietet eine empirische Perspektive auf das Thema.
Schlüsselwörter
Enforcement, Rechnungslegung, Unternehmensabschlüsse, DPR, BaFin, Rechtsprechung, Literatur, Empirie, Kapitalmarkt, Fehlerfeststellung, Wesentlichkeit, Bilanzskandale, Transparenz, Anlegerrechte, Finanzberichterstattung.
- Quote paper
- Martina Müller (Author), 2010, 4 Jahre Enforcement in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143969