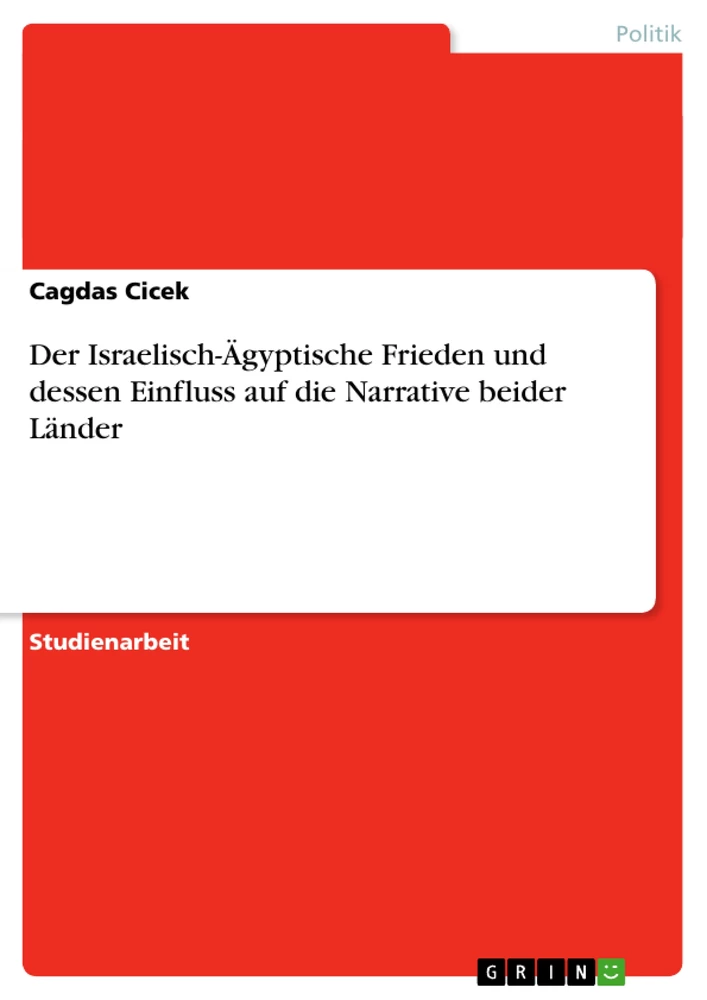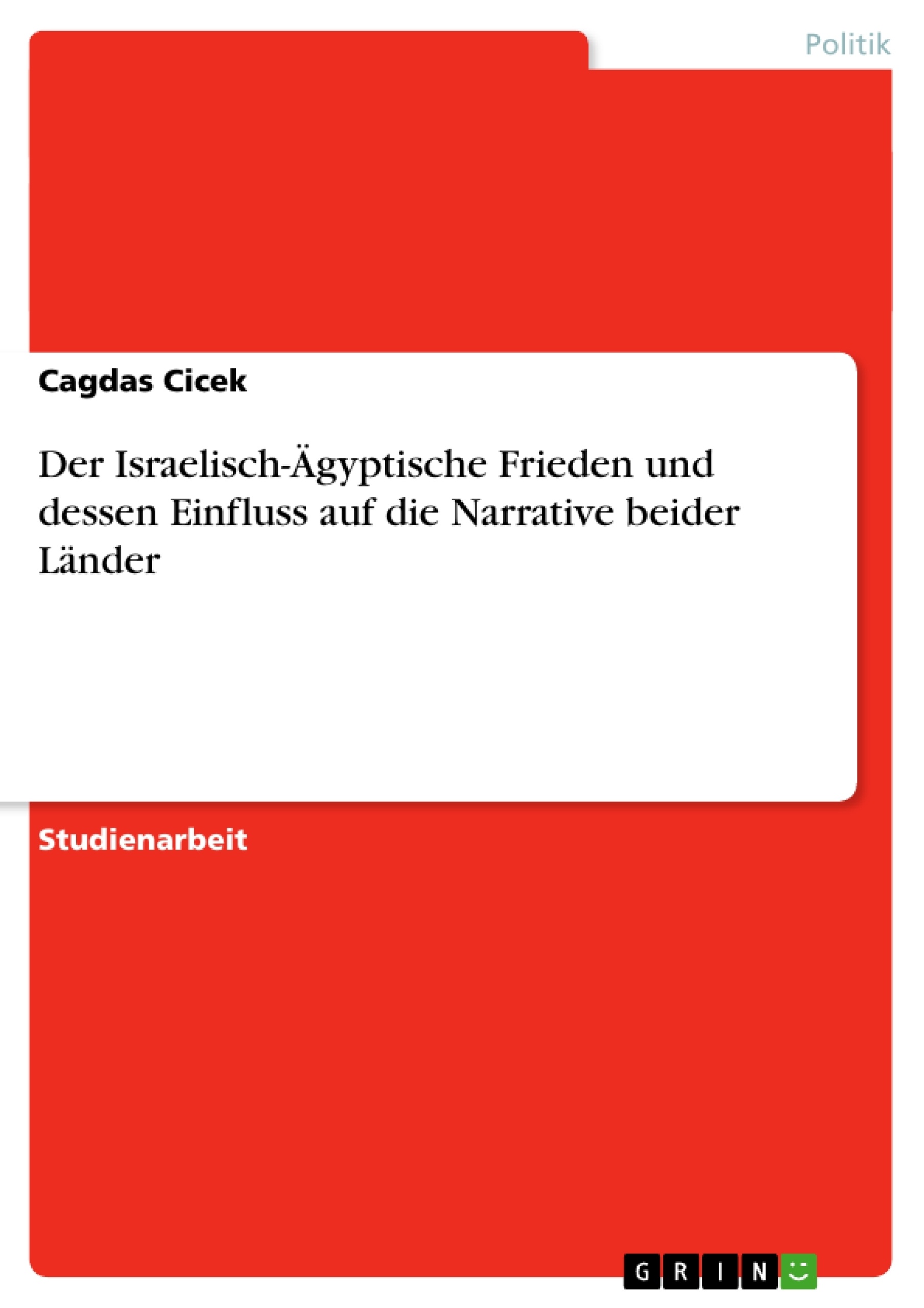Im Jahre 1979, ein paar Tage nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel, flog der israelische Journalist Amos Elon nach Ägypten und schrieb seine Erfahrungen die er hier gemacht hatte nieder. Er schrieb unter anderem darüber, wie er sich zu Beginn seines Besuchs mit einem Kollegen aus dem Hotel in dem sie sich befanden entfernte, was schon aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt war, um in die Innenstadt von Kairo zu gelangen. Im Bus Richtung Zentrum geschah dann etwas Unerwartetes: Sie wurden als Israelis identifiziert und als solche herzlich begrüßt. Es fielen Sätze wie: „Willkommen! Israel sehr gut. Ägypten sehr gut. Frieden sehr gut!“. Einige Tage zuvor hätte man an so einen Dialog zwischen einem Israeli und einem Ägypter in einem Bus in Kairo nicht denken können. Zu festgesetzt war das Bild des Feindes. Ein Feind mit dem man Jahrzehnte keinen Kontakt und keine richtige Kommunikation aufbauen konnte. So kam es dazu, dass man den „Feind“ nur aus den Erzählungen kannte, die in eigenen Kreisen entstanden. Doch mit dem Friedensvertrag von Camp David 1979 hatte sich in beiden Ländern etwas verändert, die Narrative schienen sich von einem Tag auf den anderen zu etwas Neuen zu morphieren. Hier stellt sich die Frage, was sich hier in diesem Prozess genau verändert hat. Um auf ein Ergebnis zu kommen, wäre es sinnvoll die vorliegende Arbeit chronologisch aufzubauen. Ich werde etwas zurückblicken um die Entstehung des Konfliktes und die Narrativen, welche sich zwischen diesen beiden Ländern entwickelt haben, darstellen zu können. Danach mache ich einen Sprung auf die Haupteinflussquelle der Narrativänderungen: Dem Friedensprozess zwischen Ägypten und Israel, welches mit dem Vertrag von Camp David endet. Nun kann ich zu meiner wie bereits oben schon angegebener Fragestellung gelangen und die Veränderungen der gegenseitigen Wahrnehmung des nun „alten“ Feindes in beiden Ländern erörtern und vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Entstehung des Konfliktes und der Narrative
- 1.1 Konflikt
- 1.2 Narrative
- 2. Friedensprozess zwischen Israel und Ägypten
- 2.1 Die Lage in Israel und Ägypten nach dem Jom-Kippur Krieg
- 2.2 Sadat besucht Jerusalem
- 2.3 Friedensgipfel in Camp David
- 3. Änderung der Narrative
- 3.1 Ägyptische Narrative
- 3.2 Israelische Narrative
- Aktuelle Lage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderung der Narrative zwischen Ägypten und Israel vor und nach dem Friedensvertrag von Camp David 1979. Sie analysiert, wie der Friedensprozess die gegenseitige Wahrnehmung der beiden Länder beeinflusst und zu einer neuen, friedlicheren Darstellung des „Feindes“ geführt hat. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Konflikts und die Rolle der Narrative in der Aufrechterhaltung und Überwindung von Feindbildern.
- Entstehung und Entwicklung des israelisch-ägyptischen Konflikts
- Rolle der Narrative in der Konstruktion von Feindbildern
- Der Friedensprozess von Camp David und seine Auswirkungen
- Veränderung der Narrative nach dem Friedensschluss
- Vergleich der ägyptischen und israelischen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die überraschende Erfahrung eines israelischen Journalisten in Ägypten nach dem Friedensvertrag von 1979, der die plötzliche positive Wahrnehmung Israels durch Ägypter illustriert. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Veränderungen der Narrative in beiden Ländern und skizziert den chronologischen Aufbau der Arbeit, der die Entstehung des Konflikts, den Friedensprozess und schließlich die Narrativveränderungen analysiert. Die Einleitung nennt auch wichtige verwendete Literatur.
1. Entstehung des Konfliktes und der Narrative: Dieses Kapitel unterteilt den Begriff "Konflikt" in sozialpsychologische, semantische und soziologische Aspekte. Es konzentriert sich auf den soziologischen Aspekt, der auf Unvereinbarkeit von Zielen, Zwecken oder Werten beruht. Der Beginn des Konflikts wird mit dem Eingreifen Ägyptens im ersten arabisch-israelischen Krieg nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung festgelegt. Das Kapitel beleuchtet die territorialen Ansprüche beider Seiten als Hauptkonfliktursache. Im Unterkapitel 1.2 werden Narrative als kulturelle Erzählungen über vergangene Ereignisse definiert, die nicht immer übereinstimmen müssen, wie am Beispiel des unterschiedlichen Erinnerns an das Kriegsende 1948 (Unabhängigkeitstag vs. Nakba) gezeigt wird. Die Bedeutung von Narrativen für die historische Forschung wird hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven im israelisch-ägyptischen Konflikt.
2. Der Friedensprozess zwischen Israel und Ägypten: Dieses Kapitel analysiert den Friedensprozess im Kontext des Yom-Kippur-Krieges von 1973. Es beschreibt die Erkenntnis nach dem Krieg, dass Gewalt den Konflikt nicht lösen kann, und hebt den Verlust des Unbesiegbarkeitsmythos der israelischen Armee hervor. Der Besuch Sadats in Jerusalem und der Friedensgipfel in Camp David werden als zentrale Ereignisse im Friedensprozess dargestellt. Es wird gezeigt, wie ein anderer Weg als Krieg eingeschlagen werden musste, nachdem beide Seiten die Grenzen der militärischen Lösung erkannten.
Schlüsselwörter
Israelisch-Ägyptischer Konflikt, Narrative, Friedensprozess Camp David, Jom-Kippur-Krieg, Feindbilder, geschichtliches Narrativ, israelische und ägyptische Wahrnehmung, Veränderung der Perspektive, interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Narrativveränderung im israelisch-ägyptischen Konflikt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Veränderung der Narrative zwischen Ägypten und Israel vor und nach dem Friedensvertrag von Camp David 1979. Der Fokus liegt darauf, wie der Friedensprozess die gegenseitige Wahrnehmung und die Darstellung des „Feindes“ beeinflusst hat.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung des israelisch-ägyptischen Konflikts, die Rolle von Narrativen bei der Konstruktion von Feindbildern, den Friedensprozess von Camp David und dessen Auswirkungen, die Veränderung der Narrative nach dem Friedensschluss sowie einen Vergleich der ägyptischen und israelischen Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Entstehung des Konflikts und der Narrative, Friedensprozess zwischen Israel und Ägypten, Änderung der Narrative und die aktuelle Lage. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel weiter unterteilt. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit. Die Kapitel behandeln den historischen Kontext, den Friedensprozess und die Analyse der Narrativveränderungen.
Was versteht die Arbeit unter „Narrativen“?
Narrative werden als kulturelle Erzählungen über vergangene Ereignisse definiert, die nicht immer übereinstimmen müssen. Das Beispiel des unterschiedlichen Erinnerns an das Kriegsende 1948 (Unabhängigkeitstag vs. Nakba) verdeutlicht diese Diskrepanz. Die Bedeutung von Narrativen für die historische Forschung und den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven im israelisch-ägyptischen Konflikt wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt der Jom-Kippur-Krieg?
Der Jom-Kippur-Krieg von 1973 wird als Wendepunkt dargestellt, der die Erkenntnis brachte, dass Gewalt den Konflikt nicht lösen kann. Er führte zum Verlust des Unbesiegbarkeitsmythos der israelischen Armee und ebnete den Weg für den Friedensprozess.
Welche Bedeutung hat der Besuch Sadats in Jerusalem und der Camp David Gipfel?
Der Besuch Sadats in Jerusalem und der Friedensgipfel in Camp David werden als zentrale Ereignisse im Friedensprozess dargestellt, die einen anderen Weg als Krieg einschlugen, nachdem beide Seiten die Grenzen der militärischen Lösung erkannten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Israelisch-Ägyptischer Konflikt, Narrative, Friedensprozess Camp David, Jom-Kippur-Krieg, Feindbilder, geschichtliches Narrativ, israelische und ägyptische Wahrnehmung, Veränderung der Perspektive, interkulturelle Kommunikation.
Wie wird die Veränderung der Narrative analysiert?
Die Arbeit analysiert die Veränderung der Narrative durch den Vergleich der ägyptischen und israelischen Perspektiven vor und nach dem Friedensschluss. Sie untersucht, wie die Wahrnehmung des jeweils anderen Landes durch den Friedensprozess beeinflusst wurde und zu einer neuen, friedlicheren Darstellung des „Feindes“ führte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Einleitung nennt wichtige verwendete Literatur, die jedoch im gegebenen Auszug nicht detailliert aufgeführt ist.
- Quote paper
- Cagdas Cicek (Author), 2009, Der Israelisch-Ägyptische Frieden und dessen Einfluss auf die Narrative beider Länder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143928