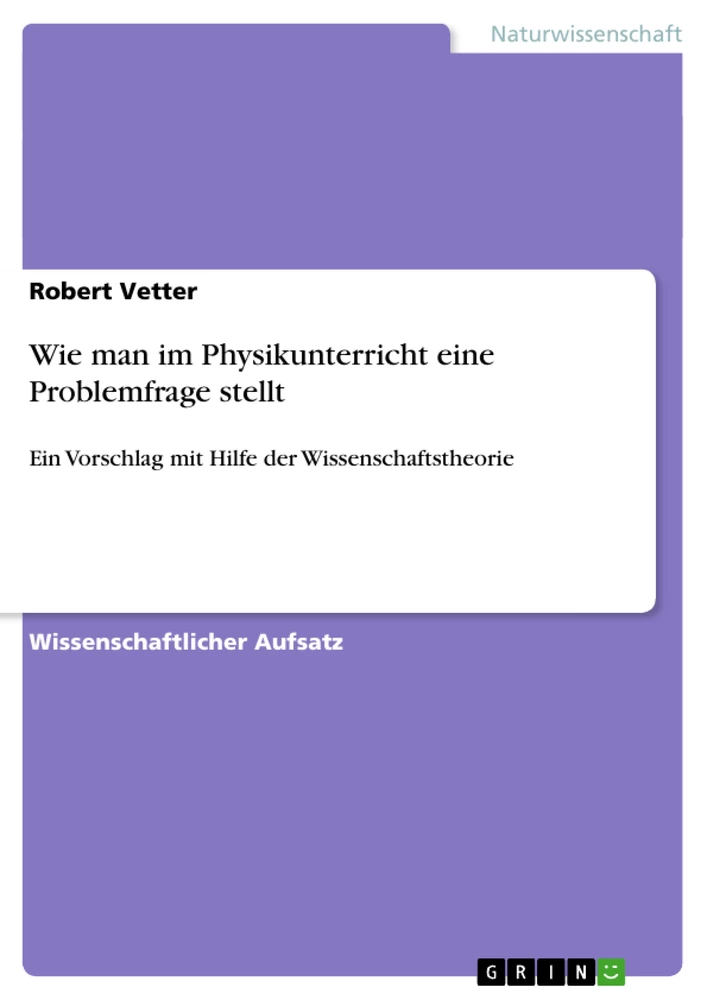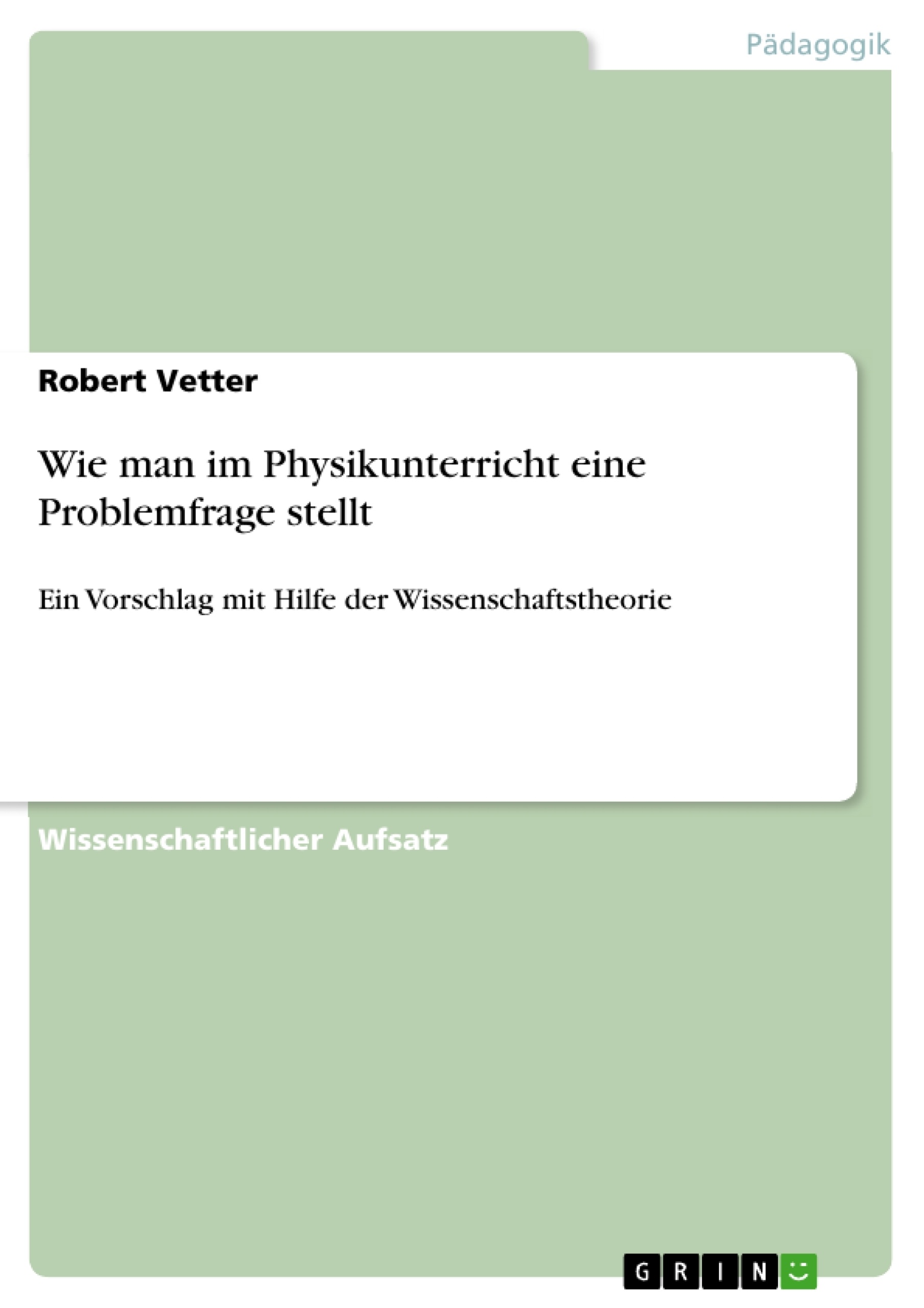Eines der (allgemeinsten) Probleme der Physik ist die Erklärung physikalischer Sachverhalte. Problemorientierter Physikunterricht ist danach Unterricht, der lehrt, wie physikalische Sachverhalte erklärt werden, und die speziellen Probleme, die sich stellen, sind Erklärungsaufgaben.
Ein wesentlicher Aspekt für das Gelingen der lernfördernden Entfaltung des Problems im Physikunterricht ist dabei die richtige Formulierung der Problemfrage. An die Problemfrage werden dabei unterschiedlichste Forderungen gestellt. So muss sie sinnvoll, klar und präzise sein, möglichst eindeutig, für die Schüler motivierend sein und keine negativen Reaktionen hervorrufen, und innerhalb einer gegebenen Zeit, häufig nur
einer Schulstunde, durch eine sehr begrenzte Zahl möglicher Antworten knapp beantwortbar sein. Darüber hinaus wird häufig gefordert, dass sich die Problemfrage den Schülern von
selbst stellt, der Lehrer sie also nicht vorgeben darf und soll.
In dieser Arbeit wird bestimmt werden, wie eine Problemfrage im Physikunterricht gestellt werden kann. Dazu wird die logische Form der Erklärung physikalischer Sachverhalte (D-N-Modell/H-O-Schema) und das Problem der Asymmetrie erörtert. Anschließend werden Warum-Fragen und das Problem ihrer Mehrdeutigkeit thematisiert. Schließlich wird das Problem der Irrelevanz von Bestandteilen der Erklärung erörtert und der Übergang zu Welch-Fragen gerechtfertigt. Zuletzt wird die Berücksichtigung der Kausalität für die Stellung der Problemfrage problematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Die Stellung der Problemfrage im problemorientierten Physikunterricht
- Die Problemfrage als Frage nach physikalischen Erklärungen
- Die Problemfrage als Warum-Frage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die optimale Formulierung von Problemfragen im problemorientierten Physikunterricht unter Einbezug wissenschaftstheoretischer Erkenntnisse. Ziel ist es, Vorschläge zu erarbeiten, wie Problemfragen so gestellt werden können, dass sie die Kriterien von Sinnhaftigkeit, Klarheit, Präzision und Lernförderlichkeit erfüllen.
- Problemorientierter Physikunterricht und seine methodischen Aspekte
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Problemfrageformulierung
- Das Hempel-Oppenheim-Schema und physikalische Erklärungen
- Die Problemfrage als Warum-Frage und ihre Voraussetzungen
- Kriterien für die Formulierung effektiver Problemfragen im Physikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Stellung der Problemfrage im problemorientierten Physikunterricht: Der Text beschreibt problemorientierten Physikunterricht als eine didaktische Methode, die sich am wissenschaftlichen Vorgehen orientiert. Es werden zwei zentrale Fragen beleuchtet: Erstens, welche typischen Probleme in der Physik existieren und wie sie angegangen werden. Zweitens, welche Unterrichtsform die lernförderliche Entfaltung physikalischer Probleme ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Erklärung physikalischer Sachverhalte als zentrales Problem und die Bedeutung der richtigen Problemfrageformulierung für den Lernerfolg wird hervorgehoben. Die richtige Formulierung der Problemfrage wird als essentielle Heuristik für die selbstständige Problemlösung der Schüler dargestellt, wobei Kriterien wie Sinnhaftigkeit, Klarheit, Präzision und motivierende Formulierung im Fokus stehen.
Die Problemfrage als Frage nach physikalischen Erklärungen: Dieses Kapitel erörtert die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken als Voraussetzung für das Verstehen physikalischer Erklärungen. Es wird auf Studien verwiesen, die die Fähigkeit von Schülern zum wissenschaftlichen Denken belegen, selbst im Grundschulalter. Die Problemfrage wird als eine Frage nach der Erklärung physikalischer Sachverhalte definiert, wobei die Antwort das zu erwerbende Wissen enthält. Der Text beschreibt das Hempel-Oppenheim-Schema (D-N-Modell) als Grundlage physikalischer Erklärungen, bestehend aus allgemeinen Gesetzmäßigkeiten (Explanans) und Antezedenzbedingungen, die das Explanandum (der zu erklärende Sachverhalt) erklären. Die Wichtigkeit der Demonstration und Benennung des Explanandums vor der Formulierung der Problemfrage wird unterstrichen, sowie die Notwendigkeit, sowohl das Explanandum als auch die Antezedenzbedingungen präzise zu benennen, insbesondere bei quantitativen Zusammenhängen. Das Kapitel veranschaulicht die Bedeutung genauer Definitionen für die erfolgreiche Problemlösung.
Die Problemfrage als Warum-Frage: Der Abschnitt identifiziert Warum-Fragen als die typische Form der Problemfrage im Kontext physikalischer Erklärungen. Es wird erläutert, dass Warum-Fragen eine innere Ob-Frage beinhalten, die bejaht werden können muss, damit die Warum-Frage sinnvoll ist. Die Antwort auf die innere Ob-Frage enthält den zu erklärenden Sachverhalt (Explanandum), während die Antwort auf die Warum-Frage das Explanans (allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Antezedenzbedingungen) liefert. Die Diskussion von Problemen mit dem D-N-Modell und Warum-Fragen wird angedeutet, ohne jedoch explizit auf diese einzugehen.
Schlüsselwörter
Problemorientierter Physikunterricht, Problemfrage, Wissenschaftstheorie, Hempel-Oppenheim-Schema, Erklärung, Warum-Frage, wissenschaftliches Denken, physikalische Gesetzmäßigkeiten, Antezedenzbedingungen, Explanandum, Explanans.
Häufig gestellte Fragen zu: Optimale Formulierung von Problemfragen im problemorientierten Physikunterricht
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich mit der optimalen Formulierung von Problemfragen im problemorientierten Physikunterricht. Er untersucht, wie Problemfragen so gestellt werden können, dass sie sinnhaft, klar, präzise und lernförderlich sind, und bezieht dabei wissenschaftstheoretische Erkenntnisse mit ein.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: problemorientierter Physikunterricht und seine methodischen Aspekte, wissenschaftstheoretische Grundlagen der Problemfrageformulierung, das Hempel-Oppenheim-Schema und physikalische Erklärungen, die Problemfrage als Warum-Frage und ihre Voraussetzungen sowie Kriterien für die Formulierung effektiver Problemfragen im Physikunterricht.
Was versteht der Text unter problemorientiertem Physikunterricht?
Problemorientierter Physikunterricht wird als eine didaktische Methode beschrieben, die sich am wissenschaftlichen Vorgehen orientiert. Im Mittelpunkt steht die wissenschaftliche Erklärung physikalischer Sachverhalte und die Bedeutung der richtigen Problemfrageformulierung für den Lernerfolg. Die richtige Formulierung der Problemfrage wird als essentielle Heuristik für die selbstständige Problemlösung der Schüler dargestellt.
Welche Rolle spielt die Problemfrage im problemorientierten Physikunterricht?
Die Problemfrage ist zentral für den problemorientierten Physikunterricht. Sie dient als Ausgangspunkt für die selbstständige Auseinandersetzung der Schüler mit physikalischen Problemen. Eine gut formulierte Problemfrage ist präzise, klar, motivierend und fördert den Lernprozess.
Wie wird die Problemfrage im Text definiert?
Die Problemfrage wird als Frage nach der Erklärung physikalischer Sachverhalte definiert. Die Antwort auf diese Frage enthält das zu erwerbende Wissen. Im Kontext physikalischer Erklärungen wird sie oft als Warum-Frage formuliert.
Welche Bedeutung hat das Hempel-Oppenheim-Schema (D-N-Modell)?
Das Hempel-Oppenheim-Schema (D-N-Modell) dient als Grundlage für physikalische Erklärungen. Es besteht aus allgemeinen Gesetzmäßigkeiten (Explanans) und Antezedenzbedingungen, die das Explanandum (den zu erklärenden Sachverhalt) erklären. Der Text betont die Wichtigkeit, sowohl das Explanandum als auch die Antezedenzbedingungen präzise zu benennen.
Was ist die Bedeutung der „Warum-Frage“ im Kontext des Textes?
Warum-Fragen werden als typische Form der Problemfrage im Kontext physikalischer Erklärungen identifiziert. Sie beinhalten eine innere Ob-Frage, die bejaht werden muss, damit die Warum-Frage sinnvoll ist. Die Antwort auf die innere Ob-Frage enthält das Explanandum, während die Antwort auf die Warum-Frage das Explanans liefert.
Welche Kriterien sollten bei der Formulierung effektiver Problemfragen beachtet werden?
Die Kriterien für effektive Problemfragen sind Sinnhaftigkeit, Klarheit, Präzision und Lernförderlichkeit. Die Problemfrage sollte so formuliert sein, dass sie die Schüler motiviert und zum selbstständigen Denken anregt.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Problemorientierter Physikunterricht, Problemfrage, Wissenschaftstheorie, Hempel-Oppenheim-Schema, Erklärung, Warum-Frage, wissenschaftliches Denken, physikalische Gesetzmäßigkeiten, Antezedenzbedingungen, Explanandum, Explanans.
- Arbeit zitieren
- Robert Vetter (Autor:in), 2007, Wie man im Physikunterricht eine Problemfrage stellt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143926