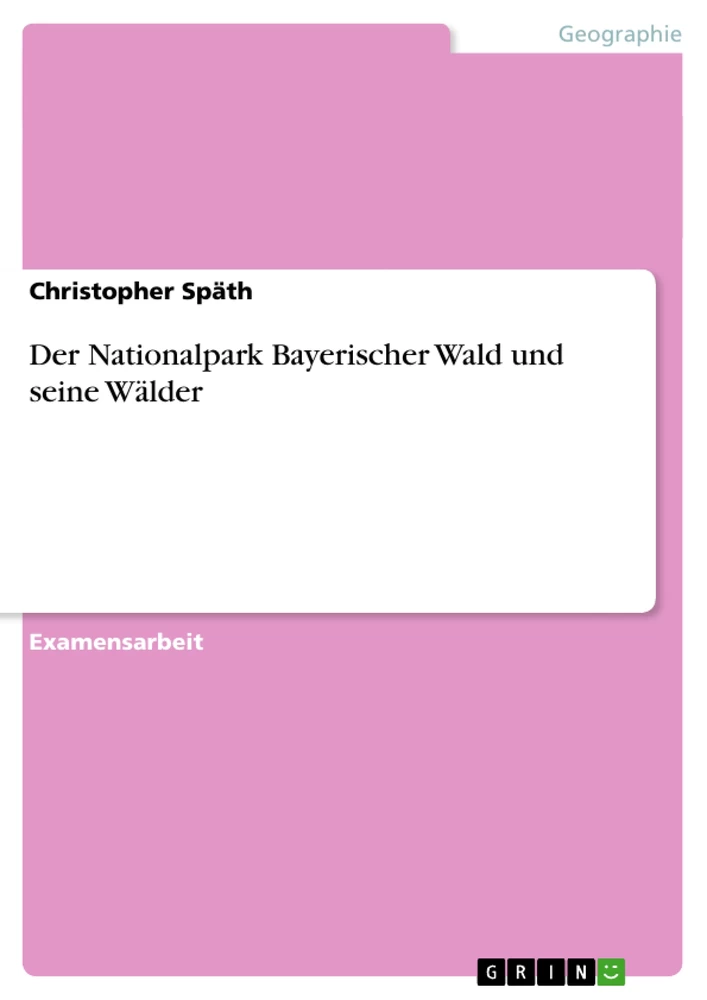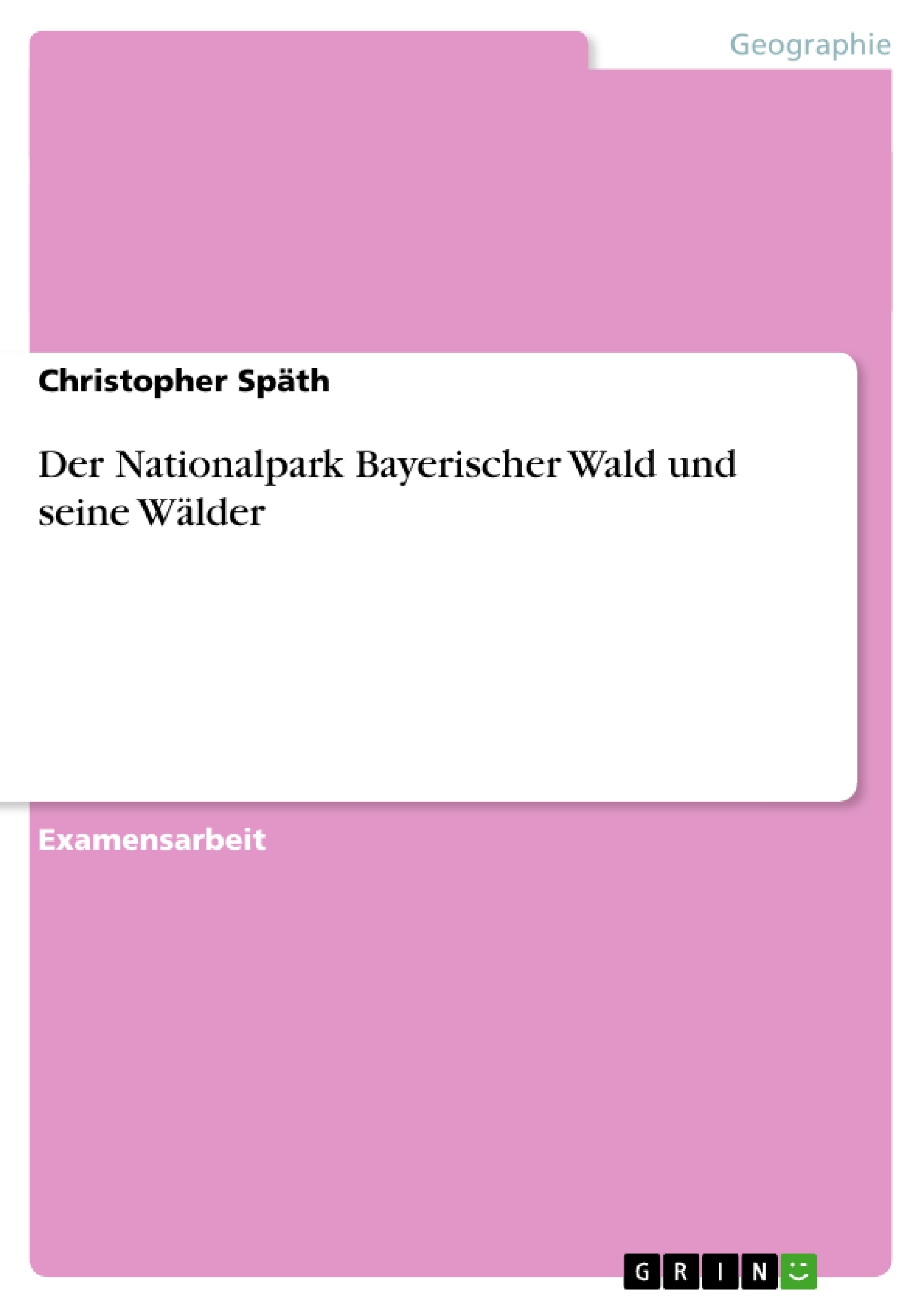Der Nationalpark Bayerischer Wald war bei seiner Gründung 1969 der erste Nationalpark in Deutschland. Obwohl die Nationalparkidee in den USA bereits seit der Gründung des Yellowstone-Nationalparks im Jahr 1872 bekannt ist, dauerte es nahezu hundert Jahre, bis auch in Deutschland eine Landschaft diesen Status erlangte. Im Gegensatz zu den weitläufigen, dünn besiedelten und vom Manschen nahezu ungenutzten Landschaften in den USA herrschten für die Region Bayerischer Wald jedoch gänzlich andere Voraussetzungen.
Der Bayerische Wald war seit dem Mittelalter besiedelt, der Wald blieb je-doch zunächst, von einigen Rodungsinseln abgesehen, von einer intensiven Nutzung verschont. Bedeutend war die Region vor allem für die über seine Bergrücken verlaufenden Salzhandelsrouten nach Böhmen und die sich seit dem Mittelalter betriebenen Glashütten, die hier beste Bedingungen, ein unerschöpflich erscheinender Reichtum an Holz und Quarz, vorfanden. Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert setzte eine intensive Nutzung der Holzbestände ein und damit die planmäßige Umwandlung der urwüchsigen Bestände in Wirtschaftswälder. Der Beginn des Kalten Krieges bedeutete für die Region eine Zäsur. Die zentrale Lage verwandelte sich in eine Randlage und die kunsthandwerkliche Glasindustrie verlor zunehmend an Bedeutung, sodass sich die Region zum „Armenhaus“ Deutschlands entwickelte. Neue Einnahmequellen mussten erschlossen werden. Der Gründung des Nationalparks gingen jedoch nicht in erster Linie ökonomische Überlegungen voraus. Im Fokus stand von Beginn der Überlegungen an der Naturschutz, denn die zu großen Teilen noch intakten urwüchsigen Hochlagenwälder des Bayerischen Waldes waren in dieser Form und Ausdehnung einmalig in Deutschland und besaßen daher einen schützenswerten Charakter, der schon Mittel des 19. Jahrhunderts erkannt wurde...
In folgender Arbeit soll nach einer physisch geographischen Beschreibung der Region auf die Geschichte der Nationalparkregion und die seiner Wälder eingegangen werden. Desweiteren werden Ursachen und Wirkung von dem Wald schadenden Einflüssen (atmosphärische Schadstoffe, Insekten und Stürme) erläutert und ihr Zusammenhang aufgezeigt. Abschließend wird noch auf die zahlreichen Exkursionsmöglichkeiten im Nationalparkgebiet, vor allem auf die Angebote, die sich an Schulklassen richten, eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Naturräumliche Ausstattung
- Lage
- Geologie
- Geomorphologie
- Glaziale Formen
- Fluviale Formen
- Hydrologische Formen
- Verwitterungsformen
- Böden und deren Verbreitung
- Fels- und Blockböden
- Sand- und Lehmböden
- Nassböden
- Gewässer
- Klima
- Der Nationalpark und seine Wälder
- Waldgeschichte bis zur Nationalparkgründung
- vegetationsgeschichtlicher Abriss
- Aktuelle Höhenstufen und Zonierung
- Anthropogene Einflüsse und deren Auswirkungen
- Siedlungsgeschichte
- Glashütten und deren Auswirkungen auf den Waldzustand
- Techniken zur Walderschließung und forstwissenschaftliche Besonderheiten
- Winterzug
- Trift
- Waldbahn
- Schachten
- Waldbauliche Verfahren
- Naturkatastrophen und politische Zwangssituationen
- Entstehung, Philosophie und Struktur des Nationalparks, Akzeptanz in der Bevölkerung und geographische Forschungsbereiche
- Entwicklung des Schutzgedankens in Deutschland
- Erste Anfänge im Bayerischen Wald
- Politische Debatten und Entscheidungen
- Leitbild und Ziele des Nationalparks
- Leitbild
- Ziele
- Managementzonen
- Akzeptanz des Nationalparks in der örtlichen Bevölkerung
- Geographische Forschungsbereiche
- Waldschäden seit Gründung des Nationalparks
- Luftschadstoffmonitoring im Bayerischen Wald
- Ozoneinträge
- Schwefeldioxideinträge
- Stickoxideinträge
- Bewertung und Ausblick
- Insekten (Borkenkäfer)
- Biologie des Buchdruckers
- Buchdruckerrelevante Klimakennwerte
- Auswahl der Wirtsbäume
- Aktionsradius
- Vermehrung
- Befallsentwicklung im Nationalpark
- Borkenkäferproblematik aus Sicht des Nationalparkgedankens
- Luftbildauswertung
- Methodik
- Ergebnisse
- Auswirkungen des Borkenkäferbefalls auf Abfluss und Wasserqualität
- Forschungsprojekte
- Abflussspende und Verdunstung
- Stickstoffeintrag und Nitratkonzentrationen
- Exkurs: Stickstoffhaushalt eines Bergfichtenwaldes
- Veränderungen im Stoffhaushalt nach dem Absterben des Bestandes
- Waldentwicklung nach Borkenkäferbefall
- Entwicklung der durchschnittlichen Pflanzenzahlen, der Baumartenanteile und der Höhenstruktur
- Die Verjüngungsentwicklung beeinflussende Faktoren
- Stürme und Windwürfe
- Biologie des Buchdruckers
- Exkursionsmöglichkeiten
- Bildungsmöglichkeiten im Nationalpark-/Naturparkgebiet
- Naturpark Informationshaus Zwiesel
- Besucherzentrum Hans-Eisenmann-Haus Neuschönau
- Haus der Wildnis Ludwigsthal
- Wildniscamp am Falkenstein
- Schulklassenprogramme der Nationalparkverwaltung
- Bildungsmöglichkeiten im Nationalpark-/Naturparkgebiet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zulassungsarbeit befasst sich mit dem Nationalpark Bayerischer Wald und seinen Wäldern. Ziel ist es, die naturräumliche Ausstattung, die Waldgeschichte und die Entwicklung des Nationalparks im Kontext der Waldschäden, insbesondere durch Borkenkäferbefall, zu beleuchten.
- Naturräumliche Ausstattung des Bayerischen Waldes
- Waldgeschichte und anthropogene Einflüsse im Bayerischen Wald
- Entstehung, Philosophie und Struktur des Nationalparks Bayerischer Wald
- Waldschäden durch Borkenkäferbefall und deren Auswirkungen auf die Ökologie
- Exkursionsmöglichkeiten und Bildungsangebote im Nationalpark
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Beschreibung der naturräumlichen Ausstattung des Bayerischen Waldes, die die Lage, Geologie, Geomorphologie, Böden, Gewässer und das Klima umfasst. Anschließend wird die Waldgeschichte bis zur Nationalparkgründung beleuchtet, wobei die anthropogenen Einflüsse wie Siedlungsgeschichte, Glashütten und forstwissenschaftliche Besonderheiten sowie Naturkatastrophen und politische Zwangssituationen eine wichtige Rolle spielen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Entstehung, Philosophie und Struktur des Nationalparks Bayerischer Wald, einschließlich der politischen Debatten und Entscheidungen, des Leitbildes und der Ziele, der Managementzonen und der Akzeptanz des Nationalparks in der Bevölkerung. Es werden auch die geographischen Forschungsbereiche im Nationalpark vorgestellt.
Das vierte Kapitel untersucht die Waldschäden seit Gründung des Nationalparks, mit einem Schwerpunkt auf dem Borkenkäferbefall. Die Auswirkungen des Befalls auf die Ökologie, insbesondere auf Abfluss und Wasserqualität, sowie die Waldentwicklung nach dem Befall werden detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Nationalpark Bayerischer Wald, Waldgeschichte, Borkenkäferbefall, Luftschadstoffmonitoring, Ökologie, Managementzonen, Akzeptanz, Bildungsmöglichkeiten.
- Luftschadstoffmonitoring im Bayerischen Wald
- Waldgeschichte bis zur Nationalparkgründung
- Quote paper
- Christopher Späth (Author), 2009, Der Nationalpark Bayerischer Wald und seine Wälder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143805