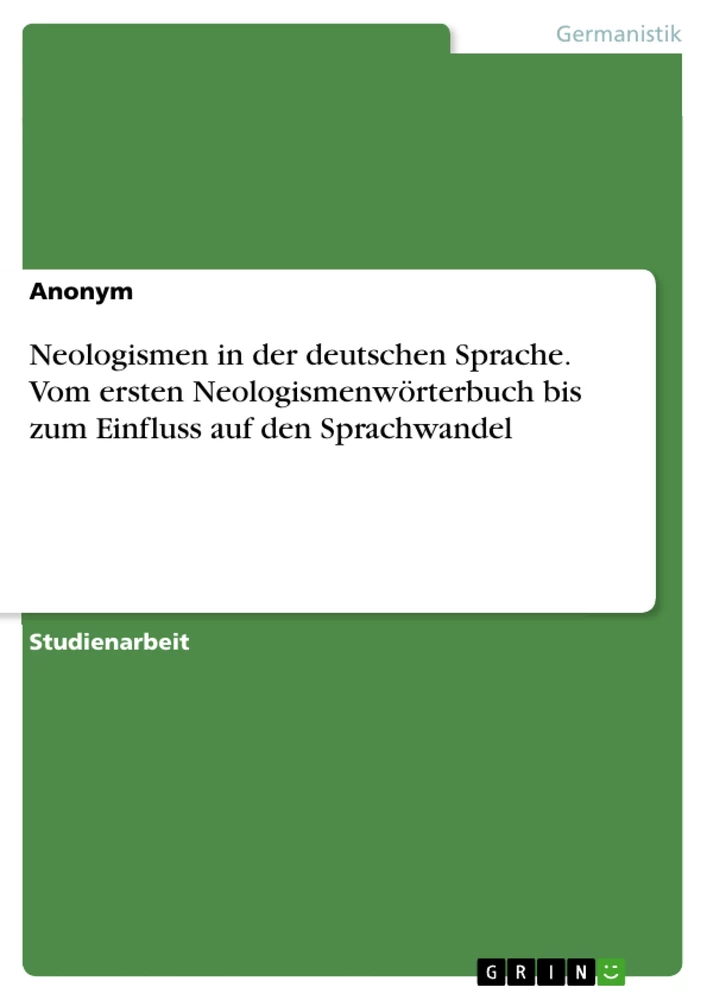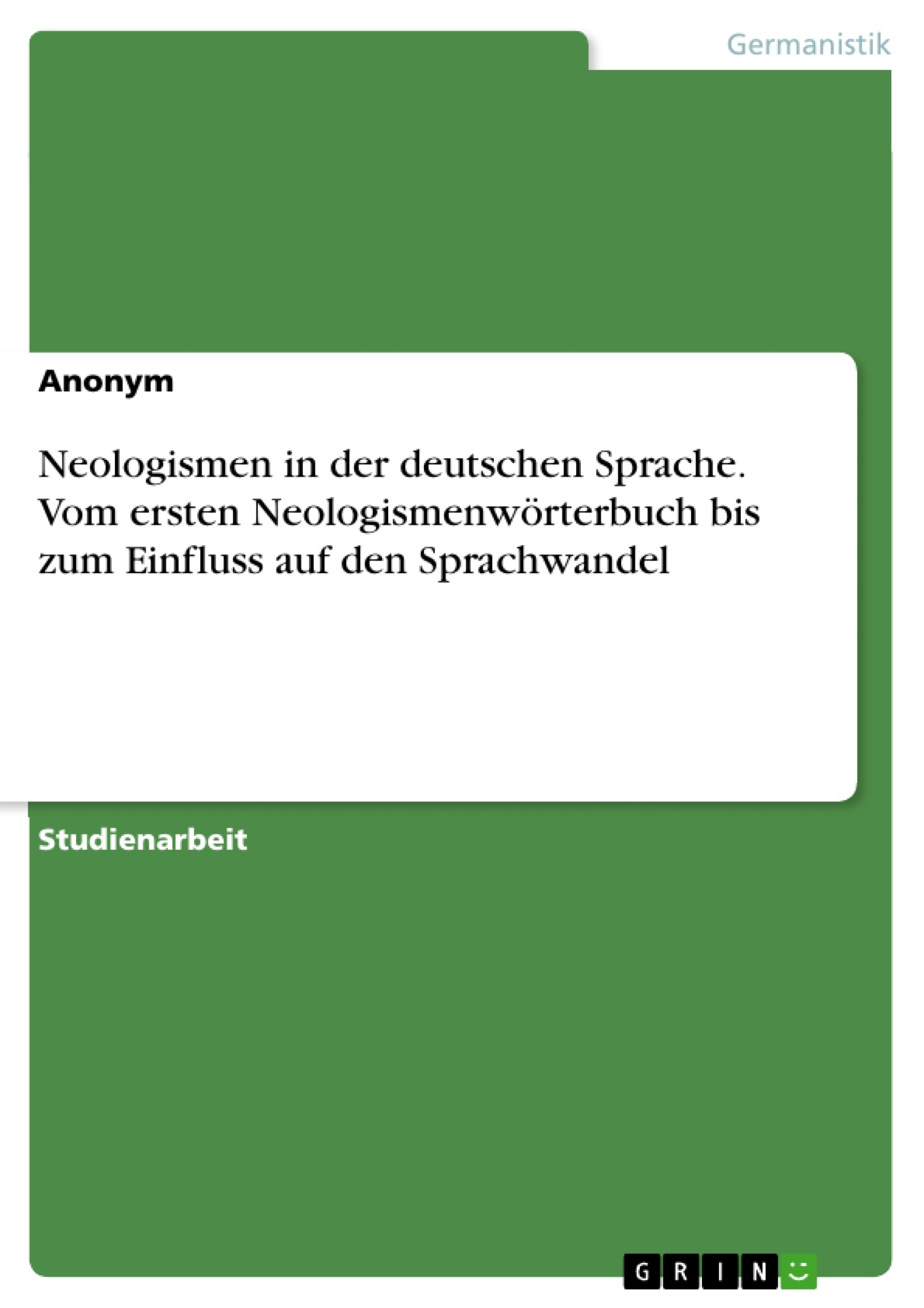Diese Arbeit behandelt Neologismen in der deutschen Sprache. Zu Beginn wird der Weg zum ersten deutschen Neologismenwörterbuch untersucht, welcher mit einer Definition des Begriffs des Neologismus beginnt. Anschließend wird die Ausgangslage für das Pilotprojekt erstes deutsches Neologismenwörterbuch beleuchtet, sowie der zeitliche Erfassungsraum und die selektiven Kriterien für potenzielle Kandidaten dargelegt und besprochen. Darauf folgt dann ein Bericht über das Ergebnis des Selektionsprozesses, sowie eine Erklärung über die von der IDS genutzten Materialien, welche für dieses Projekt vonnöten waren.
Wörterbücher sind allgegenwärtig. Keine Disziplin kommt ohne die Hilfe von ihnen aus, sei sie noch so verzweigt.
Prominente Beispielbereiche wären z.B. Religion, Bildungswesen, Politik, Wirtschaft und natürlich auch die Linguistik.
Die sog. Lexikografie ist eine sehr vielschichtige Disziplin, die ihre Spuren zu allen Zeiten dieser Erde in der Geschichte hinterlassen hat. Speziell Neologismen bzw. sog. "Wortneuschöpfungen" nehmen dabei eine zentrale Rolle ein.
Das sprachliche Phänomen Neologismus ist schon seit längerer Zeit ein Punkt, welcher im Interesse der Öffentlichkeit liegt und laut vielen Menschen ein Werkzeug ist, um die deutsche Sprache zu bereichern. Aus diesem Grund erfreuen sich Nachschlagewerke, welche sich ausschließlich mit dem Thema Neologismen beschäftigen, äußerster Beliebtheit, da diese fruchtbaren Nährboden für die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen bereitstellen und darüber hinaus auch für fachfremde Individuen zumindest als Unterhaltungsmedium verwendet werden können. Lexikografische Werke dieser Art bieten der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich gezielt über Neologismen zu informieren und ggf. einen vergangenen Sprachwandel nachzuvollziehen. Was ein Neologismus mit Sprachwandel zu tun hat, wird im Laufe dieser Arbeit aufgelöst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg zum deutschen Neologismuswörterbuch
- Was ist ein Neologismus?
- Die Ausgangslage für das erste deutsche Neologismenwörterbuch
- Der Erfassungszeitraum
- Der Auswahlprozess für geeignete Kandidaten
- Das Ergebnis der Selektion
- Welche Materialien wurden ausgewertet?/Materialbasis
- Von der Internetversion zur Printversion und wieder zurück
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Entstehungsprozess des ersten deutschen Neologismenwörterbuchs des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) und dessen Online-Variante. Die Zielsetzung ist es, den Weg von der Konzeption bis zur digitalen Bereitstellung nachzuvollziehen und die dabei getroffenen Entscheidungen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Neologismus"
- Die Ausgangslage und die Notwendigkeit eines deutschen Neologismenwörterbuchs
- Der Auswahlprozess und die Kriterien für die Aufnahme von Neologismen
- Die Entwicklung vom Print- zum Online-Wörterbuch
- Die Rolle des IDS in der Neologismenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lexikographie und der Bedeutung von Wörterbüchern in verschiedenen Disziplinen ein. Sie hebt die Relevanz von Neologismen hervor und kündigt den Fokus der Arbeit auf den Werdegang des ersten deutschen Neologismenwörterbuchs des IDS an. Die Einleitung betont das wachsende öffentliche Interesse an Neologismen und deren Bedeutung für das Verständnis von Sprachwandel. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der den Weg vom Konzept des Wörterbuchs bis zu dessen Online-Version nachzeichnet.
Der Weg zum deutschen Neologismuswörterbuch: Dieses Kapitel behandelt ausführlich die Entstehung des ersten deutschen Neologismenwörterbuchs. Es beginnt mit einer Definition des Begriffs "Neologismus" und differenziert zwischen neuen lexikalischen Einheiten und neuen Bedeutungen bereits bestehender Wörter. Es analysiert die Ausgangssituation, die Notwendigkeit eines solchen Wörterbuchs im Vergleich zu anderen Sprachen und beleuchtet die Auswahlkriterien für die Aufnahme von Neologismen. Der Abschnitt beschreibt den Selektionsprozess und die verwendeten Materialien, die der Erstellung des Wörterbuchs zugrunde lagen. Die Diskussion umfasst historische und relative Gebundenheit von Neologismen und den Übergang von Okkasionalismus zu Neologismus.
Von der Internetversion zur Printversion und wieder zurück: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang des Neologismenwörterbuchs von der Print- zur Online-Version und zurück. Es beleuchtet die Herausforderungen und Vorteile beider Formate, und analysiert den Einfluss dieser medialen Transformation auf die Zugänglichkeit und Nutzung des Wörterbuchs. Es wird die Bedeutung einer digitalisierten Version für die Forschung und die Öffentlichkeit beleuchtet. Die Kapitel untersucht wie die Adaptionen an die digitalen Medien die Präsentation und Forschung beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Neologismen, Lexikographie, Deutsches Neologismenwörterbuch, IDS, Sprachwandel, Wortbildung, Online-Wörterbuch, Printwörterbuch, Sprachforschung, Okkasionalismus, Lexikalisierung.
Häufig gestellte Fragen zum Deutschen Neologismenwörterbuch des IDS
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Entstehungsprozess des ersten deutschen Neologismenwörterbuchs des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) und dessen Online-Variante. Sie verfolgt den Weg von der Konzeption bis zur digitalen Bereitstellung und beleuchtet die dabei getroffenen Entscheidungen.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Begriffs "Neologismus", die Notwendigkeit eines deutschen Neologismenwörterbuchs, den Auswahlprozess und die Kriterien für die Aufnahme von Neologismen, die Entwicklung vom Print- zum Online-Wörterbuch und die Rolle des IDS in der Neologismenforschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über den Weg zum deutschen Neologismenwörterbuch, ein Kapitel über den Übergang zwischen Print- und Online-Version und einen Ausblick. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter präsentiert.
Was wird im Kapitel "Der Weg zum deutschen Neologismenwörterbuch" behandelt?
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Neologismus", analysiert die Ausgangssituation und die Notwendigkeit eines solchen Wörterbuchs, beleuchtet die Auswahlkriterien für die Aufnahme von Neologismen, beschreibt den Selektionsprozess und die verwendeten Materialien und diskutiert die historische und relative Gebundenheit von Neologismen sowie den Übergang von Okkasionalismus zu Neologismus.
Was wird im Kapitel "Von der Internetversion zur Printversion und wieder zurück" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Übergang des Neologismenwörterbuchs von der Print- zur Online-Version und zurück, beleuchtet die Herausforderungen und Vorteile beider Formate und analysiert den Einfluss dieser medialen Transformation auf die Zugänglichkeit und Nutzung des Wörterbuchs. Die Bedeutung der digitalen Version für Forschung und Öffentlichkeit sowie der Einfluss der Adaptionen an digitale Medien auf Präsentation und Forschung werden untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind Neologismen, Lexikographie, Deutsches Neologismenwörterbuch, IDS, Sprachwandel, Wortbildung, Online-Wörterbuch, Printwörterbuch, Sprachforschung, Okkasionalismus und Lexikalisierung.
Welche Materialien wurden für die Erstellung des Wörterbuchs verwendet?
Die Arbeit beschreibt die Materialbasis, die der Erstellung des Wörterbuchs zugrunde lag, jedoch ohne konkrete Quellen zu nennen. Dies ist im Detail im Kapitel "Der Weg zum deutschen Neologismenwörterbuch" erläutert.
Was ist ein Neologismus im Kontext dieser Arbeit?
Die Arbeit definiert den Begriff "Neologismus" und differenziert zwischen neuen lexikalischen Einheiten und neuen Bedeutungen bereits bestehender Wörter. Die genaue Definition wird im Kapitel "Der Weg zum deutschen Neologismenwörterbuch" erläutert.
Welche Rolle spielt das IDS in dieser Arbeit?
Das IDS (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache) ist der Herausgeber des untersuchten Neologismenwörterbuchs. Die Arbeit beleuchtet dessen Rolle in der Neologismenforschung und im Entstehungsprozess des Wörterbuchs.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Neologismen in der deutschen Sprache. Vom ersten Neologismenwörterbuch bis zum Einfluss auf den Sprachwandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1437843