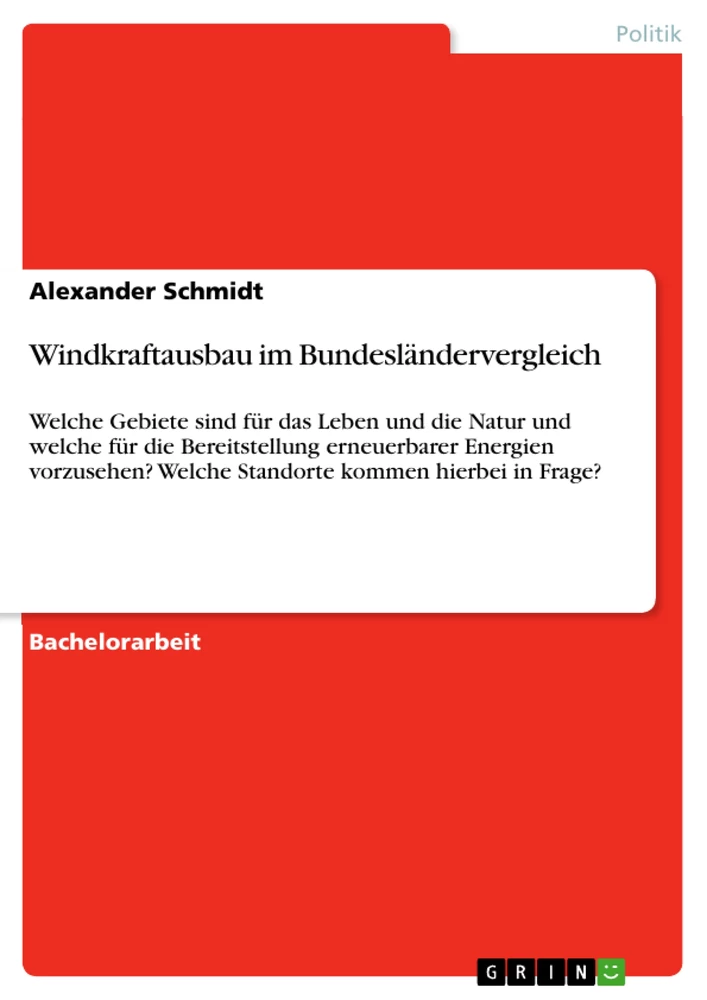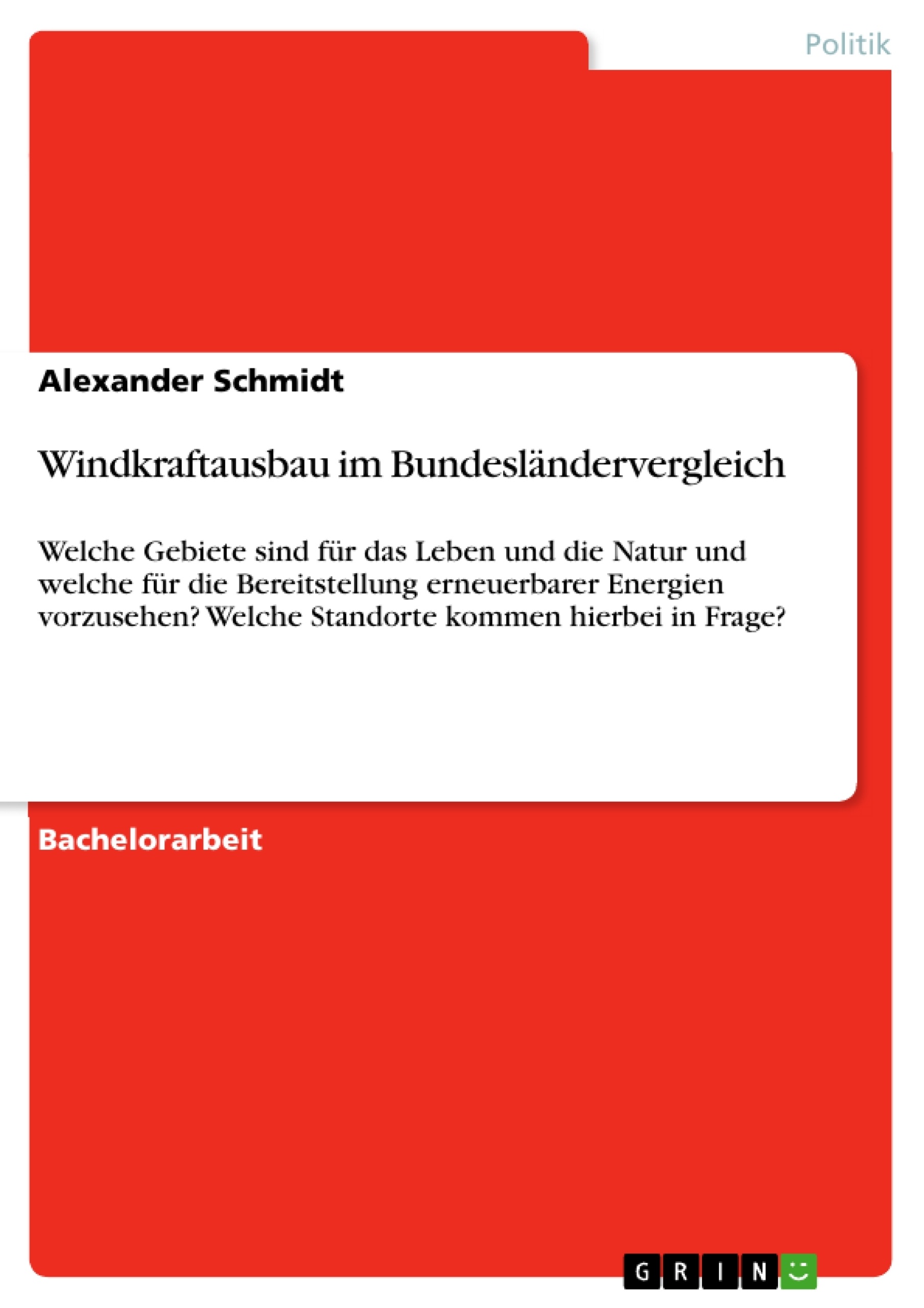Im Hinblick auf den Klimawandel erscheinen Erneuerbare Energien zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Die Windkraft stellt hierbei mit ihrem großem Ausbaupotenzial gerade in Deutschland einen wichtigen Bestandteil der Energiewende dar, bei deren Durchsetzung den Bundesländern ein erheblicher Spielraum zur Verfügung steht. Diesbezüglich spielt jedoch wie bei keiner anderen regenerativen Energiequelle die Flächennutzung eine entscheidende Rolle. Welche Gebiete sind für das Leben und die Natur und welche für die Bereitstellung erneuerbarer Energien vorzusehen? Welche Standorte kommen hierbei in Frage? Eine wesentliche Eigenschaft regenerativer Energien ist, dass sie im Gegensatz zu zentralen Versorgungsstrukturen – wie etwa bei Großraftwerken – dezentral produziert werden. Vor allem die Windkraft stellt dabei ein erhöhten Flächenverbrauch dar, wodurch Nutzungskonflikte entstehen, die für diese Arbeit von Interesse sind.
Der gewählte Untersuchungszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2021. Diese Zeitspanne umfasst den Beginn des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes im Jahr 2000, das als wegweisend für die Förderung von Windenergie an Land in Deutschland angesehen wird und markiert den Auftakt zur umfassenden Entwicklung der erneuerbaren Energien hierzulande. Ebenso schließt der Zeitraum die bedeutende Debatte um den Ausstieg aus der Atomkraft im Jahr 2011 ein, die durch die Nuklearkatastrophe in Japan ausgelöst wurde. Diese führte zu politischen Veränderungen und stellt einen maßgeblichen Einflussfaktor für die Entwicklung der Windenergie in den verschiedenen Bundesländern dar. Um einen angemessenen Abschlusspunkt für die Untersuchung zu setzen, wird das Jahr 2021 ausgewählt. Ab 2022 veränderten nämlich die Ereignisse rund um die russische Invasion der Ukraine maßgeblich die energiepolitische Landschaft und führten zur Einführung zahlreicher neuer Gesetze, wie etwa dem Zwei-Prozent-Flächenziel, welche den, in letzten Jahren in Stocken geratenen Ausbau zukünftig wieder vorantreiben sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie und Methode
- 2.1 Parteiendifferenz
- 2.2 Policy-Vergleich
- 2.3 Quellen
- 3. Windkraft als Policy
- 3.1 Energiepolitische Entwicklungen
- 3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Landesplanung
- 3.3 Flächenpotenzial
- 3.4 Akzeptanz
- 3.5 Waldschutz
- 4. Bundesländervergleich
- 4.1 Begründung der Fallauswahl
- 4.2 Baden-Württemberg
- 4.3 Bayern
- 4.4 Hessen
- 4.5 Rheinland-Pfalz
- 5. Policy-Vergleich der Landesverbände
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss parteipolitischer Präferenzen auf den Ausbau der Windkraft in verschiedenen deutschen Bundesländern. Sie analysiert die energiepolitischen Entwicklungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und die Akzeptanz der Windkraft in der Bevölkerung. Ein besonderer Fokus liegt auf Nutzungskonflikten, insbesondere im Hinblick auf den Waldschutz.
- Parteipolitische Einflüsse auf den Windkraftausbau
- Flächennutzungskonflikte im Zusammenhang mit Windkraft
- Akzeptanz von Windkraft in der Bevölkerung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Landesplanung im Kontext der Windenergie
- Vergleich der Windkraftpolitik in ausgewählten Bundesländern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Windkraftausbau in Deutschland ein und begründet die Relevanz der Arbeit vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Energiewende. Sie beschreibt die Bedeutung der Flächennutzungskonflikte und definiert den Untersuchungszeitraum (2000-2021), der den Beginn des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die Debatte um den Atomausstieg umfasst. Die Einleitung skizziert den Forschungsstand und identifiziert die Forschungslücke, die diese Arbeit schließt: einen qualitativen Policy-Vergleich des Windkraftausbaus im Bundesländervergleich unter Berücksichtigung parteipolitischer Präferenzen, insbesondere im Hinblick auf den Konflikt zwischen Windkraft und Naturschutz.
2. Theorie und Methode: Dieses Kapitel erläutert das theoretische Fundament der Arbeit, die Parteiendifferenzlehre. Es wird argumentiert, dass unterschiedliche Parteiorientierungen einen wesentlichen Einfluss auf den Policy-Outcome haben. Die Arbeit untersucht, wie Parteien ihre „traditionellen“ Themen besetzen und wie sich dies auf die Umsetzung energiepolitischer Ziele auswirkt. Das Kapitel diskutiert die Erklärungskraft der Parteiendifferenzhypothese im Kontext der Umwelt- und Energiepolitik und räumt ein, dass neben parteipolitischen Faktoren auch sozioökonomische Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Die Methode des Policy-Vergleichs in ausgewählten Bundesländern wird dargelegt.
3. Windkraft als Policy: Dieses Kapitel behandelt die Windkraft als politische Handlungsoption (Policy). Es beleuchtet die energiepolitischen Entwicklungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Landesplanung im Zusammenhang mit Windkraftanlagen. Weiterhin werden das Flächenpotenzial, die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Herausforderungen des Waldschutzes im Kontext des Windkraftausbaus diskutiert. Das Kapitel legt die Grundlage für den anschließenden Bundesländervergleich, indem es die relevanten Faktoren und Konfliktlinien systematisch darstellt.
4. Bundesländervergleich: Dieses Kapitel präsentiert einen detaillierten Vergleich des Windkraftausbaus in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Es begründet die Auswahl dieser Bundesländer aufgrund ähnlicher topografischer Voraussetzungen und daraus resultierender Flächennutzungskonflikte. Der Vergleich analysiert die jeweiligen energiepolitischen Strategien, rechtlichen Regelungen und die Rolle der Parteien im Entscheidungsprozess. Die Analyse verdeutlicht die unterschiedlichen Umgangsformen mit den Herausforderungen des Windkraftausbaus in den einzelnen Bundesländern und die damit verbundenen parteipolitischen Einflüsse.
5. Policy-Vergleich der Landesverbände: Dieses Kapitel vergleicht die Windkraft-Policies der Landesverbände der jeweiligen Parteien und untersucht, inwiefern die auf Landesebene beobachteten Unterschiede mit den parteipolitischen Positionen der Landesverbände übereinstimmen. Dieser Vergleich vertieft die Analyse des Einflusses parteipolitischer Präferenzen auf den Windkraftausbau.
Schlüsselwörter
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Parteipolitische Einflüsse auf den Ausbau der Windkraft in deutschen Bundesländern"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss parteipolitischer Präferenzen auf den Ausbau der Windkraft in verschiedenen deutschen Bundesländern. Sie analysiert energiepolitische Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen, die Akzeptanz der Windkraft und Nutzungskonflikte, insbesondere im Hinblick auf den Waldschutz.
Welche Bundesländer werden im Bundesländervergleich betrachtet?
Der Vergleich konzentriert sich auf Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz aufgrund ähnlicher topografischer Voraussetzungen und daraus resultierender Flächennutzungskonflikte.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen qualitativen Policy-Vergleich, der die energiepolitischen Strategien, rechtlichen Regelungen und die Rolle der Parteien im Entscheidungsprozess in den ausgewählten Bundesländern analysiert. Die Parteiendifferenzlehre bildet das theoretische Fundament.
Welche Faktoren werden im Zusammenhang mit dem Windkraftausbau untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem energiepolitische Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und Landesplanung, Flächenpotenzial, Akzeptanz in der Bevölkerung und Herausforderungen des Waldschutzes.
Welchen Zeitraum umfasst die Untersuchung?
Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von 2000 bis 2021, um den Beginn des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die Debatte um den Atomausstieg einzubeziehen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie parteipolitische Präferenzen den Windkraftausbau in den untersuchten Bundesländern beeinflussen und welche Rolle dabei Nutzungskonflikte, insbesondere im Hinblick auf den Waldschutz, spielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theorie und Methode, Windkraft als Policy, Bundesländervergleich, Policy-Vergleich der Landesverbände und Fazit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung im Text erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Windkraft, Energiewende, Parteiendifferenz, Flächennutzungskonflikt, Waldschutz, Bundesländervergleich, Policy-Analyse, Akzeptanz, energiepolitische Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Landesplanung.
Wie wird der Einfluss der Parteien auf den Windkraftausbau untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss, indem sie die Policies der Landesverbände der jeweiligen Parteien vergleicht und überprüft, inwieweit die auf Landesebene beobachteten Unterschiede mit den parteipolitischen Positionen übereinstimmen.
- Quote paper
- Alexander Schmidt (Author), 2023, Windkraftausbau im Bundesländervergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1437098