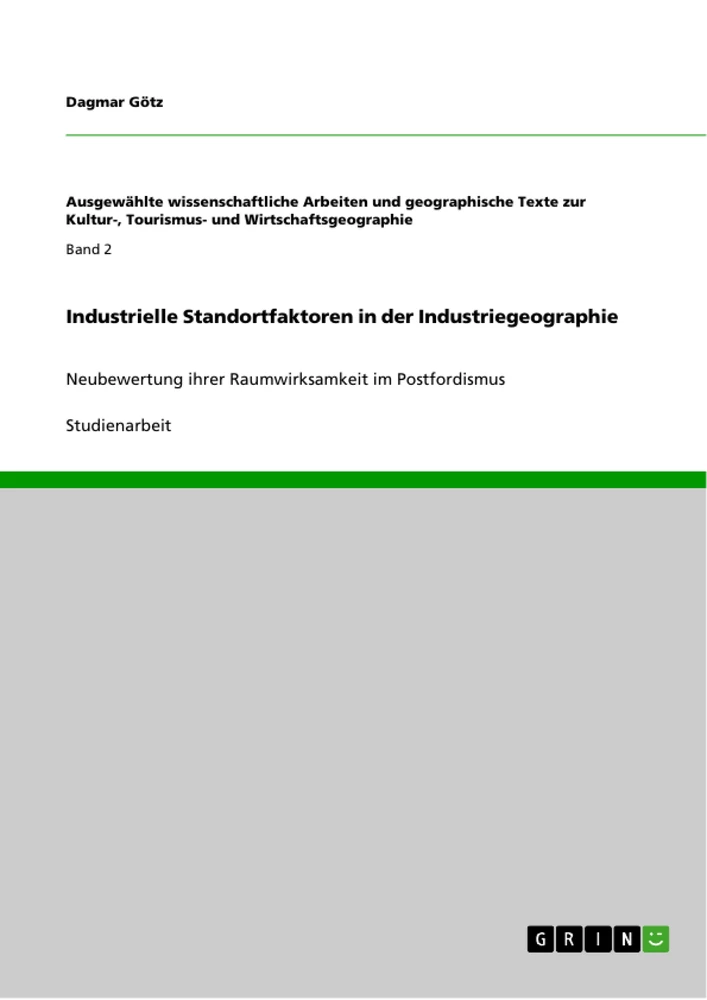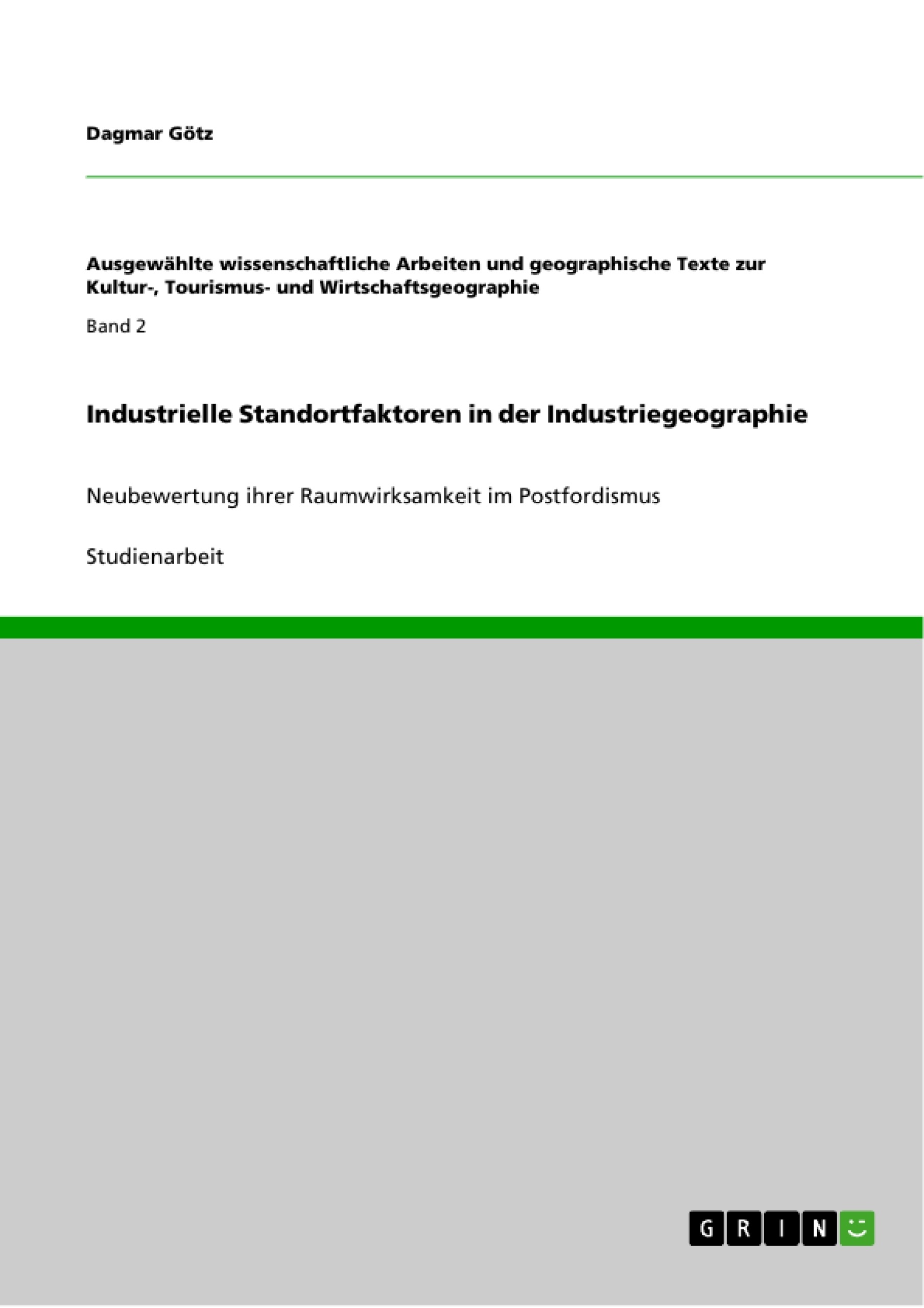Die Hausarbeit behandelt industrielle Standortfaktoren und ihre Raumwirksamkeit im Zeitalter des Fordismus und Postfordismus.
Ein komprimierter Überblick zu wesentlichen Standorttheorien und Standortfaktoren wird ebenso unternommen wie die Darstellung der Industriestruktur und ihre Raumwirksamkeit im nationalen wie internationalen Kontext.Auch sozialräumliche Belange und Umweltschutzerfordernisse kommen zur Sprache.
Die Arbeit eignet sich vor allem für wirtschaftsgeographisch interessierte Studenten in den oberen Semestern (Hauptstudium).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung und Definition von Industrie, Definition Wirtschaftsgeographie
- 2.1 Der Begriff „Industrie“
- 2.2 Definition Wirtschaftsgeographie nach L. SCHÄTZL
- 3. Standorttheorien
- 3.1 Die klassischen Standorttheorien von WEBER und LÖSCH
- 3.1.1 Die Industriestandorttheorie nach A. WEBER (1909)
- 3.1.2 Theorie der Marktnetze nach LÖSCH (1944)
- 3.2 Wirtschaftsstufentheorie nach ROSTOW (1960)
- 3.3 Zyklisch-dynamische Erklärungsansätze
- 3.3.1 KONDRATIEFF`S Theorie der Langen Wellen (1926)
- 3.3.2 Produktlebenszyklustheorie
- 3.4 Aus den dynamisch-evolutionären Konzepten: Konzept der regionalen Kompetenzzentren
- 4. Harte und weiche Standortfaktoren
- 5. Industriestruktur und Raumwirksamkeit
- 5.1 Einbetriebsunternehmen
- 5.2 Zulieferbeziehungen
- 5.3 Mehrbetriebsunternehmen
- 5.4 Multinationale Konzerne
- 6. Industrielle Standortentwicklung in Industrienationen und Entwicklungsländern und sozialräumliche Auswirkungen
- 6.1 Monozentrische Verdichtungsräume
- 6.2 Polyzentrische Verdichtungsräume
- 6.3 Industrie im peripheren Raum
- 6.4 Industrie in Entwicklungsländern
- 6.5 Nutzungskonflikte und Umweltschutzauflagen
- 7. Wirtschaftspolitik und Raumplanung: Einflussfaktoren auf die industrielle Standortwahl und Standortstruktur
- 7.1 Wirtschaftspolitik und Raumplanung auf nationaler Ebene
- 7.2 Wirtschaftspolitische Instrumente auf kontinentaler Ebene (Supranationale Zusammenschlüsse)
- 7.3 Wirtschaftspolitische Instrumente auf internationaler Ebene
- 8. Globalisierung von Wirtschaftssystemen
- 8.1 Der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus
- 8.2 Globalisierung von Produktionsnetzen und Standortsystemen
- 8.3 Fallbeispiel Siemens AG
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung industrieller Standortfaktoren und deren Raumwirksamkeit im Postfordismus. Ziel ist es, die entscheidenden Faktoren für den Erfolg von Unternehmen im Kontext der globalisierten Wirtschaft zu analysieren und zu bewerten.
- Analyse klassischer und moderner Standorttheorien
- Untersuchung der Auswirkungen von Industriestruktur auf die räumliche Verteilung von Unternehmen
- Bewertung der Rolle von Wirtschaftspolitik und Raumplanung
- Bedeutung von harten und weichen Standortfaktoren im Postfordismus
- Der Einfluss der Globalisierung auf industrielle Standortsysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Industriegeographie ein und definiert den Wirtschaftsraum sowie die Aufgaben der Industriegeographie. Sie betont die Bedeutung der Analyse von Standortfaktoren und deren Raumwirksamkeit, insbesondere im Kontext des Postfordismus. Die Abbildung des Wirtschaftsraumes und seiner Funktionen visualisiert die komplexen Wechselwirkungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert untersucht werden.
2. Einordnung und Definition von Industrie, Definition Wirtschaftsgeographie: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Industrie" und ordnet ihn in den Kontext der sektoralen Wirtschaftsgliederung nach Clark ein. Es wird die industrielle Produktion als stoffliche Umformung und Verarbeitung von Rohstoffen beschrieben, mit Betonung des hohen Kapitaleinsatzes und der Arbeitsteilung. Die Definition der Wirtschaftsgeographie nach Schättl betont die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der räumlichen Ordnung und Organisation der Wirtschaft, unter Berücksichtigung räumlicher Strukturen und Entwicklungstheorien.
3. Standorttheorien: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Standorttheorien, beginnend mit den klassischen Ansätzen von Weber und Lösch (industrielle Standortwahl und Marktnetze). Es werden weiterführende Theorien wie die Wirtschaftsstufentheorie nach Rostow und zyklisch-dynamische Erklärungsansätze (Kondratieff-Wellen, Produktlebenszyklus) vorgestellt. Abschließend wird das Konzept der regionalen Kompetenzzentren als dynamisch-evolutionärer Ansatz diskutiert. Diese umfassende Darstellung verschiedener theoretischer Perspektiven bildet die Grundlage für die spätere Analyse der Raumwirksamkeit industrieller Standortfaktoren.
4. Harte und weiche Standortfaktoren: Dieses Kapitel dürfte die Unterscheidung und Gewichtung von harten (z.B. Infrastruktur, Rohstoffe) und weichen Standortfaktoren (z.B. qualifizierte Arbeitskräfte, Lebensqualität) behandeln. Die Analyse wird vermutlich die Bedeutung beider Kategorien für die Standortentscheidung von Unternehmen beleuchten und die unterschiedlichen Einflüsse im Kontext des Postfordismus aufzeigen, möglicherweise mit regionalen oder branchenspezifischen Variationen.
5. Industriestruktur und Raumwirksamkeit: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Industriestruktur (Einbetriebsunternehmen, Zulieferbeziehungen, Mehrbetriebsunternehmen, multinationale Konzerne) auf die räumliche Verteilung von Industriebetrieben. Es analysiert wahrscheinlich die unterschiedlichen räumlichen Auswirkungen der verschiedenen Unternehmensformen und deren Verflechtungen. Hier werden vermutlich auch die Auswirkungen von globalisierten Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerken behandelt.
6. Industrielle Standortentwicklung in Industrienationen und Entwicklungsländern und sozialräumliche Auswirkungen: Dieses Kapitel analysiert die Standortentwicklung in verschiedenen räumlichen Kontexten (Mono- und Polyzentrische Verdichtungsräume, periphere Räume, Entwicklungsländer). Der Fokus liegt vermutlich auf den sozialräumlichen Auswirkungen der industriellen Entwicklung, einschließlich Nutzungskonflikten und Umweltschutzauflagen. Die Analyse wird wahrscheinlich die Herausforderungen und Chancen der industriellen Entwicklung in verschiedenen Regionen beleuchten.
7. Wirtschaftspolitik und Raumplanung: Einflussfaktoren auf die industrielle Standortwahl und Standortstruktur: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von wirtschaftspolitischen Instrumenten und Maßnahmen der Raumplanung auf die Standortwahl und -struktur von Unternehmen. Es wird voraussichtlich die wirtschaftspolitischen Strategien auf nationaler, kontinentaler und internationaler Ebene analysieren und deren Auswirkungen auf die räumliche Verteilung der Industrie bewerten. Die Analyse dürfte die Interaktion zwischen staatlichen Eingriffen und den Entscheidungen privater Unternehmen beleuchten.
8. Globalisierung von Wirtschaftssystemen: Dieses Kapitel analysiert den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus und die damit verbundenen Veränderungen in den globalen Produktionsnetzen und Standortsystemen. Ein Fallbeispiel (z.B. Siemens AG) wird vermutlich die konkreten Auswirkungen der Globalisierung auf die Standortstrategien multinationaler Konzerne illustrieren. Die Diskussion wird die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung für die industrielle Standortentwicklung beleuchten.
Schlüsselwörter
Industriegeographie, Standortfaktoren, Postfordismus, Globalisierung, Wirtschaftspolitik, Raumplanung, Standorttheorien, Industriestruktur, Raumwirksamkeit, regionale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Industriegeographie im Postfordismus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Industriegeographie im Postfordismus. Sie untersucht die Bedeutung industrieller Standortfaktoren und deren Raumwirksamkeit, analysiert die entscheidenden Faktoren für den Erfolg von Unternehmen in der globalisierten Wirtschaft und bewertet die Rolle von Wirtschaftspolitik und Raumplanung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter klassische und moderne Standorttheorien (Weber, Lösch, Rostow, Kondratieff), harte und weiche Standortfaktoren, die Auswirkungen der Industriestruktur (Einbetriebs- vs. Mehrbetriebsunternehmen, multinationale Konzerne) auf die räumliche Verteilung von Unternehmen, industrielle Standortentwicklung in Industrienationen und Entwicklungsländern, wirtschaftspolitische und raumplanerische Einflüsse, die Globalisierung von Wirtschaftssystemen (Fordismus vs. Postfordismus) und die sozialräumlichen Auswirkungen der industriellen Entwicklung.
Welche Standorttheorien werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert einen Überblick über verschiedene Standorttheorien, beginnend mit den klassischen Ansätzen von Alfred Weber (industrielle Standortwahl) und August Lösch (Theorie der Marktnetze). Weitere behandelte Theorien sind die Wirtschaftsstufentheorie nach Rostow, zyklisch-dynamische Erklärungsansätze wie Kondratieffs Theorie der Langen Wellen und die Produktlebenszyklustheorie. Schließlich wird das Konzept der regionalen Kompetenzzentren als dynamisch-evolutionärer Ansatz diskutiert.
Was versteht man unter harten und weichen Standortfaktoren?
Die Arbeit unterscheidet zwischen harten Standortfaktoren (z.B. Infrastruktur, Rohstoffe, Transportkosten) und weichen Standortfaktoren (z.B. qualifizierte Arbeitskräfte, Lebensqualität, Umweltbedingungen). Sie analysiert die Bedeutung beider Kategorien für die Standortentscheidung von Unternehmen und deren unterschiedlichen Einfluss im Kontext des Postfordismus.
Wie wirkt sich die Industriestruktur auf die räumliche Verteilung von Unternehmen aus?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Industriestrukturen (Einbetriebsunternehmen, Zulieferbeziehungen, Mehrbetriebsunternehmen, multinationale Konzerne) auf die räumliche Verteilung von Industriebetrieben. Sie analysiert die unterschiedlichen räumlichen Auswirkungen der verschiedenen Unternehmensformen und deren Verflechtungen im Kontext globalisierter Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerke.
Welche Rolle spielen Wirtschaftspolitik und Raumplanung?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von wirtschaftspolitischen Instrumenten und Maßnahmen der Raumplanung auf die Standortwahl und -struktur von Unternehmen. Sie untersucht wirtschaftspolitische Strategien auf nationaler, kontinentaler und internationaler Ebene und deren Auswirkungen auf die räumliche Verteilung der Industrie. Die Interaktion zwischen staatlichen Eingriffen und den Entscheidungen privater Unternehmen wird beleuchtet.
Wie wird die Globalisierung behandelt?
Die Arbeit analysiert den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus und die damit verbundenen Veränderungen in den globalen Produktionsnetzen und Standortsystemen. Ein Fallbeispiel (z.B. Siemens AG) illustriert die konkreten Auswirkungen der Globalisierung auf die Standortstrategien multinationaler Konzerne. Die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung für die industrielle Standortentwicklung werden diskutiert.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Definitionen von Industrie und Wirtschaftsgeographie, Standorttheorien, harten und weichen Standortfaktoren, Industriestruktur und Raumwirksamkeit, industrieller Standortentwicklung in Industrienationen und Entwicklungsländern, Wirtschaftspolitik und Raumplanung, Globalisierung von Wirtschaftssystemen und einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Industriegeographie, Standortfaktoren, Postfordismus, Globalisierung, Wirtschaftspolitik, Raumplanung, Standorttheorien, Industriestruktur, Raumwirksamkeit, regionale Entwicklung.
- Quote paper
- Diplom-Geographin Dagmar Götz (Author), 2004, Industrielle Standortfaktoren in der Industriegeographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143651