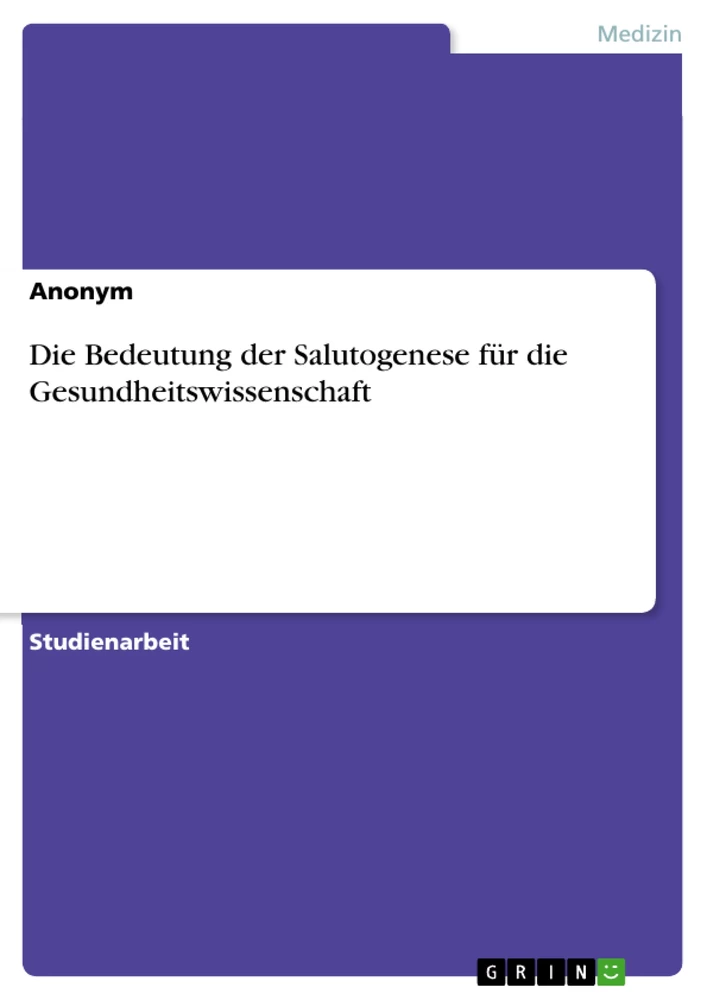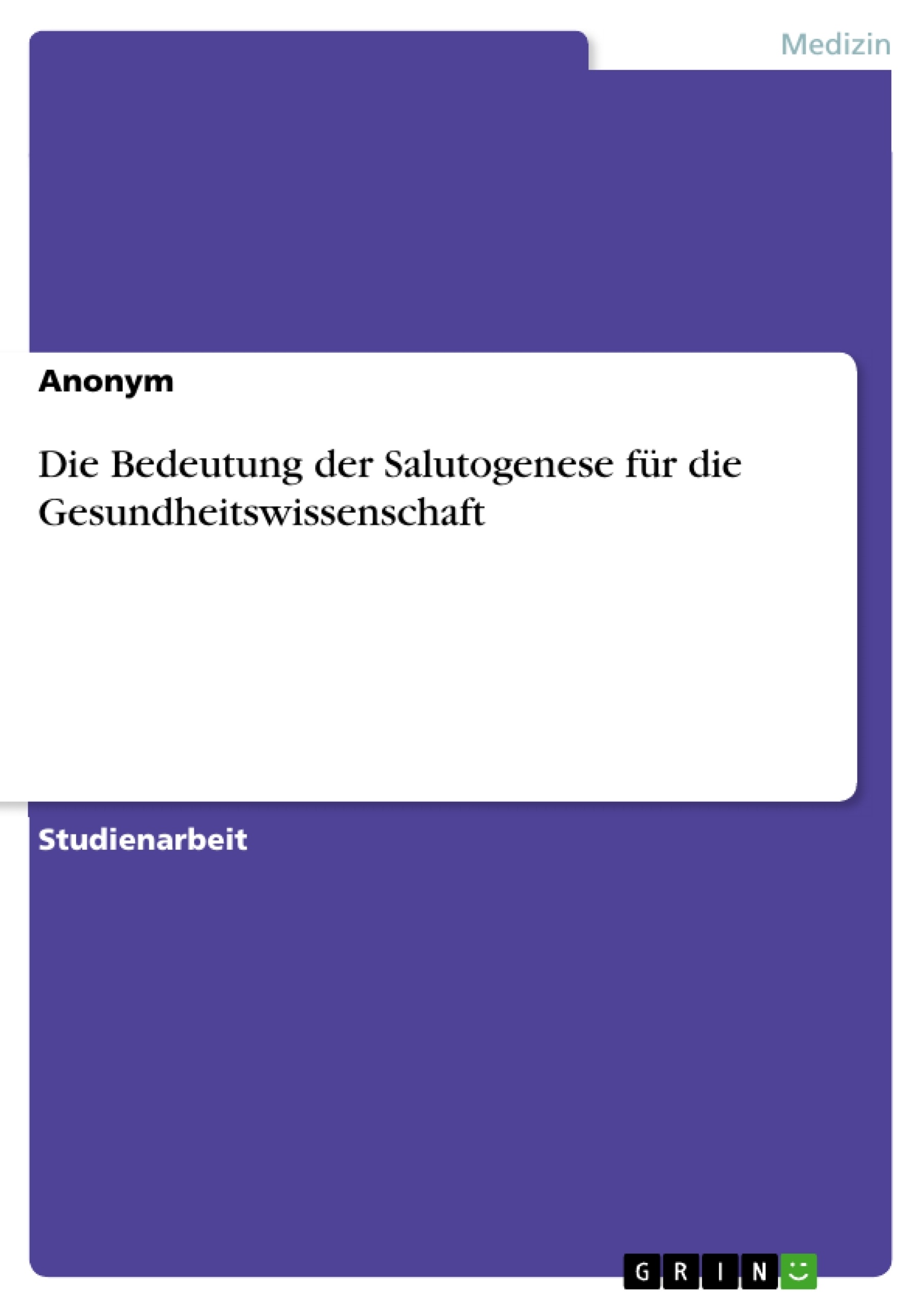In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wertete der israelisch – amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923 – 1994) eine Erhebung über die Adaption von Frauen an die Menopause aus und stellte dabei fest dass sich 29% einer Gruppe in einem guten mentalen Zustand sahen.
Die Besonderheit: Alle Teilnehmer dieser Gruppe waren ehemalige Inhaftierte eines Konzentrationslagers die zwischenzeitlich nach Israel emigriert waren.
Anders als in der pathogenesen Perspektive fragte Antonovsky nicht warum 71% der Teilnehmer dieser Gruppe „krank“ waren, sondern warum immerhin 29% der Untersuchungsgruppe sich in einem guten emotionalen Zustand befand - was erstaunlich erschien angesichts dieser traumatischen Vergangenheitserlebnisse.
Die Ausgangsfrage der Salutogenese (lat. „salus“: Unverletztheit, Heil, Glück; griech. „genese“: Entstehung) war hiermit geboren.
Während die Medizin ihren Fokus darauf legt wie Krankheit vermieden und kuriert werden kann und sich die Frage stellt „Was macht krank?“, verfolgte Antonovsky eine andere Herangehensweise.
Seine Frage war: Was macht die Leute gesund und welche Aspekte/ Determinanten bewegen den Menschen in Richtung Gesundheit?
Mit diesem Ansatz vollzog Antonovsky einen Paradigmenwechsel.
Im Folgenden werde ich versuchen sein Modell der Salutogenese kurz zu skizzieren und anschließend die Rezeption des Modells in der Literatur beleuchten.
Abschliessen möchte ich mit einem persönlichen Fazit indem ich versuche die Frage zu erörtern, inwiefern Pflegekräfte den salutogenetischen Ansatz in der alltäglichen Berufspraxis umsetzen können.
Aufgrund der formalen Vorgaben die Hausarbeit in mindestens 12 und maximal 15 Seiten zu erstellen, wird all dies in stark komprimierter Form geschehen.
Inhaltsverzeichnis
- Paradigmenwechsel – Von der Pathogenese zur Salutogenese
- Das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky
- Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
- Gesundheitszustand als Ergebnis aus belastenden und schützenden Faktoren
- Belastende Faktoren (Stressoren)
- Schützende Faktoren (Widerstandsressourcen)
- Konzept des „Kohärenzsinns/-gefühls“
- Verstehbarkeit
- Handhabbarkeit
- Sinnhaftigkeit
- Rezeption
- Positive Aspekte – Stärken des Modells
- Negative Aspekte - Schwächen des Modells
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky und seine Bedeutung für die Gesundheitswissenschaft. Sie skizziert das Modell, beleuchtet seine Rezeption in der Literatur und diskutiert seine Anwendbarkeit in der Pflegepraxis. Der Fokus liegt auf dem Paradigmenwechsel von der Pathogenese zur Salutogenese und der Bedeutung von Stressoren und Widerstandsressourcen für den Gesundheitszustand.
- Paradigmenwechsel von Pathogenese zu Salutogenese
- Das Konzept des Kohärenzsinns
- Stressoren und Widerstandsressourcen
- Stärken und Schwächen des salutogenetischen Modells
- Anwendbarkeit des salutogenetischen Ansatzes in der Pflegepraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Paradigmenwechsel – Von der Pathogenese zur Salutogenese: Dieses Kapitel führt in das salutogenetische Modell ein und beschreibt den Paradigmenwechsel von der krankheitsorientierten Pathogenese zur gesundheitsorientierten Salutogenese. Ausgehend von Antonovskys Untersuchung an ehemaligen KZ-Häftlingen, die trotz traumatischer Erfahrungen einen guten mentalen Zustand aufwiesen, wird die zentrale Frage nach den Faktoren gestellt, die Menschen gesund erhalten. Im Gegensatz zur Pathogenese, die sich mit den Ursachen von Krankheit befasst, konzentriert sich die Salutogenese auf die Entstehung von Gesundheit. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Erörterung des salutogenetischen Modells.
Das Modell der Salutogenese nach Antonovsky: Dieses Kapitel erläutert die Kernprinzipien des salutogenetischen Modells von Antonovsky. Es hebt die Dynamik von Gesundheit hervor, die nicht als statischer Zustand, sondern als ein aktiv zu erhaltender Prozess verstanden wird. Antonovsky postuliert ein Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, auf dem sich Individuen in Abhängigkeit von Stressoren und Widerstandsressourcen befinden. Das Kapitel analysiert belastende und schützende Faktoren, die das interaktive Zusammenspiel zwischen individuellen Erfahrungen und dem Gesundheitszustand verdeutlichen. Die Konzepte von Stressoren und Widerstandsressourcen werden definiert und differenziert. Besondere Aufmerksamkeit wird auf das Konzept des Kohärenzsinns gelegt, das eine zentrale Rolle im Modell spielt.
Rezeption: Dieser Abschnitt evaluiert die Rezeption des salutogenetischen Modells in der wissenschaftlichen Literatur. Er beleuchtet sowohl positive als auch negative Aspekte des Modells, diskutiert dessen Stärken und Schwächen in der Anwendung und der Forschung. Dieser Abschnitt analysiert kritisch die empirischen Belege, die das Modell unterstützen oder in Frage stellen. Es werden die Vor- und Nachteile des Modells im Kontext der Gesundheitsforschung und -praxis detailliert dargestellt und im Kontext der wissenschaftlichen Debatte positioniert.
Schlüsselwörter
Salutogenese, Pathogenese, Aaron Antonovsky, Kohärenzsinn, Gesundheit, Krankheit, Stressoren, Widerstandsressourcen, Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, Gesundheitsförderung, Pflegepraxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Salutogenetisches Modell nach Antonovsky
Was ist der zentrale Gegenstand des Textes?
Der Text behandelt das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky. Er beschreibt den Paradigmenwechsel von der Pathogenese (Krankheitsorientierung) zur Salutogenese (Gesundheitsorientierung) und erklärt die Kernprinzipien des Modells, einschließlich des Konzepts des Kohärenzsinns, Stressoren und Widerstandsressourcen.
Was ist der Unterschied zwischen Pathogenese und Salutogenese?
Die Pathogenese konzentriert sich auf die Ursachen von Krankheiten, während die Salutogenese sich auf die Entstehung und Erhaltung von Gesundheit fokussiert. Der Text beschreibt dies als einen Paradigmenwechsel in der Gesundheitsforschung.
Was ist das Konzept des Kohärenzsinns nach Antonovsky?
Der Kohärenzsinn ist ein zentrales Konzept im salutogenetischen Modell. Er besteht aus drei Komponenten: Verstehbarkeit (die Fähigkeit, Ereignisse als strukturiert und erklärbar zu verstehen), Handhabbarkeit (das Gefühl, mit den Anforderungen des Lebens umgehen zu können) und Sinnhaftigkeit (die Überzeugung, dass das Leben einen Wert und einen Zweck hat). Ein hoher Kohärenzsinn wird mit besserer Gesundheit und Widerstandsfähigkeit in Verbindung gebracht.
Welche Rolle spielen Stressoren und Widerstandsressourcen im Modell?
Stressoren sind belastende Faktoren, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Widerstandsressourcen sind hingegen schützende Faktoren, die die Gesundheit fördern und das Individuum vor den negativen Auswirkungen von Stressoren schützen. Das Modell beschreibt ein dynamisches Zusammenspiel zwischen beiden.
Welche Stärken und Schwächen des salutogenetischen Modells werden im Text diskutiert?
Der Text evaluiert sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte des Modells. Die Stärken und Schwächen werden im Kontext der wissenschaftlichen Literatur und der praktischen Anwendung analysiert, inklusive einer kritischen Auseinandersetzung mit empirischen Belegen.
Wie wird das salutogenetische Modell in der Pflegepraxis angewendet?
Der Text erwähnt die Anwendbarkeit des salutogenetischen Ansatzes in der Pflegepraxis, legt aber den Schwerpunkt auf das Verständnis des Modells und seiner theoretischen Grundlagen. Eine detaillierte Darstellung der praktischen Anwendung bleibt dem Text überlassen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Paradigmenwechsel von Pathogenese zu Salutogenese, Das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky (einschließlich Kohärenzsinn, Stressoren und Ressourcen), Rezeption des Modells (Stärken und Schwächen) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Salutogenese, Pathogenese, Aaron Antonovsky, Kohärenzsinn, Gesundheit, Krankheit, Stressoren, Widerstandsressourcen, Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, Gesundheitsförderung, Pflegepraxis.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Die Bedeutung der Salutogenese für die Gesundheitswissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143488