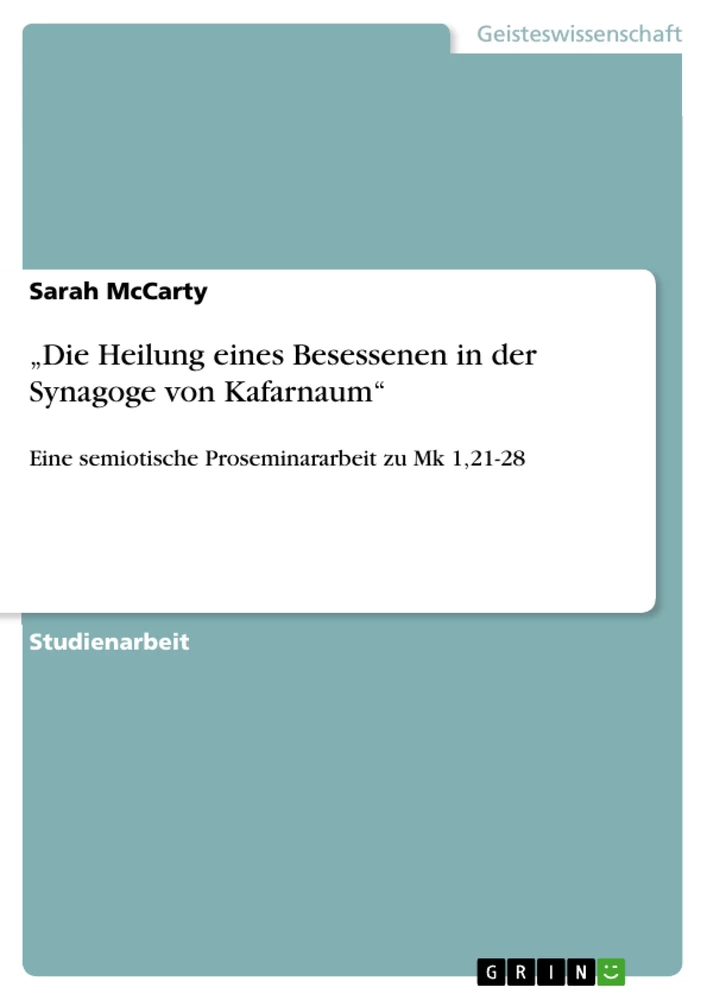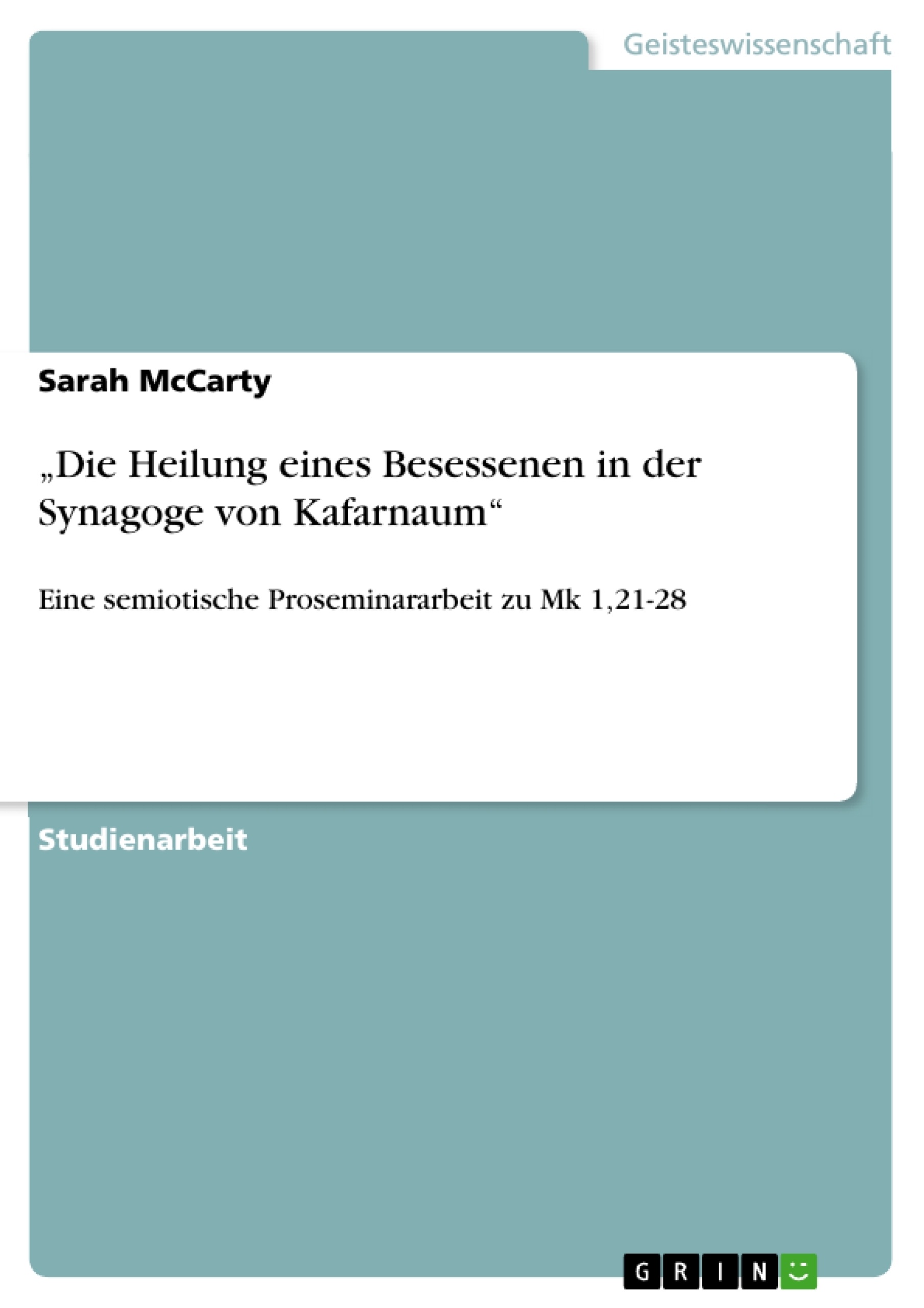In dieser exegetischen Proseminararbeit wird die Bibelstelle Mk 1,21-28 mithilfe der Methode der semiotischen Exegese untersucht. Hierbei werden die Teilbereiche Texkritik & Intratextuelle Analyse(Syntagmatik, Semantik, Pragmatik)erkärt und angewendet.
„Eine semiotische Lektüre beruht auf einer ethischen Entscheidung: sie möchte die Andersheit des Anderen respektieren. Ein Text ist ein Gegenüber, das ich nicht selbst bin. Positiv formuliert beruht eine semiotische Lektüre auf der Erwartung, dass ein Text etwas sagen kann, was ich mir nicht selbst sagen kann. Der Respekt vor dem Anderen weckt das Begehren nach seiner Botschaft.“
Für diese exegetische Proseminararbeit habe ich mich für die Methode der semiotischen Exegese entschieden, da ich diese in einem anderen bibelwissenschaftlichen Seminar bereits kennengelernt hatte. Ich finde es spannend meine eigenen Erfahrungen mit einem Text machen zu dürfen. Die Suche danach, was der Autor eigentlich mit seinem Text sagen wollte, halte ich persönlich für wenig sinnvoll, da ich niemals mit endgültiger Sicherheit sagen könnte, was die Intentionen des Autors waren.
In der semiotischen Exegese zählt auch mein Interpretationsansatz beziehungsweise die Konstruktion, die ich mit den verschiedenen Methodenschritten schaffe. Ich stehe nicht „außerhalb des Textes, sondern gehöre zu den Zeichenprozessen unhintergehbar dazu“ . Hier gibt es nicht nur ein Wirklichkeitsverständnis, das es für mich zu „erraten“ oder exakt zu rekonstruieren gilt. Mir gefällt die Idee, den Text als Konstruktion einer fremden Welt und Wirklichkeit anzusehen, ihn auf seine Besonderheiten hin zu untersuchen und schließlich auch so zu verstehen und zu deuten.
Ich habe mich bewusst für eine Perikope entschieden, in der es um Wunder oder besser gesagt um eine Wundertat Jesu geht. Wunder kennen wir in unserer alltäglichen Welt nicht oder sind sehr selten bereit daran zu glauben. Will man sich nun also auf eine Erzählung aus einer vergangenen Zeit einlassen, eignet sich eine Wundergeschichte meines Erachtens nach am ehesten. Denn hier bin ich von der Handlung her schon darauf angewiesen zu vergessen was ich (über naturwissenschaftliche Gesetze) gelernt habe und damit trete ich der Geschichte einen Schritt entgegen und öffne mich ihr. Dies ist die Grundlage für die semiotische Exegese.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textkritik
- 2.1 Mk 1, 21
- 2.1.1 Problembeschreibung
- 2.1.2 Äußere Textkritik
- 2.1.3 Innere Textkritik
- 2.1.4 Gesamturteil
- 2.1.5 Gegenprobe
- 2.2 Mk 1, 25
- 2.2.1 Problembeschreibung
- 2.2.2 Äußere Textkritik
- 2.2.3 Innere Textkritik
- 2.2.4 Gesamturteil
- 2.2.5 Gegenprobe
- 2. 3 Mk 1, 26
- 2.3.1 Problembeschreibung
- 2.3.2 Äußere Textkritik
- 2.3.3 Innere Textkritik
- 2.3.4 Gesamturteil
- 2.3.5 Gegenprobe
- 2.4 Mk 1, 27
- 2.4.1 Problembeschreibung
- 2.4.2 Äußere Textkritik
- 2.4.3 Innere Textkritik
- 2.4.4 Gesamturteil
- 2.4.5 Gegenprobe
- 3. Intratextuelle Analyse
- 3.1 Textpartitur
- 3.1.1 Auswertung
- 3.2 Syntagmatische Analyse
- 3.2.1 Syntagmatik des Mikrotextes
- 3.2.2 Syntagmatik des Makrotextes
- 3.2.3 Ergebnis der syntagmatischen Analyse
- 3.3 Semantik
- 3.3.1 Semantik des Mikrotextes
- 3.3.2 Semantik unter Berücksichtigung des Makrotextes
- 3.3.3 Enzyklopädische Semantik
- 3.4 Pragmatik
- 3.4.1 Reflexion zu den bisherigen Arbeitsschritten
- 3.4.2 Die Ideologie des Textes
- 3.4.3 Evaluation des Textes
- 4. Zusammenfassende Interpretation des Textes
- 5. Übersetzung
- Textkritische Analyse der Perikope Mk 1,21-28
- Semiotische Analyse des Textes unter Berücksichtigung von Syntagmatik und Semantik
- Pragmatische Interpretation des Textes im Kontext der Ideologie und Evaluation
- Zusammenfassende Interpretation der Perikope und deren Bedeutung im größeren Kontext
- Übersetzung der Perikope
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Proseminararbeit setzt sich zum Ziel, die Perikope Mk 1,21-28 mithilfe der semiotischen Exegese zu analysieren. Dabei wird die Vielschichtigkeit des biblischen Textes beleuchtet und untersucht, wie sich die verschiedenen Zeichenebenen und ihre Bedeutung für die Interpretation erschließen lassen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der semiotischen Exegese und deren Anwendung auf die Perikope Mk 1,21-28 ein. Dabei wird die Relevanz der Methode für die Bibelinterpretation und die Bedeutung des Textes für den Lernprozess von zukünftigen Religionslehrern erläutert. Die semiotische Lektüre wird als ein Ansatz verstanden, der die Andersheit des Textes respektiert und die Interpretation als einen konstruktiven Prozess betrachtet.
2. Textkritik
Dieses Kapitel widmet sich der textkritischen Analyse der Perikope Mk 1,21-28. Die verschiedenen Lesarten und Varianten des griechischen Textes werden aufgeschlüsselt und anhand der Prinzipien der äußeren und inneren Textkritik beurteilt. Dabei wird der textkritische Apparat genutzt, um die Qualität der Textzeugen und die Plausibilität der Lesarten zu erforschen.
3. Intratextuelle Analyse
Der dritte Abschnitt widmet sich der intratextuellen Analyse des Textes. Die Textpartitur, die syntagmatische Analyse und die Semantik des Textes werden ausführlich untersucht. Dabei werden die verschiedenen Zeichenebenen des Textes analysiert und ihr Verhältnis zueinander betrachtet. Die pragmatische Analyse fokussiert auf die Ideologie des Textes und seine Evaluation im Kontext des historischen und kulturellen Hintergrunds.
4. Zusammenfassende Interpretation des Textes
Dieser Abschnitt bietet eine zusammenfassende Interpretation der Perikope Mk 1,21-28, die auf den Ergebnissen der vorherigen Analysen basiert.
Schlüsselwörter
Semiotische Exegese, Textkritik, Intratextuelle Analyse, Syntagmatik, Semantik, Pragmatik, Ideologie, Evaluation, Perikope, Mk 1,21-28, Wundergeschichte, Jesus, Synagoge, Kafarnaum
- Citation du texte
- Sarah McCarty (Auteur), 2008, „Die Heilung eines Besessenen in der Synagoge von Kafarnaum“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143455