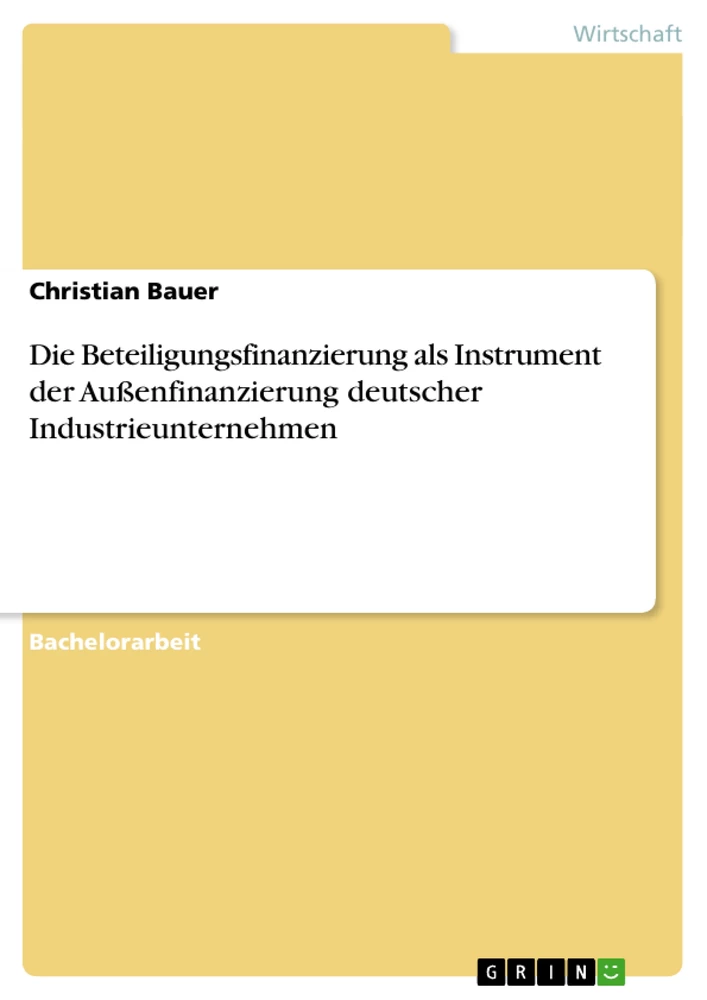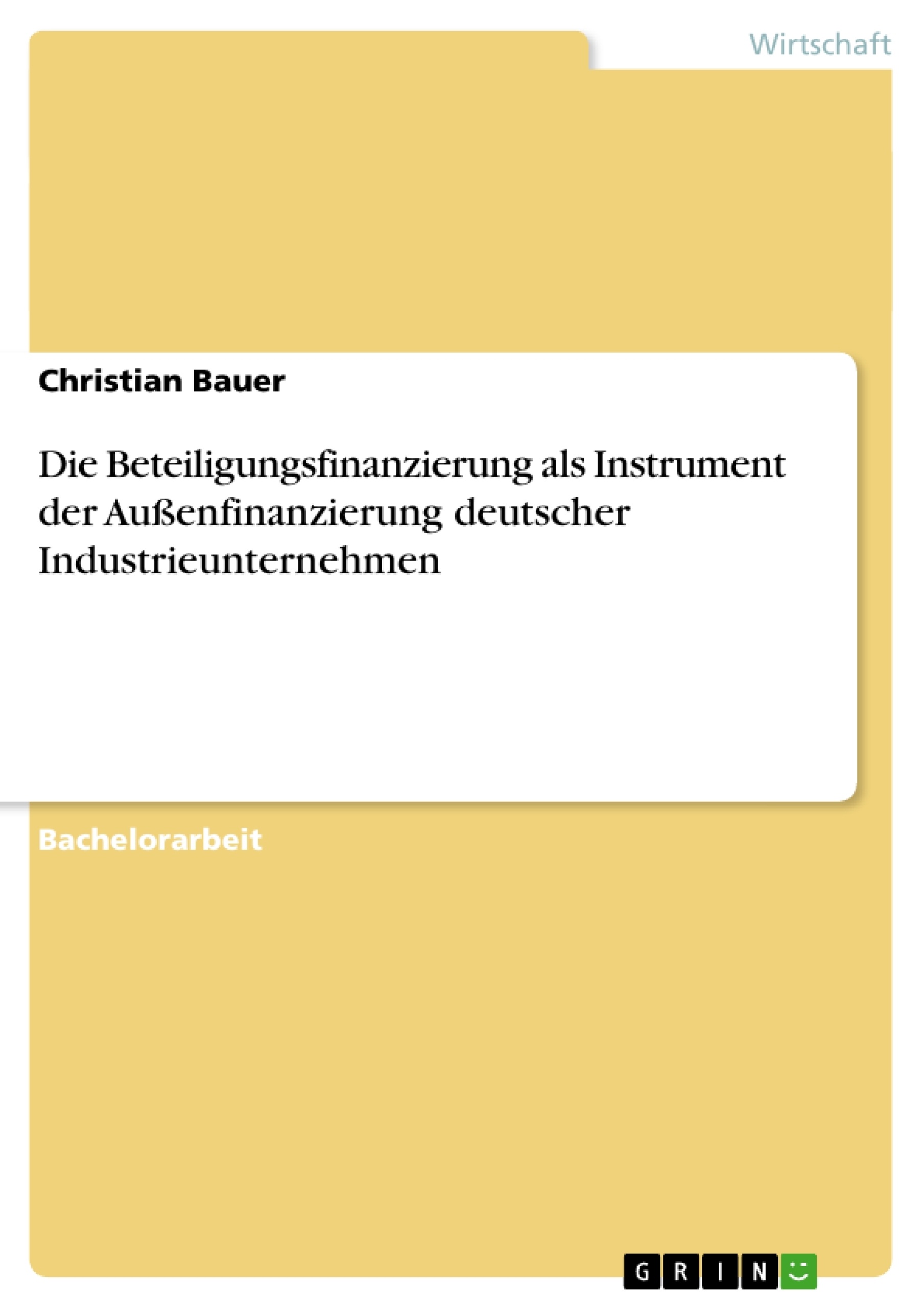In einem marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftssystem ist die Überschusserzielung das oberste Ziel eines Unternehmers. Sollte dieses durch die Herstellung und den Verkauf von Gütern erreicht werden, was die Gründung eines Industriebetriebes erfordert, dann sind konstitutive Entscheidungen, wie Rechtsform- und Standortwahl usw., zu treffen. Im Anschluss daran sind Produktionsfaktoren zu beschaffen. Arbeitskräfte müssen ausgewählt, eingestellt und bei Bedarf ausgebildet werden. Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge etc. müssen erworben werden. Ebenso benötigt man die Rohstoffe oder Halbfabrikate, aus denen später im Leistungsprozess marktfähige Produkte hergestellt werden. Solch ein Gründungsvorhaben stellt auch immer den Ausgangspunkt für weitere finanzwirtschaftliche Überlegungen dar, da das ganze Vorhaben nur gelingen kann, wenn der Unternehmer über ausreichende finanzielle Mittel zur Beschaffung der benötigten Produktionsmittel und zur Finanzierung des fortlaufenden Betriebes verfügt. Die Gesamtheit der Finanzierungsquellen, die einem Unternehmen hierfür zur Verfügung steht, wird als Kapital bezeichnet. Den Prozess der Bereitstellung des Kapitals nennt man Finanzierung. Nur selten wird der Eigentümer die Finanzierung zu 100 % aus eigenen Mitteln bestreiten können, was dann als Innenfinanzierung bezeichnet wird. In der Regel ist er auf die Kapitalüberlassung unternehmensexterner Dritter angewiesen, welche dann als Außenfinanzierung bezeichnet wird. Die Beteiligungsfinanzierung ist ein ganz besonderes Instrument der Außenfinanzierung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung des Instruments der Beteiligungsfinanzierung. Zunächst wird auf die finanzwirtschaftlichen Interessen und Ziele eingegangen und im Anschluss die Bedeutung und der Stellenwert der Rechtsform in Bezug auf die Beteiligungsfinanzierung beleuchtet. Nachdem dem Leser die unterschiedlichen Wege der Beteiligungsfinanzierung näher gebracht wurden, werden die Anlässe, die zu einer Beteiligung führen, erläutert. Ein aktuelles Beispiel aus der Wirtschaft dient hier als Beispiel.
Den Abschluss der Arbeit bilden die einzelnen Phasen des Beteiligungsprozesses sowie eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Beteiligungsfinanzierung aus Sicht des Kapitalgebers und des Kapitalnehmers.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Beteiligungsfinanzierung
- 2.1 Der Begriff der Beteiligungsfinanzierung
- 2.2 Die finanzwirtschaftlichen Interessen und Ziele
- 2.2.1 Die Ziele und Interessen der Kapitalgeber
- 2.2.2 Die Ziele und Interessen der Kapitalnehmer
- 2.3 Die Bedeutung der Rechtsform bei der Beteiligungsfinanzierung
- 2.3.1 Die Personengesellschaften
- 2.3.2 Die Kapitalgesellschaften
- 3. Unterschiedliche Wege der Beteiligungsfinanzierung
- 3.1 Beteiligungsfinanzierung von Unternehmen ohne Börsenzugang
- 3.2 Beteiligungsfinanzierung von Unternehmen mit Börsenzugang
- 3.3 Beteiligungsfinanzierung durch Mitarbeiter und Management
- 3.4 Beteiligungsfinanzierung mit Venture Capital und Business Angels
- 3.4.1 Die Phasen der Venture Capital Finanzierung
- 4. Anlässe zur Beteiligungsfinanzierung
- 4.1 Die Gründung
- 4.2 Die Kapitalerhöhung
- 4.3 Die Kapitalherabsetzung
- 4.4 Die Umwandlung
- 4.5 Die Fusion
- 4.6 Die Liquidation
- 5. Die Kapitalerhöhung am Beispiel von Infineon Technologies AG
- 6. Die Phasen des Beteiligungsprozesses bei einer Kapitalgesellschaft
- 6.1 Voraussetzungen einer Beteiligungsfinanzierung
- 6.2 Kontaktaufnahme
- 6.3 Beteiligungswürdigkeitsprüfung
- 6.4 Vertragsverhandlung
- 6.5 Fortlaufende Betreuung der Kapitalgeber
- 6.6 Desinvestition
- 7. Die Vor- und Nachteile einer Beteiligungsfinanzierung
- 7.1 Interessenlage Kapitalgeber
- 7.2 Interessenlage Kapitalnehmer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Beteiligungsfinanzierung als Instrument der Außenfinanzierung deutscher Industrieunternehmen. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der Beteiligungsfinanzierung, deren Anlässe und den Beteiligungsprozess detailliert darzustellen und die Vor- und Nachteile für Kapitalgeber und -nehmer zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung der Beteiligungsfinanzierung
- Unterschiedliche Wege der Beteiligungsfinanzierung (z.B. Venture Capital, Private Equity)
- Anlässe für Beteiligungsfinanzierungen (z.B. Gründung, Kapitalerhöhung)
- Der Beteiligungsprozess bei Kapitalgesellschaften
- Vorteile und Nachteile der Beteiligungsfinanzierung für beide Seiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Beteiligungsfinanzierung ein und beschreibt die Relevanz der Thematik für deutsche Industrieunternehmen. Es skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
2. Die Beteiligungsfinanzierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Beteiligungsfinanzierung und analysiert die finanzwirtschaftlichen Interessen und Ziele der Kapitalgeber und -nehmer. Es untersucht die Bedeutung der Rechtsform (Personengesellschaften vs. Kapitalgesellschaften) im Kontext der Beteiligungsfinanzierung. Die unterschiedlichen Zielsetzungen und Interessen beider Parteien werden detailliert beleuchtet und ihre Auswirkungen auf den Gestaltungsrahmen der Finanzierung erörtert, inklusive der verschiedenen rechtlichen Implikationen.
3. Unterschiedliche Wege der Beteiligungsfinanzierung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Wege der Beteiligungsfinanzierung, differenziert nach Unternehmen mit und ohne Börsenzugang. Es geht detailliert auf die Beteiligungsfinanzierung durch Mitarbeiter und Management ein, sowie auf die Finanzierung durch Venture Capital und Business Angels, inklusive einer Beschreibung der einzelnen Phasen der Venture Capital Finanzierung (Seed-Financing bis Fourth-Stage-Financing). Der Fokus liegt auf der Unterscheidung der verschiedenen Modelle und deren jeweiligen Anwendungsfälle.
4. Anlässe zur Beteiligungsfinanzierung: Dieses Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Anlässen, die Unternehmen zur Beteiligungsfinanzierung bewegen. Es beschreibt detailliert die Gründung eines Unternehmens, Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen, Umwandlungen, Fusionen und Liquidationen als Auslöser für eine Beteiligungsfinanzierung. Es werden die spezifischen Herausforderungen und Chancen in jedem Szenario analysiert.
5. Die Kapitalerhöhung am Beispiel von Infineon Technologies AG: Dieses Kapitel analysiert eine konkrete Kapitalerhöhung eines Unternehmens, um die theoretischen Konzepte aus den vorherigen Kapiteln zu illustrieren. Es wird der Fall von Infineon Technologies AG untersucht und die Hintergründe, der Ablauf sowie die Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf das Unternehmen analysiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der theoretischen Grundlagen.
6. Die Phasen des Beteiligungsprozesses bei einer Kapitalgesellschaft: Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Phasen des Beteiligungsprozesses bei einer Kapitalgesellschaft, von den Voraussetzungen über die Kontaktaufnahme und die Prüfung der Beteiligungswürdigkeit bis hin zur Vertragsverhandlung, der Betreuung der Kapitalgeber und der Desinvestition. Jeder Schritt des Prozesses wird detailliert erläutert und die Bedeutung jeder Phase für den Erfolg der Beteiligung hervorgehoben.
7. Die Vor- und Nachteile einer Beteiligungsfinanzierung: Dieses Kapitel fasst die Vor- und Nachteile einer Beteiligungsfinanzierung aus der Perspektive der Kapitalgeber und -nehmer zusammen. Es vergleicht die verschiedenen Aspekte der Beteiligungsfinanzierung mit anderen Finanzierungsformen und analysiert die jeweiligen Stärken und Schwächen im Detail. Der Fokus liegt auf einem ausgewogenen Abwägen der Interessen beider Parteien.
Schlüsselwörter
Beteiligungsfinanzierung, Außenfinanzierung, Industrieunternehmen, Venture Capital, Business Angels, Kapitalgeber, Kapitalnehmer, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Fusion, Akquisition, Rechtsform, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Beteiligungsprozess, Due Diligence.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Beteiligungsfinanzierung deutscher Industrieunternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Beteiligungsfinanzierung als Instrument der Außenfinanzierung deutscher Industrieunternehmen. Sie beschreibt detailliert die verschiedenen Formen der Beteiligungsfinanzierung, deren Anlässe und den Beteiligungsprozess und analysiert die Vor- und Nachteile für Kapitalgeber und -nehmer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung der Beteiligungsfinanzierung; verschiedene Wege der Beteiligungsfinanzierung (z.B. Venture Capital, Private Equity); Anlässe für Beteiligungsfinanzierungen (z.B. Gründung, Kapitalerhöhung); den Beteiligungsprozess bei Kapitalgesellschaften; Vorteile und Nachteile der Beteiligungsfinanzierung für beide Seiten; die Bedeutung der Rechtsform (Personengesellschaften vs. Kapitalgesellschaften); die Phasen der Venture Capital Finanzierung (Seed-Financing bis Fourth-Stage-Financing); und eine Fallstudie zur Kapitalerhöhung bei Infineon Technologies AG.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung und beschreibt die Relevanz des Themas. Kapitel 2 definiert Beteiligungsfinanzierung und analysiert die Interessen von Kapitalgebern und -nehmern. Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Wege der Beteiligungsfinanzierung, inklusive Venture Capital und Business Angels. Kapitel 4 beschreibt Anlässe für Beteiligungsfinanzierungen (Gründung, Kapitalerhöhung etc.). Kapitel 5 analysiert eine Kapitalerhöhung bei Infineon Technologies AG. Kapitel 6 beschreibt den Beteiligungsprozess bei Kapitalgesellschaften. Kapitel 7 fasst die Vor- und Nachteile der Beteiligungsfinanzierung zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Formen der Beteiligungsfinanzierung, deren Anlässe und den Beteiligungsprozess detailliert darzustellen und die Vor- und Nachteile für Kapitalgeber und -nehmer zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Beteiligungsfinanzierung, Außenfinanzierung, Industrieunternehmen, Venture Capital, Business Angels, Kapitalgeber, Kapitalnehmer, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Fusion, Akquisition, Rechtsform, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Beteiligungsprozess, Due Diligence.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist übersichtlich strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung, die die Zielsetzung und Themenschwerpunkte beschreibt, Kapitelzusammenfassungen, und einem Schlussteil mit Schlüsselwörtern. Die einzelnen Kapitel bauen logisch aufeinander auf und bieten einen umfassenden Überblick über das Thema Beteiligungsfinanzierung.
Welche Arten von Beteiligungsfinanzierung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten der Beteiligungsfinanzierung, darunter Beteiligungsfinanzierung von Unternehmen mit und ohne Börsenzugang, Beteiligungsfinanzierung durch Mitarbeiter und Management, sowie Beteiligungsfinanzierung mit Venture Capital und Business Angels.
Welche Anlässe für Beteiligungsfinanzierung werden untersucht?
Untersucht werden Anlässe wie Unternehmensgründung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Umwandlung, Fusion und Liquidation.
Wer sind die Zielgruppen dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit dem Thema Beteiligungsfinanzierung befassen.
- Quote paper
- Christian Bauer (Author), 2009, Die Beteiligungsfinanzierung als Instrument der Außenfinanzierung deutscher Industrieunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143405