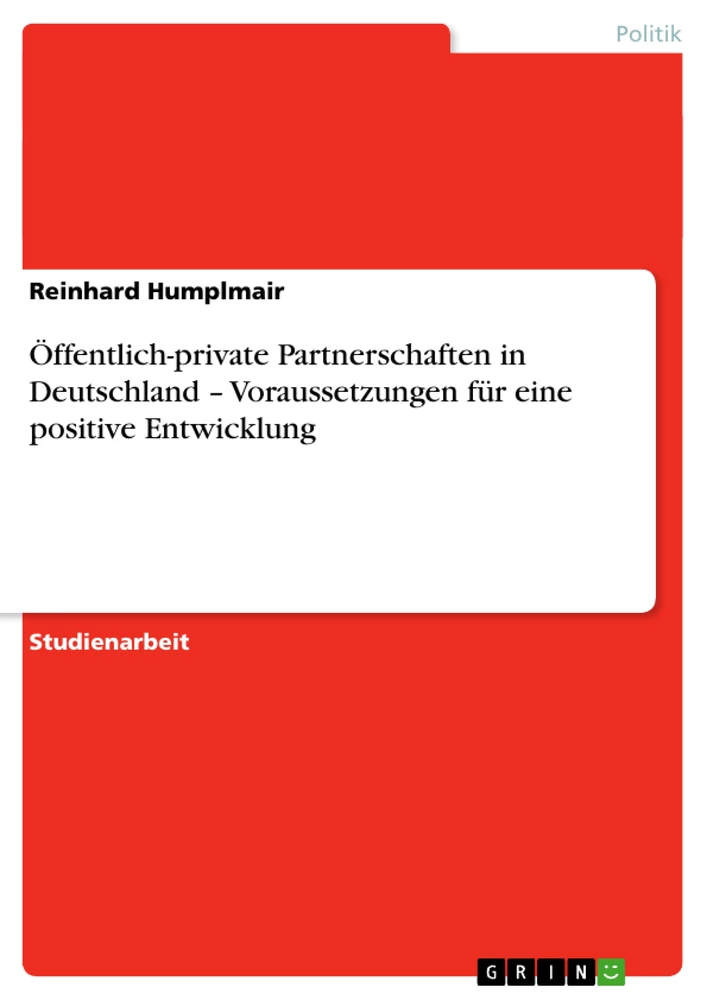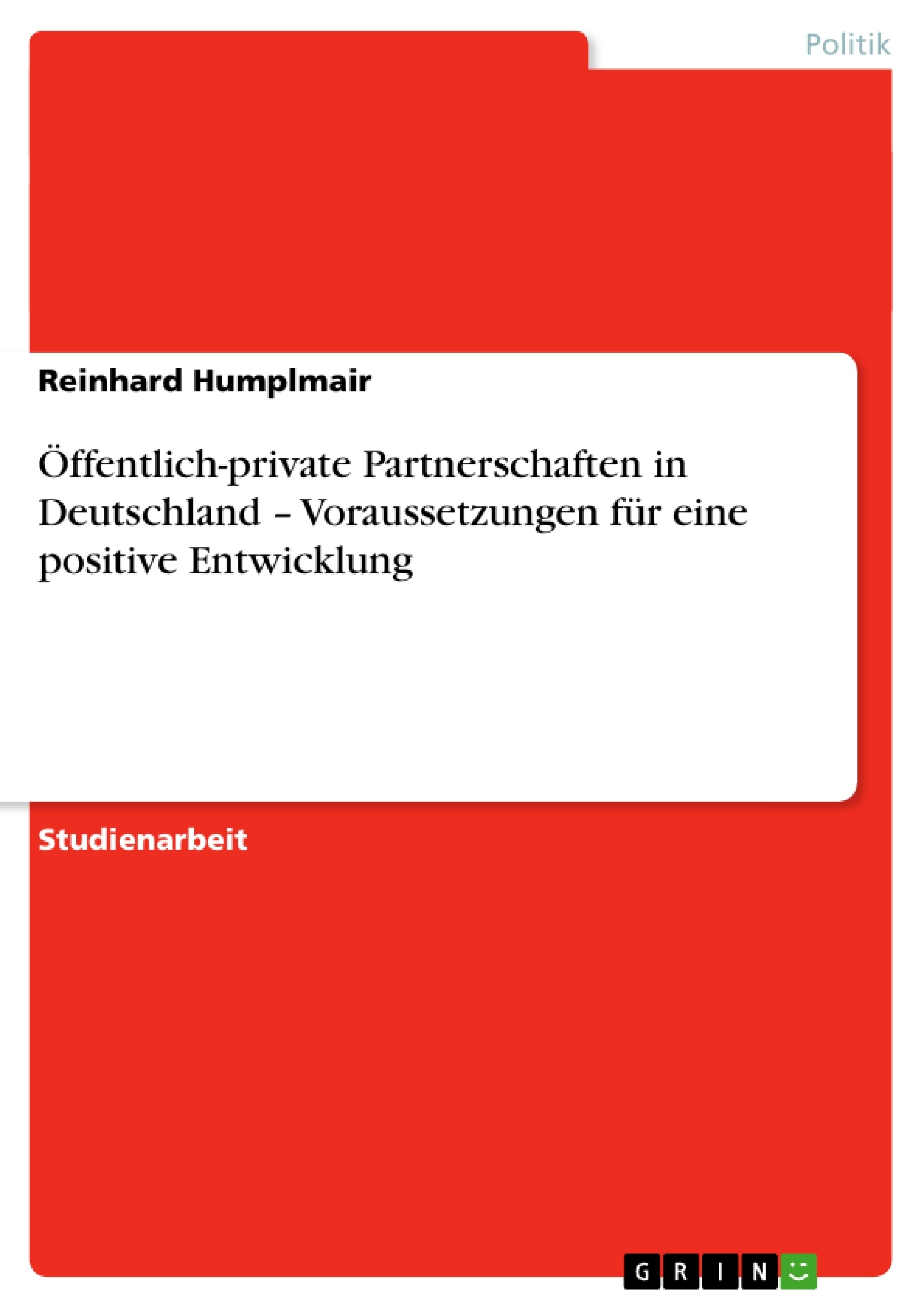Seit Beginn der 90er Jahre hat im Rahmen der Debatte um das Regieren in Städten und Gemeinden, dem Miteinbinden bürgerschaftlichen Engagements sowie die Reformen staatlicher Leistungserbringung der Begriff Local Governance Einzug gehalten. Damit wird die zunehmende Verbreitung netzwerkartiger Kooperationen von staatlichen, privatunternehmerischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren erfasst. Die öffentliche Verwaltung stellt sich mehr und mehr den veränderten Umweltbedingungen und geht neue Wege in der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. (vgl. Sack, 2007, S. 251).
Ein Hauptproblem sind besonders seit dem Ende der 1980er Jahre die vielerorts klammen Haushaltskassen der öffentlichen Verwaltung, was zu enormen Problemen bei der Aufgabenwahrnehmung des öffentlichen Sektors und gravierenden Investitionsrückständen führt. Selbst steigende Einnahmen können die Finanzierungslücken nicht mehr schließen und so wurde und wird intensiv über Möglichkeiten der Ökonomisierung staatlichen Handelns nachgedacht. Wirtschaftliche Überlegungen spielen im Bereich der öffentlichen Aufgabenerledigung eine immer größere Rolle, zudem steigt auch die Leistungserwartung der Bürger an.
Ein in jüngerer Zeit viel diskutierter Ansatz zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Leistungserbringung sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Durch diese lassen sich nach empirischen internationalen Erfahrungen bei geeigneten Projekten erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, teilweise im zweistelligen Prozentbereich (vlg. Weber, 2006, S. 139).
Im Laufe dieser Arbeit werden zunächst grundlegende Merkmale und Ausprägungen des Begriffs öffentlich-private Partnerschaften erläutert. Nachdem die Beweggründe für das Eingehen von öffentlich-privaten Partnerschaften genannt werden, werden das Entstehen, die aktuelle Situation und neueste Entwicklungen dieser Partnerschaften dargestellt und ein Praxisbeispiel gezeigt.
Schließlich wird nach einer kritischen Analyse erörtert, unter welchen Voraussetzungen öffentlich-private Partnerschaften eine positive Entwicklung in Deutschland nehmen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind öffentlich-private Partnerschaften?
- Begriff
- Gemeinsame Merkmale
- Definitionsansatz
- Wie können ÖPP gestaltet sein?
- Kooperationsformen
- Öffentlich-Private Vertragsbeziehungen
- Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften
- Strategische vs. operative Ausrichtung
- Warum werden ÖPP eingegangen?
- Gründe
- Ziele
- Die Entwicklung von ÖPP in Deutschland
- Drei Wellen
- Aktuelle Sachlage
- Initiative der Bundesregierung
- Praxisbeispiel Schulprojekt Offenbach
- Eine kritische Betrachtung von ÖPP
- Vor- und Nachteile
- Effizienzgewinne und Transaktionskostentheorie
- Einflussverlust und Prinzipal-Agent Problem
- Voraussetzungen für eine positive Entwicklung von ÖPP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) in Deutschland und untersucht die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung dieser Kooperationsform. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entstehung und der aktuellen Situation von ÖPP sowie der kritischen Betrachtung der Vor- und Nachteile dieser Partnerschaftsform.
- Begriffsbestimmung und Merkmale von öffentlich-privaten Partnerschaften
- Motive und Gründe für den Abschluss von ÖPP
- Die Entwicklung von ÖPP in Deutschland, insbesondere die aktuelle Situation und die Initiative der Bundesregierung
- Kritische Analyse der Vor- und Nachteile von ÖPP, insbesondere die Effizienzgewinne und Transaktionskostentheorie sowie der Einflussverlust und das Prinzipal-Agent Problem
- Voraussetzungen für eine positive Entwicklung von ÖPP in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Begriff Local Governance ein und erläutert die Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung im Kontext knapper Kassen und steigender Leistungserwartungen. ÖPP werden als Ansatz zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit öffentlicher Leistungserbringung vorgestellt.
- Was sind öffentlich-private Partnerschaften?: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff, die gemeinsamen Merkmale und den Definitionsansatz von ÖPP. Es wird die Vielfalt der möglichen Anwendungsbereiche von ÖPP in verschiedenen Sektoren des öffentlichen Lebens aufgezeigt.
- Wie können ÖPP gestaltet sein?: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Kooperationsformen von ÖPP, darunter öffentlich-private Vertragsbeziehungen und gemischtwirtschaftliche Gesellschaften. Es werden die Unterschiede zwischen strategischen und operativen Ausrichtungen von ÖPP betrachtet.
- Warum werden ÖPP eingegangen?: Dieses Kapitel analysiert die Gründe und Ziele für den Abschluss von ÖPP. Es werden die Motive der öffentlichen Hand und der privaten Partner beleuchtet.
- Die Entwicklung von ÖPP in Deutschland: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung von ÖPP in Deutschland nach, wobei die drei Wellen der Entwicklung, die aktuelle Sachlage und die Initiative der Bundesregierung im Fokus stehen. Ein Praxisbeispiel aus Offenbach verdeutlicht die praktische Anwendung von ÖPP.
- Eine kritische Betrachtung von ÖPP: Dieses Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile von ÖPP. Es wird die Effizienzgewinne und die Transaktionskostentheorie sowie der Einflussverlust und das Prinzipal-Agent Problem diskutiert.
Schlüsselwörter
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), Public Private Partnership (PPP), Local Governance, Finanzierung, Bau, Betrieb, Unterhalt, Infrastruktur, Dienstleistungen, Risiken, Transaktionskosten, Effizienz, Prinzipal-Agent Problem, Deutschland, Initiative der Bundesregierung.
- Quote paper
- Reinhard Humplmair (Author), 2008, Öffentlich-private Partnerschaften in Deutschland – Voraussetzungen für eine positive Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143284