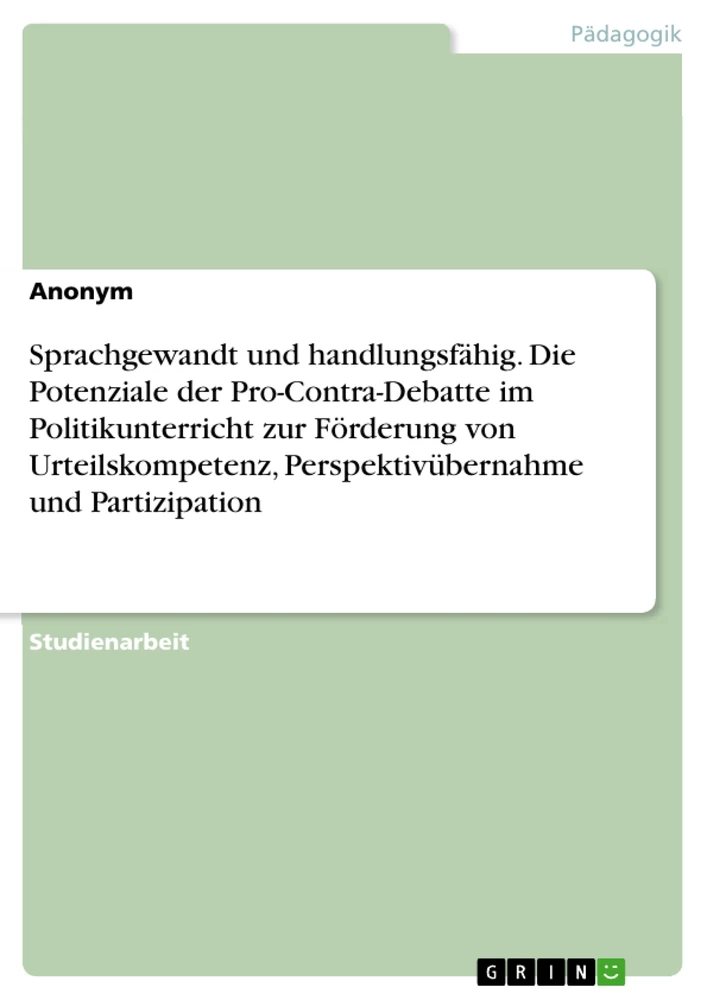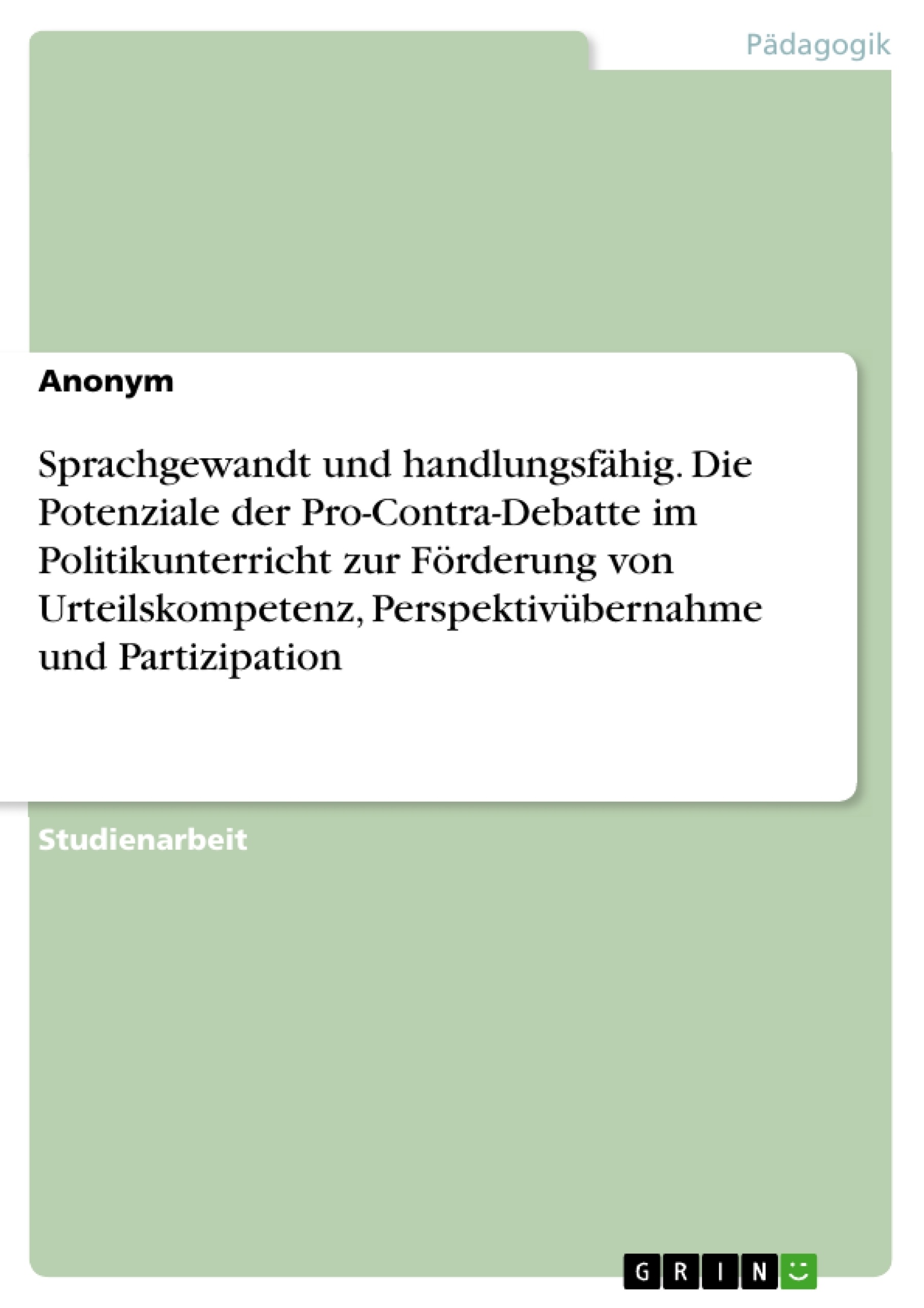Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Rolle der Pro-Contra-Debatte als Methode im politischen Unterricht, um die Urteilskompetenz, Perspektivübernahme und Partizipation von Schüler:innen zu fördern. Unter Berücksichtigung der Aussage von Massing, dass Politik durch Sprache konstruiert und vermittelt wird, wird die Bedeutung der Kommunikation im Politikunterricht betont. Aufgrund des Beutelsbacher Konsens, der das Indoktrinationsverbot im politischen Unterricht festlegt, findet insbesondere simulatives politisches Handeln, wie die Pro-Contra-Debatte, Anwendung.
Die Arbeit beginnt mit der Begründung und Erklärung der ausgewählten Kompetenzen (Urteilskompetenz, Perspektivübernahme, Partizipation) als zentrale Ziele politischer Bildung. Die Pro-Contra-Debatte wird daraufhin begrifflich abgegrenzt und detailliert beschrieben, einschließlich ihrer Hindernisse und Potenziale. Die theoretische Grundlage bildet die Verbindung zwischen der Methode und der Förderung der genannten Kompetenzen.
Im weiteren Verlauf wird die Bedeutung der Pro-Contra-Debatte für die politische Bildung und die Entwicklung der genannten Kompetenzen im Unterricht herausgestellt. Die Analyse umfasst die Diskussion über die Lernpotenziale der Methode und deren Beitrag zur Reflexion über Sprache sowie politische Entscheidungsprozesse. Abschließend wird die Frage beantwortet, inwieweit die Pro-Contra-Debatte als geeignete Methode zur Förderung der genannten Kompetenzen im Rahmen des politischen Unterrichts betrachtet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung der Kompetenzenauswahl
- Die Pro-Contra-Debatte als Methode der politischen Bildung
- Begriffserklärung
- Aufbau, Ablauf, Akteure und Auswertung der Pro-Contra-Debatte
- Hinweise für die Unterrichtspraxis
- Kompetenzentwicklung und Bedeutung der Pro-Contra-Debatte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text untersucht die Eignung der Pro-Contra-Debatte zur Förderung der Urteilskompetenz, Perspektivübernahme und Partizipation von Schülerinnen und Schülern im Politikunterricht. Er beleuchtet die Bedeutung dieser Kompetenzen im Kontext der politischen Bildung und analysiert die Pro-Contra-Debatte als Methode, um diese Fähigkeiten zu entwickeln.
- Relevanz von Urteilskompetenz, Perspektivübernahme und Partizipation in der politischen Bildung
- Die Pro-Contra-Debatte als Methode zur Förderung der genannten Kompetenzen
- Der Einsatz der Pro-Contra-Debatte im Unterricht und ihre spezifischen Herausforderungen
- Die Rolle der Pro-Contra-Debatte in der Entwicklung von Handlungsfähigkeit und Demokratieverständnis
- Analyse der Stärken und Schwächen der Methode im Kontext der politischen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung des Textes vor: Inwieweit ist die Pro-Contra-Debatte geeignet, um die Urteilskompetenz, Perspektivübernahme und Partizipation von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des politischen Unterrichts zu fördern? Anschließend wird die Auswahl der genannten Kompetenzen begründet und erläutert.
Im zweiten Kapitel werden die methodischen Grundlagen der Pro-Contra-Debatte erörtert. Dazu wird die Methode begrifflich abgegrenzt und ihr Einsatz anhand von konkreten Beispielen beschrieben. Besonderes Augenmerk wird auf die spezifischen Regeln, die Rollenverteilung und die Auswertung der Debatte gelegt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Pro-Contra-Debatte für die politische Bildung. Es wird untersucht, inwieweit die Methode zur Entwicklung der oben genannten Kompetenzen beitragen kann. Dazu werden die Potenziale der Pro-Contra-Debatte im Kontext der politischen Bildung diskutiert.
Schlüsselwörter
Politische Bildung, Pro-Contra-Debatte, Urteilskompetenz, Perspektivübernahme, Partizipation, Handlungsfähigkeit, Demokratieverständnis, Unterrichtsmethoden, simulative Methoden, politische Entscheidungsfindung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Sprachgewandt und handlungsfähig. Die Potenziale der Pro-Contra-Debatte im Politikunterricht zur Förderung von Urteilskompetenz, Perspektivübernahme und Partizipation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1432172